Wenn sie hält, was das sie begleitende Buch verspricht, dann wird die vom 8. Juli 2020 bis zum 11. April 2021 in München im Deutschen Theatermuseum stattfindende Ausstellung mit dem Titel Regietheater eine hochinteressante werden. Claudia Blank hat das Buch verfasst, C. Bernd Sucher das ebenso informationsreiche Nachwort geschrieben.
Mit dem Begriff Regietheater verbindet der gestresste Opernbesucher eine Wurststullen schmierende Amneris, Aldi-Tüten schleppende Timur und Altoum, die von ihren Sprösslingen abgemurkst werden, und einen mit Chemikalien entsorgten Simone-Leichnam. Um Oper geht es in dem Buch nur sporadisch, fast ausschließlich um Sprechtheater, aber auch aus einem anderen Grund erfährt man Erfreulicheres, denn es beginnt bereits mit Otto Brahm und Max Reinhardt, also in einem Zeitalter, als Regie an sich überhaupt erst zum Thema wurde, sie zuvor kaum eine Rolle gespielt hatte.
Das Buch ist vielfach gegliedert, einerseits chronologisch, gleichzeitig aber auch thematisch, so dass die Namen Otto Brahm, Max Reinhardt, Leopold Jessner, Fritz Kortner, Gustav Gründgens, Peter Zadek, Peter Stein und Claus Peymann immer wieder, aber stets in anderem Zusammenhang auftauchen, dazu noch viele weitere Regisseure aus jüngerer Zeit. Der Untertitel Eine deutsch-österreichische Geschichte weist darauf hin, dass besonders das Wiener Burgtheater eine große Rolle spielt neben vor allem Berliner, aber auch anderen deutschen Bühnen.
Die fünf Hauptkapitel, die ihrerseits wieder vielfältig untergliedert sind, nennen sich Intention und Ästhetik, Laufbahnen, Arbeitsstil und Probenarbeit, Inszenierungsstil und Repertoire.
Der Einleitung ist zu entnehmen, dass Regietheater in der Oper weit später als im Sprechtheater eine Rolle zu spielen begann, während in diesem sehr früh von einem „interpretierenden Dialog“, also einer Art Gleichwertigkeit von Dichter und Regisseur die Rede ist. Interessant ist, dass dem Feuilleton mit seiner „Sucht nach Neuem“ die „Schuld“ daran gegeben wird, dass Regisseure sich nicht mehr mit einer bescheiden dem Werk dienenden Rolle zufrieden geben mochten.
Das Buch zeichnet aus, dass eine Fülle von Primärquellen herangezogen wird und dass es mit Erfolg versucht, klar Tendenzen herauszuarbeiten, auch zu interessanten Feststellungen wie der zu kommen, dass es Generationenkonflikte waren, die die Entwicklung des Kultur, insbesondere des Theaterlebens, prägten. Einen solchen sieht die Verfasserin in der nie offen ausgetragenen Gegnerschaft zwischen Otto Brahm, der dem Naturalismus auf Berliner Bühnen zum Durchbruch verhalf, und Max Reinhardt, dem es um Schönheit und Überwältigung des Publikums mit seinen Inszenierungen ging. Generationenkonflikte spielten sich ebenso auch zwischen Kortner und Reinhardt, zwischen Stein und Kortner ab.
Interessant ist die enge Verbindung, die Regisseure zu zeitgenössischen Schriftstellern und Malern hatten, die sie sich, das auch konfliktträchtig für die Beziehung zwischen Brahm und Reinhardt, gegenseitig abzuwerben versuchten. Hofmannsthal Hauptmann, Schnitzler gehörten zu den Umworbenen. Dabei und auch in andren Fragen kommt Reinhardt längst nicht so gut weg, ist von seiner „gnadenlosen Konkurrenz“ die Rede und seinem nicht von jedem gern gesehenen „privaten Theater-Imperium“.
Für den Leser ist die bereits erwähnte Gliederung des Buches nicht immer einfach nachzuvollziehen, aber wohl dem Aufbau der Ausstellung geschuldet.
Die Gegnerschaft Kortners gegenüber Reinhardt beruht zum Teil auf dessen Erfahrungen bei der Einstudierung des Jedermann, aber auch die Gegenpole Theater als moralische Anstalt oder Tempel des Genusses und der Freude spielen mit hinein. Als Beispiele werden Brahms Weber-Produktion und Reinhardts Sommernachtstraum aufgeführt.
Der Leser kann quasi noch einmal miterleben, wie Aufführungen in der Theaterstadt Berlin Kritik und Publikum spalteten, so Leopold Jessners Wilhelm Tell, dessen Bühnenbild eine „Idee der Alpen“, nicht eine Illusion davon vermitteln soltel. Er trifft auf die Kritiker in vielen Zitaten, auf Namen, die ihm bereits in ebenfalls in letzter Zeit erschienenen Büchern über Lehar, Kollo oder Furtwängler begegnet sind.
Mancher Leser wird sich noch um den erbitterten Streit zwischen Kortner und Gründgens erinnern, der in dem Düsseldorfer Manifest, das Kortner auf sich beziehen musste, seinen Höhepunkt fand. Davon ist allerdings erst später im Buch die Rede. Zunächst geht es um die unterschiedliche Auffassung vom Charakter König Philipps in Schillers Don Carlos, der Kortner zum bösen Begriff Leharisierung greifen ließ. Schüsse ins Publikum, die nicht Kortner, sondern eine mangelhafte Technik zu verantworten hatten, kosteten Kortner wohl die Intendanz des Schillertheaters.
Es wird auch weiterhin viel Aufregendes berichtet, so über Peymanns Aufarbeitung der Nazizeit, Peter Steins wundersame Wandlung, Peter Zadeks Einsicht, dass Beeinflussung durch das Theater reine Utopie sei.
Im Kapitel Laufbahnen werden diejenigen nachgezeichnet, die vom Schauspieler zum Regisseur führten oder über ein Studium oder in Verbindung mit einer Intendanz. Dabei tauchen die bereits bekannten Namen wieder auf. Ebenso ist es mit dem Vergleich der Arbeitsstile, seien sie das Vorspielen, Improvisieren, ein diktatorisches oder partnerschaftliches Verhalten gegenüber den Schauspielern. Auch Schauspieler kommen zu Wort, so wenn Curt Bois sich über den Probenstil Kortners, der sich für Stunden bei einem Satz aufhalten konnte, mokiert.
Natürlich kommt auch das Kapitel Werktreue oder vielmehr das Abweichen davon nicht zu kurz, und damit beginnen auch die schlimmen Fotos, so von einem Othello. Und verräterisch ist der Begriff „respektfrei“ anstelle von respektlos, der manchem gestressten Theaterbesucher zu positiv klingen mag, selbst wenn mit Goethe argumentiert wird:“ Und umzuschaffen das Geschaffene, damit sich’s nicht zum Starren waffne, wirkt ewiges, lebendiges Tun.“ Ob er damit seinen Faust in Castorfs Inszenierung an der Berliner Volksbühne mit eingeschlossen hätte, darf bezweifelt werden.
Schließlich werden noch die Allianzen von Regisseur und Bühnenbildner beschrieben, so die von Gründgens‘ und Theo Otto, Kortners und Caspar Nehers, Steins und Jürgen Roses oder Peymanns mit Achim Freyer. Auch neue Techniken, die Drehbühne, der Rundhorizont kommen zur Sprache. Bemerkenswert ist, dass nur Brahm und Zadek sich nicht mit Faust befassten, dass nicht nur die Altvorderen, sondern auch moderne Regisseure Kontakte zu Schriftstellern pflegten wie Peymann mit Thomas Bernhard, Stein mit Botho Strauß, Zadek mit Tankred Dorst.
Ein Nachwort in die Zukunft nennt C. Bernd Sucher seinen Beitrag und stellt fest, dass kein ästhetischer und ideologischer Konsens mehr unter den ganz jungen Regisseuren auszumachen sei. Er listet sie auf in den verliebten Spieler (Luc Bondy), den feinfühligen Choreographen (Andreas Kriegenburg), den radikalen Zertrümmerer (Frank Castorf), den gesellschaftskritischen Performer (Christoph Schlingensief), den intellektuellen Zweifler (Leander Haußmann), und nach so viel Sprechtheater kommt auch die Oper ins Spiel mit Schlingensiefs Parsifal und Davis Böschs Meistersingern.
Wer das Buch gelesen hat, wird die Ausstellung nicht verfehlen wollen. Und wer die Ausstellung gesehen hat, wird hoffentlich unbedingt das Buch lesen wollen. Das bietet im umfangreichen Anhang zudem Anmerkungen, Literaturverzeichnis, Ergänzungen zum reichlichen Bildmaterial und ein Namensregister (425 Seiten, Henschelverlag 2020, ISBN 978 3 89487 815 3). Ingrid Wanja


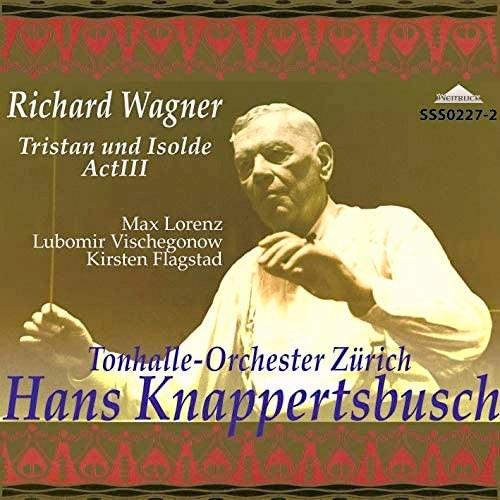



 Der akustisch so gerühmte Herkulessaal in München kommt in der Box ein letztes Mal im dirigentischen Beitrag von
Der akustisch so gerühmte Herkulessaal in München kommt in der Box ein letztes Mal im dirigentischen Beitrag von 




 Frau Gritskova und Frau Prinz: Sergej Prokofjew ist einer der bekanntesten russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Als Komponist von Liedern ist er aber zumindest in Mitteleuropa kaum bekannt. Ist denn auch in Russland eine Vernachlässigung der Prokofjew-Lieder feststellbar oder ist das vor allem ein außerrussisches Phänomen und dann vielleicht vor allem der Sprachbarriere geschuldet?
Frau Gritskova und Frau Prinz: Sergej Prokofjew ist einer der bekanntesten russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Als Komponist von Liedern ist er aber zumindest in Mitteleuropa kaum bekannt. Ist denn auch in Russland eine Vernachlässigung der Prokofjew-Lieder feststellbar oder ist das vor allem ein außerrussisches Phänomen und dann vielleicht vor allem der Sprachbarriere geschuldet? 


 Abschließend noch ein Wort zur aktuellen Lage des Kulturbetriebs: Sie, Frau Gritskova, haben vor wenigen Wochen an der Operngala der deutschen AIDS-Stiftung teilgenommen, die aufgrund der Coronabeschränkungen zum digitalen Event umgeformt wurde und zu der die beteiligten Künstlerinnen und Künstler Beiträge in Form kleiner Heim-Konzerte sozusagen aus dem heimischen Wohnzimmer beigetragen haben. Wie haben Sie diese ungewöhnliche Situation erlebt?
Abschließend noch ein Wort zur aktuellen Lage des Kulturbetriebs: Sie, Frau Gritskova, haben vor wenigen Wochen an der Operngala der deutschen AIDS-Stiftung teilgenommen, die aufgrund der Coronabeschränkungen zum digitalen Event umgeformt wurde und zu der die beteiligten Künstlerinnen und Künstler Beiträge in Form kleiner Heim-Konzerte sozusagen aus dem heimischen Wohnzimmer beigetragen haben. Wie haben Sie diese ungewöhnliche Situation erlebt? 



