Die renommierte Sängerin Margarita Gritskova und ihre Pianistin Maria Prinz, die auch als Solistin auf sehr erfolgreiche Auftritte verweisen kann, haben gerade ihr Naxos-Album „Songs and Romances“ mit Liedern von Sergej Prokofiew heraus gebracht – Anlass zu einem Doppel-Gespräch mit René Brinkmann.
 Frau Gritskova und Frau Prinz: Sergej Prokofjew ist einer der bekanntesten russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Als Komponist von Liedern ist er aber zumindest in Mitteleuropa kaum bekannt. Ist denn auch in Russland eine Vernachlässigung der Prokofjew-Lieder feststellbar oder ist das vor allem ein außerrussisches Phänomen und dann vielleicht vor allem der Sprachbarriere geschuldet? Das Lied hat im Schaffen Prokofjews keine zentrale Rolle, obwohl gerade in diesem Genre manch fantastische Juwelen zu finden sind und Prokofjew durch die Arbeit an dieser Gattung an den lyrischen Qualitäten seiner Kompositionstechnik feilen konnte. Auch in Russland werden die Lieder nicht so oft aufgeführt, wie Klavier- oder Orchesterwerke von Prokofjew oder Lieder der russischen „Klassiker“ – Tschaikowski und Rachmaninow. Fast unbekannt sind diese Lieder außerhalb Russlands, sicher auch wegen der Sprachbarriere. Aber die Musik gibt so genau den Sinn der Poesie wieder, emotional und inhaltlich, dass man sehr wohl spürt und versteht, worum es sich dreht, wenn man sich offenen Herzens auf diese Lieder einlässt. Es hilft natürlich, dass Naxos dankenswerterweise die Texte in englischer und deutscher Übersetzung im Booklet und Online zur Verfügung stellt.
Frau Gritskova und Frau Prinz: Sergej Prokofjew ist einer der bekanntesten russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Als Komponist von Liedern ist er aber zumindest in Mitteleuropa kaum bekannt. Ist denn auch in Russland eine Vernachlässigung der Prokofjew-Lieder feststellbar oder ist das vor allem ein außerrussisches Phänomen und dann vielleicht vor allem der Sprachbarriere geschuldet? Das Lied hat im Schaffen Prokofjews keine zentrale Rolle, obwohl gerade in diesem Genre manch fantastische Juwelen zu finden sind und Prokofjew durch die Arbeit an dieser Gattung an den lyrischen Qualitäten seiner Kompositionstechnik feilen konnte. Auch in Russland werden die Lieder nicht so oft aufgeführt, wie Klavier- oder Orchesterwerke von Prokofjew oder Lieder der russischen „Klassiker“ – Tschaikowski und Rachmaninow. Fast unbekannt sind diese Lieder außerhalb Russlands, sicher auch wegen der Sprachbarriere. Aber die Musik gibt so genau den Sinn der Poesie wieder, emotional und inhaltlich, dass man sehr wohl spürt und versteht, worum es sich dreht, wenn man sich offenen Herzens auf diese Lieder einlässt. Es hilft natürlich, dass Naxos dankenswerterweise die Texte in englischer und deutscher Übersetzung im Booklet und Online zur Verfügung stellt.

Margarita Gritskova & Maria Prinz/ Foto Michael Poehn
Frau Gritskova: Sie sind auch als Opernsängerin tätig. Haben Sie „Ihren“ von den Opern gewohnten Prokofjew in seinen Liedern gleich wiedererkannt oder mussten Sie sich erst einmal eingewöhnen? Und wie ist es auf Ihrer Seite überhaupt zu dem Plan gekommen, diese eher selten eingespielten Lieder für Naxos aufzunehmen? Die musikalische Sprache Prokofjews ist in allen seiner Werke unverwechselbar und sofort wiedererkennbar, aber bei den Liedern malt sein Pinsel noch feiner und genauer, und man muss sich als Interpret um die Nuance und Farbe jeder auch noch so kurzen Phrase bemühen.
Die Idee mit Naxos zusammenzuarbeiten, kam von der Pianistin Maria Prinz, die schon mit dem Flötisten Patrick Gallois und mit der wunderbaren Sängerin Krassimira Stoyanova für Naxos aufgenommen hatte und von der Arbeit mit diesem Label begeistert war. Unsere erste Produktion begann mit eher traditionellem Repertoire – Tschaikowsky, Rimsky-Korsakow und Rachmaninow (Russian Songs, Naxos 8.573908). Wir sind dem Label sehr dankbar, dass wir jetzt die Chance bekommen haben, selten gespieltes Repertoire, eben Prokofjew und als Nächstes Schostakowitsch (Veröffentlichung geplant für Oktober 2020) aufzunehmen. Dieses Repertoire liegt uns besonders am Herzen und eröffnet uns noch mehr die Möglichkeit, interpretatorisch eigene Wege zu gehen.
Frau Prinz, es fällt auf, dass Prokofjew viele der Lieder auf dem Album komponierte, nachdem er große, opulente Opernprojekte vollendet hatte. In diesem Zusammenhang verblüffte zumindest mich die anscheinend häufig auf das allerwesentlichste reduzierte Klavierbegleitung der ausgewählten Lieder, die aber gerade dadurch eine sehr eindringliche Wirkung entfalten. Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für Sie als Pianistin? Die Klavierbegleitung ist zwar in vielen Fällen lakonisch, dafür aber harmonisch sehr kompliziert und, wie allgemein beim Klaviersatz bei Prokofjew grifftechnisch weit angelegt und alles andere als bequem. Der Komponist war selber ein fantastischer Pianist mit großen Händen.
Eine ganz wichtige Rolle spielt die Klavierbegleitung beim Kreieren der Atmosphäre und beim Kommentieren des Unausgesprochenen im Text. Wie immer beim Musizieren mit Sängern sehe ich meine Aufgabe auch darin, mich von der Klangfarbe der Stimme inspirieren zu lassen und dann mit eigenen Farben und Akzenten die erzählte Geschichte abzurunden, zu kommentieren, weiterzuerzählen oder sogar zu hinterfragen. Es kommt mir dabei zugute, dass ich Russisch spreche, weil ich den Text im Original wirklich in allen Nuancen verstehen kann.

Margarita Gritskova & Maria Prinz/ Foto Michael Poehn
Frau Prinz: Nun ist gerade der frühe Prokofjew insbesondere durch seine ersten drei Klavierkonzerte beim breiten Publikum als ein sehr brillanter, virtuoser Klavierkomponist bekannt. Nun lernt man ihn in diesen Liedern von einer ganz anderen Seite kennen. Ist dieser betont lyrische Blickwinkel denn repräsentativ für den Liedkomponisten Prokofjew oder gibt es auch im Liedfach den brillanten, virtuosen Prokofjew, den wir auf diesem Album wegen der gewählten Themenstellung nur nicht zu hören bekommen? Wie Frau Gritskova bereits erwähnt hat, und wie Wilhelm Sinkovicz in seinem Beitrag im Booklet betont, lernt man durch die Lieder den Melodiker Prokofjew kennen. Das ist durchaus für sein gesamtes Liedschaffen charakteristisch. Wobei immer wieder sehr virtuose Passagen (wie z.B im „Hässlichen Entlein“ oder in „Grüß Dich“, das vierte von den fünf Liedern nach Texten von Achmatova op.27, „Das graue Kleidchen“ op.23 oder „Denke an mich“ op.36 Nr.4) vorkommen und an die Brillanz und Urkraft seiner Klavierwerke denken lassen.
Als ich mir das Album angehört habe, hatte ich den Eindruck, dass Prokofjew schon sehr früh einen individuellen Lied-Stil verfolgt hat, der sich kaum in Reverenzen auf z.B. die sehr einflussreiche deutsche Liedtradition bemerkbar macht. Doch vermeint man bereits Anklänge an die französische Liedtradition zu vernehmen – Liegt darin etwa schon eine gedankliche Annäherung des Komponisten an das wenig später angetretene Exil in Paris? Einen französischen Einfluss kann man sehr wohl orten, z.B. im impressionistisch anmutenden Lied „Vertraue mir“ op.23 Nr.3, in manchen der Lieder nach Texten von Achmatova oder in „Denke an mich!“. Das mag nicht nur an der Tatsache liegen, dass es ihn nach Paris gezogen hat, sondern vielleicht auch im Charakter des Komponisten, dem Eleganz, Leichtigkeit und eine gewisse Distanziertheit immer wichtig waren.

Margarita Gritskova & Maria Prinz/ Foto Michael Poehn
Der späte Prokofjew wird auf dem Album mit Liedern für Kinder, Volkslied-Bearbeitungen und Liedversionen von Arien aus Oratorien gewürdigt. Das erscheint zum Teil etwas brav im Vergleich zu den emotional aufgeladenen frühen Liedern. Hat es das Liedfach mit seiner Verknüpfung von Text und Musik dem Komponisten zunehmend schwergemacht in einer Zeit, in der Stalins „Kulturpolitik“ eine ideelle Gleichschaltung im Sinn hatte? Genauso ist es! Wie wir wissen, ist Prokofjew freiwillig und vermutlich etwas blauäugig im Jahr 1936 in die Sowjetunion zurückgekehrt und starb am 5.3.1953, am selben Tag wie Stalin.
Einen Einschnitt im Verhältnis der Macht dem kompositorischen Schaffen, nicht nur von Prokofjew, sondern auch von Schostakowitsch gegenüber, bildet die Resolution des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei vom 10.2.1948 gegen „bürgerliche Dekadenz und Modernismus“, der jahrelange Angriffe gegen Formalisten, Reaktionäre (unter ihnen auch Anna Achmatova) vorausgegangen waren und die alles, was nicht volksnah, einfach gestrickt und ideologisch konform war, gebrandmarkt hat und die Komponisten zu „Volksfeinden“ ernannt hat. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Prokofjew, der sich übrigens nie durch Exponieren als Widersacher der Macht ausgezeichnet hat, sich diesem Trend – zumindest in einem Genre, das nicht zu den repräsentativsten seines Schaffens gehört – wohl gebeugt hat.
Trotzdem ist der Inhalt mancher Lieder durchaus scharf ironisierend zu verstehen, wie z.B. in „Anjutka“. Im Text heißt es, dass jede Putzfrau, wenn sie sich nur bildet und genug Bücher liest, auch das Land regieren könnte. Diese Ironie findet ihren Ausdruck auch in der Musik dieses Liedes.
Ihr beider nächstes Projekt wird ein Schostakowitsch-Liedalbum werden. Wenn Sie die Liedkompositionen der beiden vergleichen, Prokofjew und Schostakowitsch: Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede? Wie wir wissen sind Schostakowitsch und Prokofjew Zeitgenossen, obwohl Schostakowitsch Prokofjew um mehr als 20 Jahre überlebt hat und dadurch in seiner letzten Schaffensperiode einer ganz anderen Wirklichkeit gegenüberstand. Trotzdem könnten beide vom Wesen, von ihrer Einstellung zum Leben und zur Kunst her, nicht unterschiedlicher sein. Ohne Zweifel ist Schostakowitsch der „russischere“, der introvertiertere, der verletzlichere von beiden gewesen. Und das hat sich auch in seinem Liedschaffen manifestiert. Wie in allen Belangen, hat sich Schostakowitsch mit einer missionarischen Ernsthaftigkeit und Hingabe auch mit der Gattung Lied beschäftigt und sich ganz bewusst von verschiedenen Kulturkreisen inspirieren lassen. Davon zeugen seine Zyklen „Griechische Lieder“, „Spanische Lieder“ und „Jüdische Lieder“. Der Stil ist bei beiden Komponisten unverwechselbar individuell, originell und zeitgemäß auf unterschiedliche Art und Weise. Beide verbindet die Auswahl wertvoller avantgardistischer Poesie (bei Prokofjew z.B. von Anna Achmatova, bei Schostakowitsch von Marina Tswetajewa) und auch ein gewisser Hang zu Ironie und Satire, die sich aber bei beiden in verschiedener Gestalt offenbaren.
 Abschließend noch ein Wort zur aktuellen Lage des Kulturbetriebs: Sie, Frau Gritskova, haben vor wenigen Wochen an der Operngala der deutschen AIDS-Stiftung teilgenommen, die aufgrund der Coronabeschränkungen zum digitalen Event umgeformt wurde und zu der die beteiligten Künstlerinnen und Künstler Beiträge in Form kleiner Heim-Konzerte sozusagen aus dem heimischen Wohnzimmer beigetragen haben. Wie haben Sie diese ungewöhnliche Situation erlebt? Es ist natürlich für mich genauso schwer und traurig, wie für alle Kolleginnen und Kollegen. Der Lockdown ist kurz vor der Wiederaufnahme von „Tri sestri“ von Peter Eötvös an der Wiener Staatsoper gekommen, auf die ich mich so gefreut hatte. Das Gala-Konzert des jungen Ensembles der Wiener Staatsoper zum Abschied der Ära von Dominique Meyer und auch mein Rollendebut als Preziosilla in „Macht des Schicksals“ beim Opernfestival in Klosterneuburg sind Corona zum Opfer gefallen.
Abschließend noch ein Wort zur aktuellen Lage des Kulturbetriebs: Sie, Frau Gritskova, haben vor wenigen Wochen an der Operngala der deutschen AIDS-Stiftung teilgenommen, die aufgrund der Coronabeschränkungen zum digitalen Event umgeformt wurde und zu der die beteiligten Künstlerinnen und Künstler Beiträge in Form kleiner Heim-Konzerte sozusagen aus dem heimischen Wohnzimmer beigetragen haben. Wie haben Sie diese ungewöhnliche Situation erlebt? Es ist natürlich für mich genauso schwer und traurig, wie für alle Kolleginnen und Kollegen. Der Lockdown ist kurz vor der Wiederaufnahme von „Tri sestri“ von Peter Eötvös an der Wiener Staatsoper gekommen, auf die ich mich so gefreut hatte. Das Gala-Konzert des jungen Ensembles der Wiener Staatsoper zum Abschied der Ära von Dominique Meyer und auch mein Rollendebut als Preziosilla in „Macht des Schicksals“ beim Opernfestival in Klosterneuburg sind Corona zum Opfer gefallen.
Größere Veranstaltungen zur Präsentation unserer Prokofjew CD sind nun nicht möglich, umso mehr freuen wir uns, dass die österreichische Opernzeitschrift „Der neue Merker“ uns die Gelegenheit bietet, das Album im kleinen Rahmen der „Merker-Galerie“ mit wenigstens einem kleinen Live-Konzert vorzustellen.
Jetzt sind alle Hoffnungen auf den Herbst gerichtet und darauf, wie die Operntheater und die Konzertveranstalter mit kreativen Lösungen einen beinahe normalen Betrieb ermöglichen.
Wir brauchen die Bühne, wir brauchen unser Publikum und können es kaum erwarten unseren Beruf wieder ausüben zu dürfen und unsere Berufung im Dienst der Kunst auszuleben! René Brinkmann
(Margarita Gritskova & Maria Prinz/ alle FotoS Michael Poehn. Weitere Information zu den CDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de.)



 Frau Gritskova und Frau Prinz: Sergej Prokofjew ist einer der bekanntesten russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Als Komponist von Liedern ist er aber zumindest in Mitteleuropa kaum bekannt. Ist denn auch in Russland eine Vernachlässigung der Prokofjew-Lieder feststellbar oder ist das vor allem ein außerrussisches Phänomen und dann vielleicht vor allem der Sprachbarriere geschuldet?
Frau Gritskova und Frau Prinz: Sergej Prokofjew ist einer der bekanntesten russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Als Komponist von Liedern ist er aber zumindest in Mitteleuropa kaum bekannt. Ist denn auch in Russland eine Vernachlässigung der Prokofjew-Lieder feststellbar oder ist das vor allem ein außerrussisches Phänomen und dann vielleicht vor allem der Sprachbarriere geschuldet? 


 Abschließend noch ein Wort zur aktuellen Lage des Kulturbetriebs: Sie, Frau Gritskova, haben vor wenigen Wochen an der Operngala der deutschen AIDS-Stiftung teilgenommen, die aufgrund der Coronabeschränkungen zum digitalen Event umgeformt wurde und zu der die beteiligten Künstlerinnen und Künstler Beiträge in Form kleiner Heim-Konzerte sozusagen aus dem heimischen Wohnzimmer beigetragen haben. Wie haben Sie diese ungewöhnliche Situation erlebt?
Abschließend noch ein Wort zur aktuellen Lage des Kulturbetriebs: Sie, Frau Gritskova, haben vor wenigen Wochen an der Operngala der deutschen AIDS-Stiftung teilgenommen, die aufgrund der Coronabeschränkungen zum digitalen Event umgeformt wurde und zu der die beteiligten Künstlerinnen und Künstler Beiträge in Form kleiner Heim-Konzerte sozusagen aus dem heimischen Wohnzimmer beigetragen haben. Wie haben Sie diese ungewöhnliche Situation erlebt? 







 In der Besetzung finden sich zwei Countertenöre, die auch beim Artaserse mitgewirkt hatten – der Ukrainer
In der Besetzung finden sich zwei Countertenöre, die auch beim Artaserse mitgewirkt hatten – der Ukrainer 

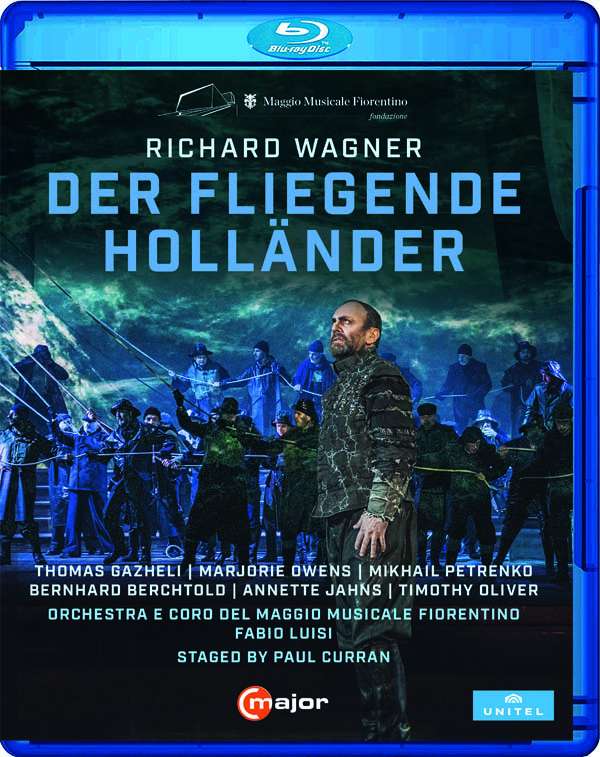


 Sechs Jahre später, im Dezember 2018, keine rätselhaften Zeichen, Symbole, verschlungenen Nebenhandlungen und irritierenden Bilder. Eine schlichte Black Box auf der Bühne des Göteborger Konserthuset ist die Kiste allen Übels mittels derer
Sechs Jahre später, im Dezember 2018, keine rätselhaften Zeichen, Symbole, verschlungenen Nebenhandlungen und irritierenden Bilder. Eine schlichte Black Box auf der Bühne des Göteborger Konserthuset ist die Kiste allen Übels mittels derer