.
2018 jährte sich der Geburtstag von Charles Gounod, der am 17. Juni 1818 in Paris geboren wurde, zum 200. Mal – Grund für den bei uns so reichlich zitierten Palazetto Bru Zane, 2018 drei seiner Opern zu initiieren und auf CD mitschneiden zu lassen: in München Le tribut de Zamora, in Paris Faust in der Erstversion als Opéra comique/mit Dialogen und La Nonne Sanglante (die es ja bereits in Osnabrück bei cpo gibt). Daneben viele Abende mit Symphonischem, Opernarien und anderem von Gounod.
–
Einige Fakten vorab. Le Tribut de Zamora, Grand Opéra in vier Akten von Charles Gounod ; Libretto von Adolphe D’Ennery und Jules Brésil, Entstehung des Werks:1878–1880; Uraufführung: 1. April 1881 an der Opéra (Palais Garnier) in Paris vermutlich in der zweiten Fassung des Werks, die auch im Konzert auf Bayern 3 zu hören war; Lebensdaten des Komponisten: 17. Juni 1818 in Paris – 18. Oktober 1893 in Saint-Cloud (westlich von Paris).
.

„Le Tribut“ de Zamora“: Szene zur Uraufführung von Pierre-Auguste Lamy/ BNF. fr. Gallica
Also wieder eine Ko-Operation zwischen dem Palazetto Bru Zane und dem Münchner Rundfunkorchester: Gounods Oper Le tribut de Zamora (am 28. Januar 2018 in Münchner Prinzregententheater. Florian Heurich schreibt im nachstehenden Artikel über die Oper und die Umstände ihrer Aufführung in Paris 1881. Dank dafür an den Autor und das Münchner Rundfunkorchester. Dieses nun veranstaltete die konzertante Aufführung der exotischen Oper Le Tribut de Zamora, nun auf CD festgehalten für die Kollektion der «Opéra francais» des Palazetto Bru Zane (PZ 1033) mit Herve Niquet am Pult.
.
.
Stefan Lauter zum musikalischen Eindruck: Hervé Niquet sorgt für eine sinnlich- schwungvolle Wiedergabe, mit schönen Momenten bei den Bläsern und Piccoloflöten, die für die orientalische Stimmung sorgten, wenngleich Gounods Einfälle da doch recht bemüht wirkten. Sklavenmarkt und Serail waren geradezu pflichtschuldig „exotisch“ instrumentiert. Was da im dritten Akt an Hüftschwung abgeht, ist mildes Wabern – und wie an vielen anderen Momenten der Oper auch recht Massenet-nahe. Da hatte ich mehr „Exotismus“ erwartet, der im Wesentlichen durch die Piccolo-Flöten bedient wird. Der Chor des Bayerischen Rundfunks gibt wortverständlich und kraftvoll die Folie für das Geschehen im fernen historischen Spanien, wo der Maurenfürst Ben-Said die schöne christliche Xaima (eine der Jungfrauen als Tribut an die muslimischen Herscher in Folge der Niederlage bei Zamora) begehrt, entführt und an ihrer Standhaftigkeit zerbricht.

Gounods „Tribut de Zamora“ bei Ediciones Songolares
Die Palme des Abends geht zweifellos an Tassis Christoyannis in dieser Partie, die er mit wunderbar geführter, leichterer Bass-Stimme ausfüllt, sonor und unangefochten in den hohen Lagen und von großer Klangschönheit. Sein großes Solo im dritten Akt lässt nicht nur die Umworbene dahinschmelzen, und seine etwas körnige Stimme (die mich an den von mir verehrten José van Dam erinnert) bleibt lange im Ohr. Ein bedeutender Sänger, der manches eher funktionale Rezitativ adelt. Judith Van Wanroij als die begehrte Xaima hat wie ihr Tenorpartner Edgaras Montvidas (als ihr christlicher Geliebter Manoel) 2018 – im Gegensatz zu Salieris Horaces von 2016 – bereits an Schönheit der Stimme eingebüßt. In beiden Fällen merkt man den Raubbau durch zu große Partien, die die Stimmen sehr unruhig und faserig-weitschwingend haben werden lassen. Sicher: Sopran wie Tenor schaffen ihre anspruchsvollen Rollen fast ohne Mühe (er kam an seine Grenzen in den geforderten Höhen), und vor allem Judith Wanroij gibt alles für den effektvollen Schluss, aber die Stimme wirkt säuerlich und zu dunkel, wenngleich der Einsatz zu loben ist. Aber die Wortverständlichkeit bleibt auf der Strecke. Die wichtige Rolle der wahnsinnigen Mutter Hermosa ging an Jennifer Holloway, die dasselbe Problem aufweist: tapfer und furchlos auf den Höhen, in der Krauss-Partie der Hermosa mehr Sopran als Mezzo, aber unter Druck eben auch sehr unruhig und extrem verwaschen in der geforderten Diktion, da fallen mir doch zwei oder drei franzöische Kolleginnen ein, die das besser gemacht hätten. Zumal für die CD und das Nur-Hören die Stimmen einenander zu ähnlich sind. Beide haben am Ende vom dritten Akt ein fulminantes Mutter-Tochter-Solo (das Freiheitslied des ersten Aktes nochmals reichlich ausgequetscht), in dem ihre beiden Stimmen recht uncharmant und scharf, aber eben furchtlos Eindruck machen – zu charaktervoll vielleicht. Die Diktion und eine gewissen Schönheit der Stimmen bleiben auf der Strecke. Beeindruckend die Nebenrollen. Juliette Mars bezaubert als Iglesias, ein weiteres Tribut-Opfer. Boris Pinkhasovich gibt einen vollmundigen, sonoren, erotischen Ben-Said-Bruder Hadjar, Artavazd Sargsyan strahlt als Alcalde und Kadi. Dazu kommt sehr angenehm Jeröme Boutillier als König/Soldat. Man kann nur staunen, wie gut diese kleineren Partien besetzt waren. Gounods letzte Oper nimmt vor allem ab Akt 3 Fahrt auf: Der Schluss sowie das erwähnte Ben-Said-Solo und das herrliche Duett zuvor stehen den renommierten und bekannteren Opern Gounods in nichts nach.
Ein wirklich aufregender, im Ganzen hervorragend gesungener Abend und eine tolle CD, die als bewährtes Buch nun vom Palazetto Bru Zane mit leider nur englischsprachigen Aufsätzen zur Bildung beiträgt. Als deutscher Käufer ärgere ich mich einmal mehr, dass es nicht einmal eine deutsche Inhaltsangabe gibt, das wäre das Mindeste für den größten Anteil am europäischen Markt. und man kann auch verlangen, eine deutsche Beilage zu finden! Ärgerlich (Gounod: Le tribut de Zamaora, 2 CD PZ 1033) ! S. L.
.
.

„Le Tribut de Zamora“: Gabrielle Krauss und Jean Lazare als Hermosa und Ben-Said/ Foto nach der Uraufführung 1881/ Bialistock/ opera mania
Florian Heurich: Von Mauren und Christen – zu Charles Gounods Historiendrama Le tribut de Zamora. Zu einer Zeit, als Primadonnentum und die Capricen eitler Gesangsstars schon aus der Mode waren und das Musiktheater längst auf die perfekte Illusion im Sinne des Wagner’schen Gesamtkunstwerks abzielte, ereignete sich bei der Uraufführung von Le tribut de Zamora am 1. April 1881 in der Pariser Opéra Ungewöhnliches: Als das Publikum nach einer leidenschaftlich patriotischen Szene in tosenden Applaus ausbrach, erhob sich Gabrielle Krauss, die Sängerin der Hermosa, kurzerhand vom Boden, nachdem sie gerade voller Erschöpfung zusammengebrochen war, und streckte Charles Gounod die Hand entgegen. Gounod dirigierte die Uraufführung seiner Oper selbst, wie es seinerzeit Usus war, unmittelbar hinter dem Souffleurkasten, das Gesicht zu den Sängern, das Orchester im Rücken, und erwiderte die Geste seiner Solistin bereitwillig. Das Publikum reagierte amüsiert, die Presse kritisierte diesen Vorfall als deplatziert, zumal in einem durch Handlung, Musiksprache und Inszenierung schon fast naturalistisch anmutenden Werk.
Gerade der Naturalismus des zur Zeit der Maurenherrschaft in Spanien angesiedelten Sujets war ungewöhnlich für Gounod, der zuvor mit Opern wie La nonne sanglante, Faust, Roméo et Juliette, La reine de Saba oder Polyeucte eine Vorliebe für teils fantastische, teils ins Metaphysische reichende Stoffe gezeigt hatte. Mit Le tribut de Zamora, seiner letzten Oper, konnte er schließlich nach dem Misserfolg von Polyeucte drei Jahre zuvor am selben Ort nun noch einmal sein Gespür für melodienreichen Lyrismus und theaterwirksame Dramatik demonstrieren; zum lang anhaltenden Triumph wurde jedoch auch dieses Werk nicht, sodass Gounod danach das Opernschreiben ad acta legte. Nach nur zwei Saisons und 47 Aufführungen verschwand Le tribut de Zamora wieder vom Spielplan. Drei weitere Aufführungen folgten 1885, was Gounod und seinen Librettisten Adolphe d’Ennery und Jules Brésil immerhin von ihrem Verleger Choudens eine vertraglich zugesicherte Extrazahlung nach der fünfzigsten Aufführung einbrachte; danach geriet die Oper jedoch endgültig in Vergessenheit.
Schon der Entstehungsprozess, die Verhandlungen mit der Pariser Opéra und die Retuschen und Anpassungen an der Partitur zogen sich länger hin, als ursprünglich geplant, was Gounod den Abschied von der Oper leicht machte. „Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass ich nach diesem Werk absolut im Guten dem Theater adieu sagen werde“, so bekannte er seinen Kindern gegenüber.

„Le Tribut de Zamora“: Gabrielle Krauss und Josephine Daram als Hermosa und Xaima/ Foto nach der Uraufführung 1881 im Palais Garnier/ Bialistock/ opera mania
Die Pariser Presse der Zeit war voller Lob für Gounods Oper; die aufwendige Inszenierung mit ihren prunkvollen Kostümen, durch die ein pittoreskes, christlich-maurisches Spanien im Mittelalter heraufbeschworen wurde, fand großen Anklang; auch die Interpreten bekamen meist gute Kritiken, allen voran Gabrielle Krauss als Hermosa, die als „ebenso bewundernswerte Tragödin wie großartige Sängerin“ gepriesen wurde und ihre zwischen Wahnsinn und glühendem Patriotismus changierende Rolle zum Zentrum der Aufführung machte. Publikum und Kritiker ließen sich aber kurioserweise nicht nur über die musikdramatischen Qualitäten der Partitur und die Stimmkünste der Sänger aus, sondern auch über die korrekte Form der Berberhelme, die Reitkünste des Baritons Jean-Louis Lasalle als arabischer Gesandter Ben-Saïd oder die Choreografie eines Defilees von hundert Jungfrauen. Dies zeugt freilich gerade von dem detailgetreuen Realismus, der erwartet wurde und den Le tribut de Zamora szenisch und musikalisch größtenteils auch erfüllte.
„Gounods Partitur ist klar, durchsichtig, melodiös und von großer stilistischer Einheit; sie enthält reizende Stücke voller Anmut und Gefühl wie das exquisite Morgenständchen des ersten Akts oder die bewegende Phrase der Iglésia; die expressiven Couplets des Ben-Saïd; daneben Stücke von außerordentlicher Kraft wie das Finale des ersten Aktes mit seiner lebhaften Szenerie; jenes des zweiten Aktes mit seinem grandiosen Charakter und seiner wunderbaren Klanglichkeit; und vor all dem das dramatische Duett der beiden Frauen im dritten Akt, das Wellen der Begeisterung hervorrief.“ Damit hob die Zeitung La liberté bereits die zentralen Nummern in Gounods Oper hervor.
Der Schauplatz von Le tribut de Zamora im Spanien des Mittelalters, wo christliche und maurische Kultur aufeinandertreffen, legt ein orientalisches Lokalkolorit nahe. Dieses schlägt sich jedoch weit mehr auf der szenischen als auf der musikalischen Seite nieder. Während der erste Akt noch im christlichen Milieu Oviedos spielt, fährt schon die Bühnenanweisung für den zweiten Akt alles auf, was für die szenische Erschaffung eines schillernden Orients nötig ist: „Pittoreske Gegend, Ufer des Guadalquivir bei Córdoba. Befestigte Brücke, durch einen hohen viereckigen Turm verteidigt. Auf der anderen Seite des Flusses Córdoba mit zahlreichen Minaretten. Im Hintergrund eine blaue Bergkette. Vorne rechts der Eingang zu einem Bazar.“ Weitere Schauplätze der Oper sind ein Harem und ein maurischer Garten. Dezenter Orientalismus findet sich in Gounods Partitur jedoch allenfalls in einem Tanz der Mauren im zweiten Akt, in der einer alten arabischen Gedichtform nachempfundenen Kasside Hadjars, in der Chorszene der Haremsdamen am Beginn des dritten Akts und im sich anschließenden Ballett mit seinen verschiedenen Nationaltänzen – spanisch, arabisch, italienisch, griechisch. Schon ein Kritiker der Uraufführung stellte den szenischen Exotismus über den musikalischen: „[…] die Couleur locale, die in der Partitur und im Text fehlt, entfaltet sich hingegen aufs Großartigste im Bühnenbild und in den Kostümen. Das ganze ritterliche und muslimische Spanien des 9. Jahrhunderts entsteht komplett neu in diesen vier Bildern mit ihrem grandiosen und fremdländischen Pomp.“

„Le Tribut de Zamora“: Szene aus der Uraufführung im Journal „Le Théâtre IIlulstré“ von Marie Adrien/ BNF France/ Gallica
Auch die Handlung gründet sich auf das Aufeinandertreffen von zwei Kulturen: Die beiden Spanier Manoël und Xaïma sollen heiraten, jedoch auch der arabische Edelmann Ben-Saïd begehrt Xaïma. Sie wird mit anderen Frauen nach Córdoba, seinerzeit das Zentrum des Reiches von Al-Andalus, gebracht und als Sklavin verkauft. Damit soll der jährliche Tribut gezahlt werden, den die Mauren von den Spaniern fordern, nachdem sie zwanzig Jahre zuvor die Stadt Zamora erobert hatten. Ben-Saïd kauft Xaïma und will sie für sich gewinnen, muss jedoch am Ende mit dem Leben für seine Leidenschaften bezahlen. Außerdem stellt sich in dieser Handlung voller Irrungen und Wirrungen des Schicksals heraus, dass der Tenorheld Manoël den Bruder des tyrannischen Mauren einst auf dem Schlachtfeld gerettet hat, worauf sich dieser nun im Kampf um Xaïma auf dessen Seite schlägt.
Als besonderen Kunstgriff lassen Gounod und seine Librettisten durch diese Dreiecksgeschichte noch die Wahnsinnige Hermosa irrlichtern, die sich schließlich als Xaïmas Mutter entpuppt und am Ende Ben-Saïd tötet – einerseits, um ihre Tochter zu schützen, andererseits, um Rache zu üben für die Grausamkeit, mit der einst ihre Heimatstadt Zamora niedergemetzelt wurde. Durch den Mord am maurischen Machthaber mischen sich privates Schicksal und das Schicksal eines ganzen Volkes.
Hermosa ist die zentrale Figur der Oper. Ihr Wahnsinn entbindet sie nicht nur aller Schuld und lässt sie in ihrem, wie Le Figaro es beschrieb, „golden bestickten Kaftan aus violetter Seide“ fast als Heilige erscheinen, sondern bietet dem Komponisten auch dankbare Möglichkeiten für musikdramatisch effektvolle Szenen: etwa ihre als eine Art Wahnsinnsszene gestaltete Auftrittsarie im zweiten Akt mit einem ariosen ersten Teil, in dem sie sich als „pauvre hirondelle“, als „arme Schwalbe“, wähnt, sowie einer lyrischen rezitativischen Passage und einer abschließenden Stretta. Gerade der letzte Abschnitt ist seinerzeit mit Agathes Arie aus dem Freischütz verglichen worden, und ein träumerischer romantischer Gestus liegt tatsächlich über dieser Nummer. Ganz im Gegensatz dazu steht der große patriotische Ausbruch Hermosas „Debout! Enfants de l’Ibérie“ („Auf! Ihr Kinder Spaniens“) im Duett mit Xaïma am Ende des dritten Akts. Hier wird die spanische Hymne des ersten Aktfinales wieder aufgegriffen, nachdem Hermosa in einer dramatischen Szene die schrecklichen Ereignisse der Schlacht von Zamora heraufbeschworen hat. Auch dieses Duett endet in einer Stretta, die schon fast italienisch anmutet und an die großen Frauenduette bei Bellini und Donizetti erinnert.

„Le Tribut de Zamora“: zeitgenössische Illustration zur Oper/ BNF France/ Gallica
Herausragende lyrische Szenen der Partitur sind des Weiteren die Duette der beiden Liebenden Manoël und Xaïma im ersten und vierten Akt sowie die Solonummern von Ben-Saïd im dritten und Manoël im vierten Akt. Großen Effekt erzielt auch das Terzett der drei Männer Manoël, Ben-Saïd und Hadjar im dritten Akt, das schließlich in eine vom Chor begleitete Duellszene übergeht. Überhaupt entfaltet Gounod in Le tribut de Zamora neben dem Lyrismus der Solonummern auch große Tableaus wie das breit angelegte Finale des ersten Akts. Hier schälen sich aus dem kollektiven Gesang mit seinen Einschüben einer spanischen Nationalhymne immer wieder bewegende Einzelepisoden heraus: etwa die Phrasen der Iglésia, einer der Jungfrauen, die den Mauren als Tribut gezahlt werden müssen. Mit solchen Massenszenen, wie beispielsweise auch dem Einzug der Jungfrauen und deren Versteigerung im zweiten Akt, greift Gounod Elemente der Grand Opéra auf, deren Blütezeit mit den paradigmatischen Werken Meyerbeers jedoch schon fast fünfzig Jahre zurückliegt. Der realhistorische Hintergrund, die Schlacht von Zamora im Jahr 939 (die Gounod und seine Librettisten jedoch aller geschichtlichen Genauigkeit zum Trotz schon rund ein Jahrhundert früher stattfinden lassen) und das gesamte Panorama des Reichs von Al-Andalus, also des von den Mauren eroberten Teils Spaniens, vor dem eine erfundene private Liebesgeschichte erzählt wird, ist auch das typische dramaturgische Muster der Grand Opéra. Auch wenn diese Opernform 1881 – zu einer Zeit, als das Wagner’sche Musikdrama die europäischen Bühnen beherrschte und sich ein szenischer Realismus nach und nach durchsetzte – schon etwas aus der Mode gekommen war, lässt Gounod mit Le tribut de Zamora noch einmal die große romantische französische Oper aufleben; und er verwendet dabei eine Musiksprache, der schon seine Zeitgenossen eine gewisse Italianità attestierten: „Wenn Monsieur Gounod Le tribut de Zamora in der Absicht geschrieben hat, jegliche Verbindung mit Wagner zu leugnen, so hat er gut daran getan. Er hat zweifellos einen Schritt getan, um sich von der deutschen Schule zu entfernen und um sich der italienischen Schule anzunähern, ja um von jener mit voller Absicht Entlehnungen zu nehmen.“
In diesem Sinne stellt diese letzte Oper Gounods eine Synthese vieler musikalischer Tendenzen der Zeit dar: eine große Oper alter Schule und zugleich ein kleiner Schritt in die Zukunft des Musiktheaters. Diesen Weg wird der mittlerweile zum Monument des französischen Theaters gewordene Komponist jedoch nicht weitergehen.

„Le Tribut de Zamora“: der Tenor Henri Sellier sang den Manoel/ Foto nach der Uraufführung/ Bialistock/ opera mania
Ein ein Wort zu Al-Andalus: Zentrum der Künste und romantisches Sehnsuchtsland. Als im Jahr 711 die Mauren auf die iberische Halbinsel kamen, begann die mehr als siebenhundert Jahre dauernde Zeit von Al-Andalus. Dieses muslimische Reich mit der Stadt Córdoba als Zentrum erstreckte sich über den größten Teil des heutigen Spaniens und Portugals. Lediglich die Gegend im äußersten Norden blieb unter christlicher Herrschaft. Trotz verschiedener kämpferischer Auseinandersetzungen zwischen Christen und Arabern, darunter die Schlacht von Zamora im Jahr 939, waren die Jahrhunderte von Al-Andalus größtenteils eine Epoche des friedlichen Zusammenlebens der Kulturen und Religionen, in welcher Kunst, Musik und Dichtung florierten.
Mit der Reconquista, der Rückeroberung Spaniens 1492 durch die katholischen Könige Fernando II. von Aragón und Isabel I. von Kastilien endete die Herrschaft der Mauren auf der iberischen Halbinsel. Später wurde die Zeit von Al-Andalus von Literaten und Künstlern als Zeit der harmonischen kulturellen Mischung voller exotischer Fremdartigkeit verklärt, in Spanien etwa von dem romantischen Dichter José Zorrilla, der in seiner Lyrik die maurische Zeit wieder aufleben ließ, oder später von Federico García Lorca, der in Al-Andalus den Ursprung sämtlicher spanischer Kultur sah. In Deutschland bedichtete Clemens von Brentano die Alhambra von Granada als romantischen Sehnsuchtsort, und in Frankreich waren es Jean-Pierre Claris de Florian mit seinem historisch-epischen Roman Gonzalve de Cordoue (Gonzalo von Córdoba) oder François-René de Chateaubriand mit seiner Novelle Les aventures du dernier Abencérage (Die Abenteuer des letzten Abencerragen), die das maurische Spanien für Kunst und Literatur entdeckten.
Im Bereich der Oper bedienten sich etwa Luigi Cherubini mit Les Abencérages, Gaetano Donizetti mit Zoraida di Granata und Alahor in Granata oder Giacomo Meyerbeer mit L’esule di Granata dieser Thematik – meist Geschichten über die unmögliche Liebe zwischen einem Mauren und einer Christin oder über die im Sinne europäischer Moralvorstellungen rechtmäßige Beziehung zwischen zwei Christen, in die ein maurischer Nebenbuhler eindringt. Genau dieses Handlungsmuster greifen auch Gounod und seine Librettisten in Le tribut de Zamora auf. Florian Heurich
.
Den vorstehenden Artikel entnahmen wir dem Programmheft des Münchner Rundfunkorchesters. Besonderen Dank geht an den Autor Florian Heurich wie auch an Doris Sennefelder vom Münchner Rundfunkorchester für die liebenswürdige Genehmigung zur „Übernahme“ des Textes!
.
.
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.


 Mitte der sechziger Jahre beendete sie ihre Gesangslaufbahn, trat aber u.a. noch 1968 als Schauspielerin am Münchner Volkstheater auf. Zuletzt lebte Herta Talmar in Salzburg, wo sie am 24. Juni 2010 wenige Tage vor ihrem 90. Geburtstag starb.
Mitte der sechziger Jahre beendete sie ihre Gesangslaufbahn, trat aber u.a. noch 1968 als Schauspielerin am Münchner Volkstheater auf. Zuletzt lebte Herta Talmar in Salzburg, wo sie am 24. Juni 2010 wenige Tage vor ihrem 90. Geburtstag starb. Benes: Auf der grünen Wiese (mit Franz Fehringer, Rita Bartos)/ Dostal: Die ungarische Hochzeit (mit Franz Fehringer, Anny Schlemm)/ Fall: Die Dollarprinzessin (mit Hernert Ernst Groh, Rita Bartos)/ Fall: Der fidele Bauer (mit Herbert Ernst Groh, Willy Hofmann)/ Fall: Die geschiedene Frau (mit Reinhold Bartel, Rita Bartos)/ Goetze: Adrienne (mit Franz Fehringer, Lore Lorentz)/ Jarno: Die Försterchristel (mit Franz Fehringer, Peter Alexander)/ Jessel: Schwarzwaldmädel (mit Franz Fehringer, Antonia Fahberg)/ Kalman: Das Hollandweibchen (mit Herbert Ernst Groh, Willy Hofmann)/ Künneke: Der Vetter aus Dingsda (mit Franz Fehringer, Brigitte Mira)/ Künneke: Wenn Liebe erwacht (mit Franz Fehringer, Renate Holm)/ Lehar: Der Graf von Luxemburg (mit Maurice Bsancon, Benno Kusche)/ Lehar: Paganini (mit Sándor Kónya, Rita Bartos)/ Millöcker: Gasparone (mit Josef Metternich, Anny Schlemm)/ Stolz: Himmelblaue Träume (mit Peter Alexander, Maria Mucke)/ Straus: Ein Walzertraum (mit Herbert Ernst Groh, Peter Alexander)/ Strauß: Jabuka (mit Franz Fehringer, Anny Schlemm). Alle Aufnahmen sind in sehr guter Klangqualität und erfreuen mit liebevoller Ausstattung. Wolfgang Denker
Benes: Auf der grünen Wiese (mit Franz Fehringer, Rita Bartos)/ Dostal: Die ungarische Hochzeit (mit Franz Fehringer, Anny Schlemm)/ Fall: Die Dollarprinzessin (mit Hernert Ernst Groh, Rita Bartos)/ Fall: Der fidele Bauer (mit Herbert Ernst Groh, Willy Hofmann)/ Fall: Die geschiedene Frau (mit Reinhold Bartel, Rita Bartos)/ Goetze: Adrienne (mit Franz Fehringer, Lore Lorentz)/ Jarno: Die Försterchristel (mit Franz Fehringer, Peter Alexander)/ Jessel: Schwarzwaldmädel (mit Franz Fehringer, Antonia Fahberg)/ Kalman: Das Hollandweibchen (mit Herbert Ernst Groh, Willy Hofmann)/ Künneke: Der Vetter aus Dingsda (mit Franz Fehringer, Brigitte Mira)/ Künneke: Wenn Liebe erwacht (mit Franz Fehringer, Renate Holm)/ Lehar: Der Graf von Luxemburg (mit Maurice Bsancon, Benno Kusche)/ Lehar: Paganini (mit Sándor Kónya, Rita Bartos)/ Millöcker: Gasparone (mit Josef Metternich, Anny Schlemm)/ Stolz: Himmelblaue Träume (mit Peter Alexander, Maria Mucke)/ Straus: Ein Walzertraum (mit Herbert Ernst Groh, Peter Alexander)/ Strauß: Jabuka (mit Franz Fehringer, Anny Schlemm). Alle Aufnahmen sind in sehr guter Klangqualität und erfreuen mit liebevoller Ausstattung. Wolfgang Denker









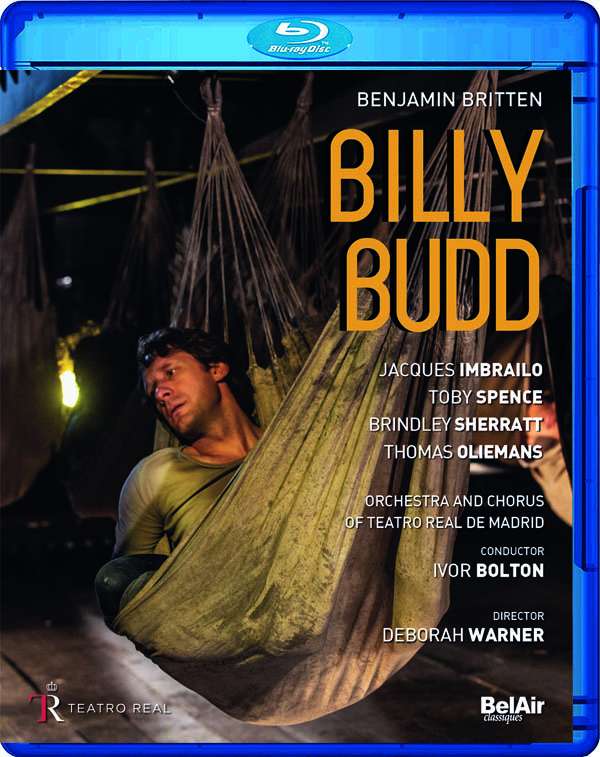

 Gibt es auf Flemings Platte einen Duettpartner, hat Bryn Terfel auf seiner neuen CD
Gibt es auf Flemings Platte einen Duettpartner, hat Bryn Terfel auf seiner neuen CD 




















