.
Im Jahre der 200. Wiederkehr der Uraufführung des Weberschen Freischütz 1821 im Berliner Schaupielhaus hat man bislang kein Wort zur wichtigen Neufassung durch Hector Berlioz 1841 an der damaligen Academie royale de musique (Salle Le Peletier, 7. Juni 1841) gehört. Seit Jahrzehnten wird Webers Oper in Deutschland und international mehr oder weniger verhunzt durch die Theater geschleift, verstörend in Besetzungen und Fassungen, unbefriedigend auch auf CDs vertreten (die recht reife Elisabeth Grümmer nebst Hopf oder Schock/EMI & live stellt immer noch die vielleicht beste Wahl dar, sieht man von Kleiber fils´ rasanter Sicht aber mit Peter Schreiers grotesk besetztem Max und den Schaupieler-Dialogen aber doch sehr speziell/DG ab). Von Schrecklichkeiten wie der Aufnahme mit Birgit Nilsson möchte man gar nicht erst anfangen. Webers Freischütz hat wenig Glück auf den Theatern, weil niemand der Sprechfassung und dem Libretto traut, dieses ver-unbessert, kürzt oder weglässt. Auf CDs wie in den Häusern.

Hector Berlioz/ Photographie von Nadar/ Wiki
Denn auch Christoph Eschenbach hätte es besser wissen sollen, als er nun im Jubiläumsjahr 2021 einen kaum diskutablen und nur mäßig beachteten Freischütz konzertant am Ort des originalen Berliner Geschehens gab. Dabei war er es, der in seiner Pariser Zeit (live m. W. erstmals in moderner Zeit) einen ganz wunderbaren, konzertanten Freychütz francais 2002 mit der fabelhaften Michaela Kaune/Agathe (französisch ohne -e gesprochen) aufführte, auch in Paris erstmals seit Menschengedenken (was in Frankreich nicht viel heißt, denn was in Paris nicht stattfindet ist nicht gewesen…). Wenngleich jedoch der französische Dirigent Jean-Paul Penin eine französischsprachige CD der Berlioz-Version bereits 1999 veröffentlicht hatte (davon nachstehend mehr).
.
Der überwältigende Eindruck dieses Eschenbach-Konzertes 2002 (die Kaune wie gesagt unerreicht und Annick Massis/Annette entzückend!) führte mich eben zu Berlioz, der mit seinen eigens komponierten Rezitativen und dem sehr ordentlich übersetzten Libretto von Emilien Pacini so unerhört geeignet ist für eine internationale Präsentation der Oper, deren originale Singspiel-Sprechtexte wie beim Fidelio oder der Entführung die Sänger gerne verzweifeln lässt (man denke an Jessye Normans Leonore bei Philips, an Absurdität nicht zu überbieten). Die Handlung ist hier viel spannender, der Text kein Stolperstein und die flotten Rezitative treiben den Plot vorab, der aristotelisch in einem kurzen Zeit-. und Ortsrahmen spielt. Die französische Textfassung nebst den Rezitativen stammt wie gerade erwähnt von dem renommierten Pariser Librettisten Emilien Pacini (und nicht von Berlioz), der auch einen Robert Bruce nach der Musik aus der Donna del Lago von Rossini mit neuer Handlung hergestellt hatte.

Der Dichter und Librettist Emilien Pacini schrieb den französischen Text für Berlioz´´“Freyschutz“/ Wikipedia
Die damaligen Pariser Freyschutz-Aufführungen waren hochbesetzt mit Sängern wie Marie (Tenor), Massol, Bremond und den Damen Betty/ Dobré und Nau, letztere eine beliebte Koloratursopranistin jener Zeit. Auch die skandalumwitterte Sängerin Sarolta verlieh späteren Aufführungen Glamour. Ebenso zählt die kapriziöse Rosine Stoltz, Geliebte vieler, später zu den Agathen en francais.
Anders vielleicht als in der Originalversion hat man bei Berlioz weniger ein Werk der post-napoleonisch-deutschnationalen Bestrebungen vor sich (die ehemals besetzten Länder und Kleinstaaten fanden langsam zu sich, und man denkt an das Hambacher Fest, die Paulskirche und die Märzrevolution, aber eben auch an die Unterdrückung durch Metternichs Restauration mit Spitzeln und Verfolgungen).
Die Berlioz-Version ist nun (nur noch) ein in den Pariser Opernbetrieb integriertes Stück Entertainment, die Gorge du Loup (Wolfsschlucht) auch hier eine Herausforderung an die Bühnentechnik der Académie royale 1841 in der Folge von Aubers oder Meyerbeers cinematographischen Bühnen und durchaus in der Reihe mit den Troyens und deren Bühnenanforderungen.
Eine Wiederbelebung eben dieses wichtigen kulturellen deutsch-französischen Joint-Ventures durch Eschenbach wäre in Berlin 2021 erstrebenswert gewesen, denn die Berlioz-Fassung hat es laut Bärenreiter-Arcor-Verlag nur selten in Deutschland gegeben. Dortmund spielte den Freischütz in der deutschen (Berlioz/Pacini-)Rezitativ-Version von Bernhard Helmich und Daniel Kleiner/Dirigent und in der Regie von Wolfram Mehring 1997. Erfurt präsentierte den französischen Freyschutz in Deutsch 2015 beim Domstufenfestival (deutsche Rückübersetzung von Bernhard Helmich und Daniel Klajner, mit Beteiligung von Ian Humbold für die Rezitative), Trier war 2010 erster (dto.), Innsbruck 2020 (stark gekürzt dto. mit langer Sprechpassage Agathe-Eremit nach der Kindschen Erstfassung, wenngleich zu reichlich Sprechtext im Ganzen, was Berlioz ad absurdum führt), Bern 2013 in Französisch mit deutschen Rezitativen (chapeau), ebenso das tschechische Liberec 2014. London hörte 2011 die Berlioz-Fassung mit angeblich historischen Instrumenten (was nicht nur Dirigent Penin für fragwürdig hält, und bei den Sängern war von historischer Vibratoarmut keine Rede), Paris gab das Werk an der Comique 2011 (Rezitative Guiraud), Nizza 2013 (dto.), immerhin. C´est pas beaucoup.

Der Dirigen und Muaikwissenschaftler Jean-Paul Penin, der bereits 1999 und erstmals eine Aufnahme der Berlioz-Fassung des Weberschenb „Freischütz“ einspielte, einm Pionier fürwahr/jeanpaulpenin.com
Warum also nicht an die wesentlich aufführbarere Fassung anknüpfen? Kennt die kein Dramaturg, kein Intendant? Was für eine Verarmung der theatralischen Opernlandschaft. Es gibt sogar zur Information, wie oben erwähnt, eine offizielle, wenngleich vergriffene, CD-Aufnahme (Agathe/Cécile Perrin ist scharf-stimmig und gewöhnungsbedürftig, die Herren Francois Soulet und Didier Henry ein Gewinn, Anne Constain als Nanette so la-la, aber es ist dem Dirigenten Jean-Paul Penin wieder einmal hoch anzurechnen, so etwas Seltenes überhaupt eingespielt zu haben), immerhin. Er selbst schrieb: „Für diese Aufnahme habe ich die originalen Rezitative in der Bibliothek der Pariser Oper kopiert und drucken lassen. Und Achtung: Manchmal wird jetzt Le Freischütz auf Französisch wieder gespielt, wie in Paris vor ein paar Jahren an der Opéra Comique, aber mit den Rezitativen von Ernest Guiraud von 1882. Sie klingen zwar opulenter, sind aber weit entfernt vom Berlioz‘ Genie – Guiraud hatte ja auch Carmen’s Rezitative verfasst und sogar Mendelssohns Lieder ohne Worte orchestriert)“.
.
.
An weiteren Dokumenten haben Sammler natürlich den Pariser Mitschnitt unter Eschenbach von 2002 und den von den Londoner Proms von 2011 unter Gardiner, immerhin. Und zu meinen Schätzen gehört die „Wolke“ mit Germaine Lubin in Französisch ebenso wie die stilistisch unerreichte Version von Elisabeth Schwarzkopf, nun natürlich in Deutsch. „Legato, legato, Legato“, sagte meine Freundin, die unvergessene Sängerin und Stimmlehrerin Hanna Ludwig, stets. Recht hatte sie, beide Damen machen´s exemplarisch vor.
.
Im Folgenden widmen wir uns mit drei Beträgen dem Freyschutz francais. Zum einen gibt es einen Artikel von Ian Rumbold bei den [t]akte des Bärenreiter·Alkor-Verlages zur Aufführung in Trier 2010, dann den des Erfurter Chefdramaturgen Arne Langer zu den Aufführungen der Domfestspiele 2015, und schließlich mehr auf Berlioz eingehend einen Auszug aus dem hochinformativen Beitrag der Hector-Berlioz-website: voila unsere Hommage zum 200. Geburtstag des Freyschütz. G. H.
.

Bühnenbild zum „Robin les Bois“ von Castil-Blaze/ Gallica/BNF
Nun also Ian Rumbold: Berlioz beklagte sich häufig über Mitmusiker, die in musikalische Meisterwerke „eingriffen“ und die Anweisungen ihrer Komponisten nicht genau befolgten. Einer dieser Adressaten seines Zorns war Castil-Blaze, der 1824 am Théâtre de l’Odéon in Paris eine Langzeitproduktion von Webers Freischütz (unter dem Titel Robin des bois) inszenierte, die Berlioz als „grobe Travestie“ bezeichnete, „zerhackt und auf die mutwilligste Weise verstümmelt“. Dass Berlioz 1841 an einer authentischeren Inszenierung an der Opéra mit einer Neuübersetzung des Librettos von Émilien Pacini beteiligt werden wollte, ist verständlich. Aber warum schrieb er angesichts seiner Einstellung zur musikalischen Reinheit Rezitative, um die Passagen des gesprochenen Textes zu ersetzen, welche die Oper unterstreichen?
Die Erklärung findet sich in Berlioz’ Memoiren: „Im Freischütz“, schrieb er, „sind die musikalischen Nummern wie in unseren Opéras-comiques mit prosaischen Dialogen durchsetzt, während die Konventionen der Opéra fordern, dass jedes Wort der dort aufgeführten Dramen oder lyrischen Tragödien gesungen werden muss.“ Ohne Rezitative konnte es an der Opéra gar keine Produktion geben. Er stimmte daher zu, jedoch nur unter der Bedingung, dass „das Werk vollständig aufgeführt werde, ohne die Abänderung auch nur eines Wortes oder einer Note“. Neben den Rezitativen verlangte die Opéra ein Ballett als Entr’acte, für welches Berlioz Webers Aufforderung zum Tanz unter dem Titel L’invitation à la valse arrangierte und orchestrierte.

„Le Freyschutz“ de Berlioz: Francois Pierre Villaret war 1870 der Pariser Max/ Gallica/BNF
Die Inszenierung mit den Rezitativen von Berlioz, uraufgeführt am 7. Juni 1841 unter der Leitung von Pantaléon Battu (Hausdirigent Habeneck lag krank darnieder), war ein beachtlicher Erfolg und wurde bis zum 27. April 1846 noch sechzig Mal wiederholt. Eine weitere Abweichung von Webers Partitur hatte sich als notwendig erwiesen: Rosine Stoltz musste in der Rolle der Agathe ihre Arien im zweiten und dritten Akt um einen Ton bzw. eine kleine Terz nach unten transponieren. Das Hauptproblem war jedoch, dass die Rezitative selbst zu lang erschienen, insbesondere in der Szene zwischen Max und Gaspard am Ende des ersten Aktes. Auch Berlioz musste zustimmen, obwohl er den Sängern teilweise die Schuld daran gab, dass sie nicht die angemessene Leichtigkeit fanden.
Als die Inszenierung 1851 wiederaufgenommen wurde, hatte die Opéra die Geduld mit Berlioz’ Vorgabe zur Wahrung der Integrität der Oper verloren und sowohl in Webers Musik als auch in Berlioz’ Rezitativen wurden Kürzungen vorgenommen. Berlioz wurde gerufen, um letzteres zu genehmigen, und erkannte, dass es wenig Sinn hatte, sich zu beschweren. (Tatsächlich empfiehlt sich die kürzere Fassung der Rezitative – die in Anhang IV von Band 22b der Neuen Berlioz-Ausgabe enthalten ist – als praktische Option sehr.) Er war jedoch einigermaßen frustriert, als er weithin verantwortlich gemacht und 1853 sogar vor Gericht öffentlich der „Kürzungen, Unterdrückungen und Verstümmelungen“ – wie er sie nannte – beschuldigt wurde, denen die Oper dadurch ausgesetzt war, was soweit ging, dass ein angesehenes Mitglied des Publikums sogar versuchte, die Opéra wegen falscher Darstellung zu verklagen! (In der Folge schrieb 1882 dann Ernest Guiraud die Musik der Rezitative).

Julia Hisson war 1870 die Agathe in Paris, hier im Kostüm der Meyerbeerschen Selika/ BNF/ Gallica
Berlioz bereitete 1849/50 auch eine italienische Fassung der Rezitative für das Königstädtische Theater Berlin vor (wo eine italienische Truppe beschäftigt war; herausgegeben in NBE 22b, Anhang III). Er verkaufte die Rezitative 1850 an Covent Garden, London, wo eine andere italienische Übersetzung verwendet wurde und die Rezitative so stark verändert wurden, dass Berlioz bei einer Aufführung im Mai 1851 diese überhaupt nicht wiedererkennen konnte! Weitere Aufführungen mit Berlioz’ Rezitativen fanden in Valparaiso (1854), Mailand (1856), Boston (1860) und Buenos Aires (1864) statt. Ian Rumbold www.takte-online.de (Bärenreiter-Verlag / Alkor-Edition/ Übersetzung Daniel Hauser).
.
.
Zur Verbreitung und Wirkung auch Arne Langer: Nach der Berliner Uraufführung eroberte der Freischütz in Windeseile die deutschsprachigen Bühnen, wenn auch gelegentlich stark bearbeitet. 1824 folgten die ersten englischen und französischen Übersetzungen. In London brachten gleich mehrere Buhnen eilig fabrizierte Bearbeitungen heraus. Die erste, sehr stark bearbeitete französische Fassung unter dem Titel Robin des bois von Thomas Sauvage (Text) und Francois Castil-Blaze (Musik) fur das Pariser Theatre de l‘Odeon war ausgesprochen erfolgreich. Sie wurde zudem in Brüssel und französischen Provinzstädten nachgespielt und später auch von Pariser Bühnen (1835 Opera-Comique, 1855 Theatre-Lyrique) übernommen. 1829 war dann dank des Gastspiels einer deutschen Operntruppe in der Opéra-Comique das Werk auch in der Originalsprache zu erleben. In der Großen Pariser Oper, der Academie royale de musique, wurde Le Freyschutz erstmals 1841 aufgeführt. Gemäß den Statuten dieses wichtigsten französischen Opernhauses war es dort nicht möglich, wie im Original und in den früheren französischen Aufführungen gesprochene Dialoge zu verwenden. Deshalb mussten die Dialogtexte für Gesang neu komponiert werden. Mit dieser Aufgabe wurde nicht etwa ein handwerklich geschickter aber minder renommierter Komponist, sondern einer der führenden und innovativsten seiner Zeit, Hector Berlioz. Zusätzlich zur Vertonung der Sprechszenen instrumentierte Berlioz noch ein Klavierstück Webers, die Aufforderung zum Tanz (1819), die die musikalische Grundlage der – ebenfalls an der Opéra obligatorischen – Balletteinlage bildete. (…)
Die erstklassig besetzte Einstudierung erwies sich als so erfolgreich, dass sie über 80 Jahre im Repertoire der Opera blieb. Parallel wurde der Freischütz immer wieder in neuen Bearbeitungen auch an anderen Pariser Theatern gezeigt, so am Theatre-Lyrique 1866, am Theatre du Chateau d‘eau 1891, am Theatre des Champs-Elysees 1913.

Gustave Pedro Gaillard war der Gaspard (Kaspar) in Paris von 1873 bis 1877)/ hier als Gounods Méphistophéles/parismuseescollections.paris.fr
Nachdem die Pariser Freischütz-Adaptionen des 19. Jahrhunderts lange in der deutschen Fachliteratur als ästhetisch minderwertig betrachtet wurden, betont die heutige Forschung den positiven Beitrag der frühen Pariser Produktionen des Freischütz. Die Hauptwerke der Grand Opera aus der Feder Giacomo Meyerbeers wie z. B. Robert le diable sind der Musik und Dramaturgie Webers in Vielem verpflichtet, und letztlich war es Berlioz‘ Bearbeitung, die den Freischütz außerhalb Deutschlands durchzusetzen verhalf. Schließlich hatte das Werk an allen italienisch geprägten Bühnen nur als große Oper mit Rezitativen eine Chance gespielt zu werden. Wo nicht wie in Mailand 1856, Brüssel 1863 und Buenos Aires 1864 die Berlioz-Version selbst (zumeist in italienischer Übersetzung) gespielt wurde, diente sie immerhin als Vorbild für andere Rezitativbearbeitungen des Werks, so in Florenz 1843, London 1850 und 1872 in Mailand als Il franco cacciatore in einer Übersetzung des Verdi-Librettisten und Komponisten Arrigo Boito (…) . Arne Langer
.
.
Weiteres zu Weber und Berlioz findet sich auf der Hector Berlioz Website: Berlioz‘ erste Bekanntschaft mit der Musik von Weber datiert auf den Dezember 1824, als er Le Freyschutz (ohne – ü -) im Odéon-Theater hörte. Der Freischütz war in Deutschland nach seiner Uraufführung 1821 auf Anhieb ein Erfolg geworden. Was Berlioz in Paris jedoch hörte, war nicht die Oper von Weber, sondern eine Travestie mit dem Titel Robin des bois. Diese wurde vom Komponisten und Kritiker Castil-Blaze zusammengestellt, der sich auf das „Arrangieren“ von Opernwerken anderer Komponisten spezialisiert hatte, um deren Erfolg sowie seinen eigenen Gewinn zu sichern (er unterzog Mozart derselben Behandlung). Das Werk beeindruckte Berlioz dennoch tief und er besuchte 1825 viele weitere Aufführungen. Sie offenbarten ihm eine Welt, die er bis dahin nicht geahnt hatte – seine einzigen Erfahrungen mit großer Musik waren bisher die Opern von Gluck und Spontini an der Pariser Opéra gewesen (Memoiren, Kapitel 16). (…)

„Le Freyschutz“ in Paris: Figurine zu Max/ Gallica/BNF
Berlioz verlor wahrscheinlich keine Zeit, die Partitur sowie alle anderen von Weber, die er in die Hände bekam, zu recherchieren und genau zu studieren. Ein Brief vom 1. November 1828 an seine Schwester Nanci (Correspondance générale Nr. 100, im Folgenden kurz CG) zeigt ihn und einen jungen deutschen Freund, Louis Schloesser, der Weber gekannt hatte, aus der Erinnerung heraus Stücke aus Freischütz, Oberon und Euryanthe seinem Lehrer Lesueur vorspielend und vorsingend. Im selben Brief schickt er seiner Schwester auch einen Walzer von Weber, den er ausführlich beschreibt. Es ist offensichtlich, dass Berlioz wie bei Beethoven sowohl auf Webers Instrumentalmusik als auch auf seine Opern aufmerksam wurde: Briefe von 1830 erwähnen, dass Camille Moke ihm häufig Klaviermusik von Weber und Beethoven vorspielte.

Webers „Freyschutz“ in der Berlioz-Version: Veröffentlichung der Besetzungen bis 1877 im Verlag Calman-Levy und Jonas, Paris/BNF/Gallica
Zuvor hatte Berlioz die flüchtige Gelegenheit gehabt, Weber persönlich zu treffen, der im Februar 1826 auf dem Weg nach London nach Paris kam, wo er die Aufführung seiner neuesten Oper Oberon leiten sollte. Doch zu Berlioz‘ anhaltendem Bedauern verpassten sich die beiden Männer nur knapp, und die Chance wiederholte sich nicht: Der seit langem angeschlagene Weber starb am 5. Juni desselben Jahres in London (Memoiren, Kapitel 16). Doch Webers Musik hatte den jungen Berlioz bereits stark geprägt, wie seine im Herbst 1826 komponierte Ouvertüre Les Francs-juges zeigt. Ab 1828, als er auch Beethoven entdeckte, wurden die beiden Komponisten gedanklich häufig miteinander verbunden. In einem Artikel mit dem Titel Aperçu sur la musique classique et la musique romantique, der in Le Correspondant vom 22. Oktober 1830 (Critique Musicale I, 63-68) veröffentlicht wurde, schreibt er sich zu, Weber und Beethoven in Frankreich eingeführt zu haben, was er das genre instrumental expressif nennt, das bis dato unbekannt gewesen war (…)
Berlioz war damit ab den späten 1820er Jahren der glühendste Verfechter Webers in Frankreich. Als die Opéra 1841 beschloss, eine französische Version des Freischütz zu inszenieren, verpflichtete sich Berlioz, Rezitative dafür zu schreiben (die Konventionen der Opéra verboten die Verwendung gesprochener Dialoge) und orchestrierte Webers Klavierstück Aufforderung zum Tanz, um die obligatorische Ballettmusik zu liefern (Memoiren, Kapitel 52; die Orchestrierung von Berlioz wird an anderer Stelle auf der Website der Berlioz-Gesellschaft besprochen). Ein Artikel, den er im Journal des Débats vom 13. Juni 1841 über das Werk schrieb, wurde von ihm 1862 in À travers chants abermals aufgelegt, zusammen mit einem späteren Artikel über die Inszenierung des Oberon im Théatre Lyrique 1857, deren großer Erfolg Berlioz erfreute (Journal des débats, 6. März 1857). Es war ein grausames Schicksal, dass Berlioz Ende 1853 beschuldigt wurde, für die Verstümmelung von Webers Meisterwerk an der Opéra verantwortlich zu sein. Berlioz hatte keine Schwierigkeiten, diese absurde Anschuldigung zu widerlegen, aber es schmerzte ihn zutiefst.
Berlioz nahm oft Musik von Weber in seine Programme auf, wie zum Beispiel bei seinen Konzerten in London (1852) und Baden-Baden (1856, 1858 und 1860). Auch in seinen Konzertkritiken hatte er häufig Gelegenheit, Weber zu erwähnen. Er versuchte jedoch nicht, eine Biographie Webers zu erstellen, im Gegensatz zu seinen drei anderen Helden Beethoven (1829), Gluck (1834) und Spontini (1851, neu abgedruckt in den Soirées de l’orchestre 1852 und 1854). In seiner 1844 erstmals veröffentlichten Abhandlung über Instrumentation und Orchestrierung wird Weber immer wieder als einer der modernen Meister des Orchesters erwähnt, den Berlioz als Vorbild anerkennt, obwohl die Zahl der direkten Zitate aus Webers Musik begrenzt ist (die meistzitierten Beispiele sind die Ouvertüren zum Freischütz und zum Oberon). (…) Michael Austin/ The Berlioz Website/Übersetzung Daniel Hauser
.
.
Wie stets bedanken wir uns für die großzügige Hilfe vieler Personen, voran Johannes Mundry von den [t]akte im Bärenreiter·Alkor Verlag für die Übernahme des Artikels von Ian Rumbold; sodann bei Arne Langer vom Theater Erfurt für seinen Text zu den Aufführungen bei den Erfurter Domfestspielen; und schließlich bei Michael Austin von der Hector-Berlioz-website, deren Text wir auszugsweise wiedergeben. Nicht vergessen möchte ich den Dirigenten und Musikwissenschaftler Jean-Paul Penin, der den Hinweis zu den 1882-Rezitativen von Guiraud gab und dessen Verdienst es wieder einmal ist, bereits 1999 eine wahre Pionier-Einspielung neben manchen anderen wie von Sacchini und Spontini auch dieser Oper gemacht zu haben. Ein Blick auf seine website zeigt die ganze Breite seiner Leistungen. Und schließlich bedanken wir uns beim Kollegen Daniel Hauser für seine wie stets fabelhafte Übersetzungen aus dem Englischen, was wären wir ohne ihn! (Das große Foto oben zeigt eine Szene aus der Erfurter Domstufen-Festival-Aufführung 2015/ Theater Erfurt/ Foto Lutz Edelhoff) G. H.
.
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.



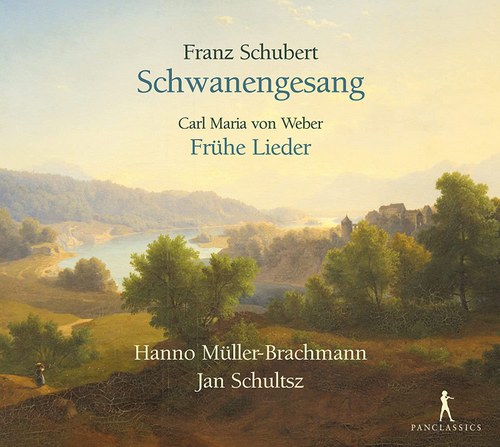
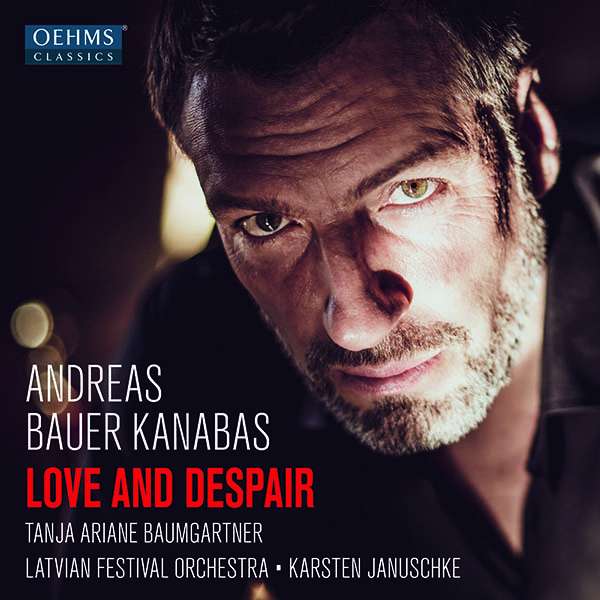
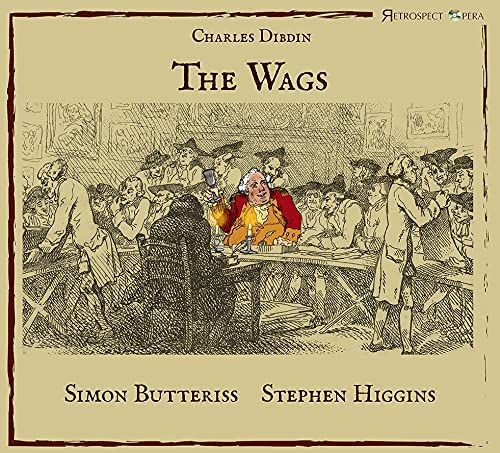
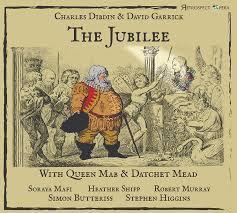












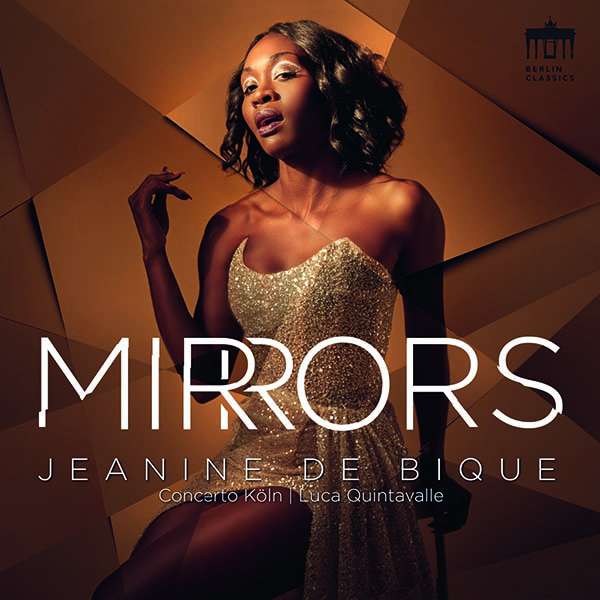



 Die vierte wichtige Solistin ist natürlich
Die vierte wichtige Solistin ist natürlich