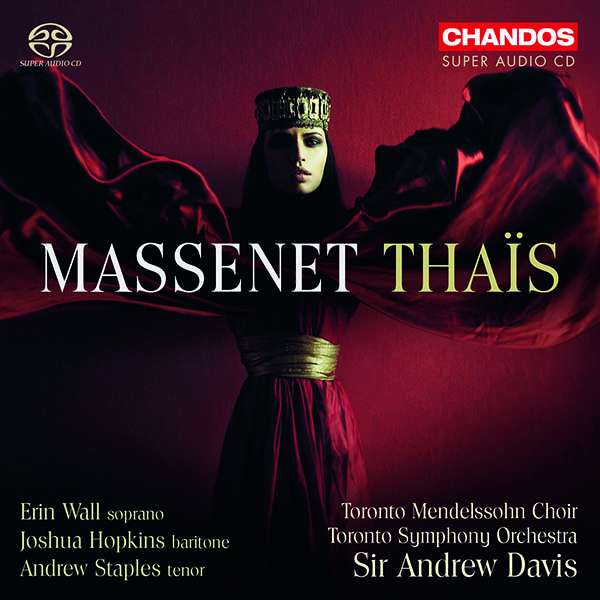Das italienische Label Dynamic ist ja operalounge.de–Lesern kein unbekanntes, und immer wieder berichten wir über die Live-Mitschnitte von Festivals und herausragenden Aufführungen weitgehend in Italien, zuletzt eben der wunderbare Fernand Cortez in Florenz oder Il Schiavo aus Cagliari (aus dieser Quelle, vom phantasiereichen Teatro Lirico, von der auch die Oper Palla de Mozzi des italienischen Dirigenten und Komponisten Marinuzzi herauskommen wird, die fast zeitgleich mit ihrer Uraufführung 1943 an der Berliner Staatsoper mit Schwarzkopf und Nold Premiere hatte). Nicht immer waren wir über die akustische Seite der Aufnahmen glücklich, das hat sich aber mit verfügbarer Technik drastisch verbessert, und selbst Martina Franca und die RAI haben einen zugelegt, was der Opernfreund angesichts der zum Teil mundwässernden Titel gerne vermerkt.
Nun hat Dynamic (im festen Vertrieb bei Naxos) eine Sommerinitiative gestartet und seine zum Teil etwas älteren Aufnahmen auf den Markt geworfen – zum absoluten Spottpreis und dto. absolut habenswert. Wer also so lange gezögert hat, sollte zugreifen. Von den rund 20 Titeln haben wir einige – für uns – interessante herausgegriffen und stellen sie noch einmal vor. „Knaller“ aber ist – Trara – die nun erstmalige „offizielle“ Ausgabe der Norma mit zwei Sopranen, lange vor dem Projekt Sutherland-Caballé: 1977 singen unter Michael Halasz Grace Bumbry (jawohl!) und Lella Cuberli und guter Radiotechnik. Das ist ein Bombenauftakt vom Festival della Valle d´Itria. Weiteres berichten Ingrid Wanja und Bernd Hoppe. G. H.
 Norma mit zwei Sopranen: Wer hat sich bei seiner ersten Begegnung mit Bellinis Norma in einer Aufführung mit herkömmlicher Besetzung nicht darüber gewundert, dass die Partie der keuschen Jungfrau sanften Gemüts Adalgisa einem dramatischen Mezzosopran, die der reifen, durch die Höhen und Tiefen des Lebens gegangenen zweifachen Mutter Norma einem Sopran mit Koloraturfähigkeit anvertraut wurden?! Es soll unter anderem auf den Einfluss Giuseppe Verdis zurückgehen, zu dessen Zeit man dazu überging, die Rolle des zweiten, ursprünglich eines soprano leggero, auf einen Mezzosopran zu übertragen. Ursprünglich war die Norma für Giuditta Pasta, die zwischen Amina und Tancredi alles singen konnte, bestimmt, die Adalgisa für Giulia Grisi, die Bellini auch für seine Giulietta inspirierte.
Norma mit zwei Sopranen: Wer hat sich bei seiner ersten Begegnung mit Bellinis Norma in einer Aufführung mit herkömmlicher Besetzung nicht darüber gewundert, dass die Partie der keuschen Jungfrau sanften Gemüts Adalgisa einem dramatischen Mezzosopran, die der reifen, durch die Höhen und Tiefen des Lebens gegangenen zweifachen Mutter Norma einem Sopran mit Koloraturfähigkeit anvertraut wurden?! Es soll unter anderem auf den Einfluss Giuseppe Verdis zurückgehen, zu dessen Zeit man dazu überging, die Rolle des zweiten, ursprünglich eines soprano leggero, auf einen Mezzosopran zu übertragen. Ursprünglich war die Norma für Giuditta Pasta, die zwischen Amina und Tancredi alles singen konnte, bestimmt, die Adalgisa für Giulia Grisi, die Bellini auch für seine Giulietta inspirierte.
Obwohl Rodolfo Celletti 1977, als die Aufnahme in Martina Franca beim Festival della Valle d’Itria entstand, noch nicht wie ab 1980 dessen künstlerischer Leiter war, soll er sich dafür eingesetzt haben, Norma in der von Bellini gewollten Besetzung aufzuführen (und mit Renata Scotto und Margherita Rinaldi/ Myto 1978 folgte das Maggio Musical Florenz unter Muti auf den Fersen, allerdings noch immer nur auf grauen Labels und nicht im hauseigenen Maggio-Katalog). Außergewöhnlich für das ambitionierte Festival in Martina Franca, bei dem man künstlerische Leistungen ersten Ranges erleben durfte, bei dem aber auch regelmäßig die Stromversorgung im Aufführungsort Cortile del Palazzo Ducale wegen Überlastung zusammenbrach, ist die Starbesetzung bei den Solisten, während man bei Orchester und Chor eher Sparsamkeit walten ließ. Hier hakt es denn auch mit unausgewogenen, meistens zu langsamen Tempi des unter Michael Halasz und einem für die gallische Kriegsmacht recht schütterem Chor, den man sich damals noch nicht aus dem Ostblock rekrutierte.
Die Solisten allerdings können sich hören lassen. Aus London kam die Bass-Säule Covent Gardens Robert Lloyd mit so gewaltiger wie kultiviert eingesetzter Stimme und viel akustischem Charisma für den Oroveso. Einer der zuverlässigsten Tenöre seiner Zeit, eigentlich unterschätzt, war mit Giacomo Giacomini gewonnen worden, später ein echter tenore eroico und ein tadelloser Otello, aber 1977 noch ein Spintotenor dunkler Farben mit sicherer Höhe, auch wenn ein hoher Ton in seiner Auftrittsarie nicht gesungen wird. Insgesamt ist er akustisch mehr Krieger als Liebender, erst im Schlussduett mit Norma lässt er auch weichere Töne hören. Ganz jung war damals noch Lella Cuberli, die so sehr von den Mezzohörgewohnheiten gar nicht abweicht, da die Mittellage dunkel und melancholisch getönt ist, die in der oberen Lage jedoch den Unterschied ausmacht mit einer reinen, leichten, jungen und in der Höhe schwerelos wirkenden Sopranstimme.
Zweifellos hat Grace Bumbry die Stimme d‘una donna vissuta, die Willenskraft und Autorität ausstrahlt, nicht silbrigen Mondesglanz, sondern eher die pralle Sonne im Zenit hören lässt. Die Fiorituren der Partie werden nicht ausgekostet, die Höhen eher angetippt oder wirken scharf, als dass sie als zum Strahlen gebracht werden. Purer Belcanto ist das natürlich nicht. Die gemeinsamen Duette mit Adalgisa aber werden so glaubwürdiger, spiegeln das Verhältnis der beiden zueinander eher wider als mit den gewohnten Stimmfächern.
Von sanfter Entschlossenheit ist die Clotilde von Eugenia Gardato, dunkel wie sein Freund Pollione klingt der Flavio von Paolo Todisco, nur dumpfer. Für die Besetzung der beiden Frauenrollen mit Sopranen spricht viel, Grace Bumbry allerdings plädiert nicht überzeugend dafür. (Dynamic CDS469/1-2). Ingrid Wanja
 Eher wohl die Verkleinerungsform Operchen als die Gattungsbezeichnung Operette ist im italienischen Booklet zur „operetta“ La Secchia Rapita (Der gestohlene Eimer) vom Verlagschef mit eigenen künstlerischen Ambitionen, Giulio Ricordi (19. Dezember 1840 in Mailand; † 6. Juni 1912) alias Jules Bucket gemeint, denn sie hat viel von einer opera buffa mit den vielen komischen Situationen rund um die Rivalität zwischen den beiden Städten Bologna und Modena, Erzfeinde innerhalb der Emilia-Romagna und schöne Beispiele für den auch heute noch herrschenden Campanilismo. Das Stück spielt zur Zeit Friedrichs II., der Streitgegenstand ist ein Holzeimer, die Secchia des Titels, mit dem man das Wasser aus den Brunnen hievte. Als Beweisstück für die historische Wahrheit der Geschichte wird noch heute zumindest eine Kopie der secchia im Dom von Modena aufbewahrt. Heimlich oder offen verliebte, aber auch zerstrittene Paare bilden das Personal in dem Stück, dessen von Renato Simoni verfasstes Libretto auf dem „poemo eroicomico“ von Alessandro Tessoni aus dem Jahre 1622 beruht. Außer Ricordi im zwanzigsten Jahrhundert hatten sich bereits viel früher Zingarelli, Bianchi und Salieri des Stoffes angenommen.
Eher wohl die Verkleinerungsform Operchen als die Gattungsbezeichnung Operette ist im italienischen Booklet zur „operetta“ La Secchia Rapita (Der gestohlene Eimer) vom Verlagschef mit eigenen künstlerischen Ambitionen, Giulio Ricordi (19. Dezember 1840 in Mailand; † 6. Juni 1912) alias Jules Bucket gemeint, denn sie hat viel von einer opera buffa mit den vielen komischen Situationen rund um die Rivalität zwischen den beiden Städten Bologna und Modena, Erzfeinde innerhalb der Emilia-Romagna und schöne Beispiele für den auch heute noch herrschenden Campanilismo. Das Stück spielt zur Zeit Friedrichs II., der Streitgegenstand ist ein Holzeimer, die Secchia des Titels, mit dem man das Wasser aus den Brunnen hievte. Als Beweisstück für die historische Wahrheit der Geschichte wird noch heute zumindest eine Kopie der secchia im Dom von Modena aufbewahrt. Heimlich oder offen verliebte, aber auch zerstrittene Paare bilden das Personal in dem Stück, dessen von Renato Simoni verfasstes Libretto auf dem „poemo eroicomico“ von Alessandro Tessoni aus dem Jahre 1622 beruht. Außer Ricordi im zwanzigsten Jahrhundert hatten sich bereits viel früher Zingarelli, Bianchi und Salieri des Stoffes angenommen.
Die operetta wurde am 1. März 1910 in Turin im Teatro Alfieri uraufgeführt, mit wenig berauschendem Erfolg beim Publikum, mit Verrissen in der Presse. Besser verlief eine Aufführung ebenfalls im März 1910 in Mailand, der Alfano, Boito, Zandonai, Montemezzi, also die Elite italienischer Opernkomponisten, beiwohnte. 1913 gab es das Werklein in Buenos Aires, von dessen Highlights es auch Aufnahmen gibt.
Neben dem Orchester ist der Coro der Claudio Abbado Civic Music School unter Francesco Girardi für schöne Momente verantwortlich, denn er wirft sich mit Elan in seine vielfältigen Aufgaben als Soldaten, Bauern, Damen und vieles andere.Nach mehr als hundert Jahren hat sich Aldo Salvagno der Secchia angenommen und aus Bruchstücken des Notenmaterials einer Gruppe junger Künstler die Möglichkeit geboten, das Werk dem Vergessen zu entreißen (Aufnahme von 2017 in Mailand). Er ist auch der dem Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi vorstehende Dirigent, der für flotte Tempi und stimmungsvolle Intermezzi sorgt. Die Genueser Firma Dynamic hat das Verdienst, das Unternehmen auf CD festgehalten zu haben, allerdings nur die Highlights, sodass man im freundlicherweise zweisprachig abgedruckten Libretto oft verzweifelt umherblättert, weil man nicht weiß, wo der eine Track endet und der nächste beginnt.
Aus der Menge der Solisten sticht der Podestà von Elcin Huseynov durch einen farbigen Spielbass hervor. Einen geschmeidigen Mezzo hat Margherita Sala für den Giglio, die von ihm verehrte Rosa hat einen netten, aber wenig einprägsamen Sopran mit dem von Kaori Yamada. Unsicher und spröde klingt der Bariton, den Giorgio Valerio dem Conte di Culagna zur Verfügung stellt, während seine Gattin von Laure Kieffer ein starkes Vibrato in der Höhe, ansonsten schüchternen Jubelklang verliehen bekommt. Den Titta singt Hyuksoo Kim mit noch technisch unfertigem, aber immer präsentem Tenor. Also liegt das Verdienst der Aufnahme weit mehr in der Entdeckung eines bereits vergessen gewähnten Stücks mit frischen, volkstümlichen Melodien als in der künstlerischen Leistung der Ausführenden (Dynamic CDS 7798). Ingrid Wanja
 Man könnte sich beim Erleben von Giordanos Fedora in der Aufführung des Teatro Carlo Felice aus Genua (Foto oben/ Still aus dem Video bei Dynamic) mit der Bewunderung der sängerischen Leistung des Protagonistenpaars Daniela Dessì und Fabio Armiliato begnügen, liefe es einem bei der Schlussszene nicht heiß und kalt den Rücken hinunter. Nur Monate danach musste das auch im Privaten miteinander verbundene Paar eine ähnlich tragische Situation erleben, als der Sopran einem wohl besonders tückischen, schnell zum Tode führenden Krebsleiden erlag und der Tenor in einer besonders durch seinen Anteil daran bewegenden Trauerfeier in Brescia Abschied von seiner Lebensgefährtin nehmen musste. Das kann man natürlich nicht ausblenden, wenn man die Blu-ray von dieser wohl letzten gemeinsamen Arbeit sieht und hört, in der nichts von dem drohenden Verhängnis zu spüren, wohl aber die vollkommene Harmonie des Paares auch im künstlerischen Bereich zu spüren ist.
Man könnte sich beim Erleben von Giordanos Fedora in der Aufführung des Teatro Carlo Felice aus Genua (Foto oben/ Still aus dem Video bei Dynamic) mit der Bewunderung der sängerischen Leistung des Protagonistenpaars Daniela Dessì und Fabio Armiliato begnügen, liefe es einem bei der Schlussszene nicht heiß und kalt den Rücken hinunter. Nur Monate danach musste das auch im Privaten miteinander verbundene Paar eine ähnlich tragische Situation erleben, als der Sopran einem wohl besonders tückischen, schnell zum Tode führenden Krebsleiden erlag und der Tenor in einer besonders durch seinen Anteil daran bewegenden Trauerfeier in Brescia Abschied von seiner Lebensgefährtin nehmen musste. Das kann man natürlich nicht ausblenden, wenn man die Blu-ray von dieser wohl letzten gemeinsamen Arbeit sieht und hört, in der nichts von dem drohenden Verhängnis zu spüren, wohl aber die vollkommene Harmonie des Paares auch im künstlerischen Bereich zu spüren ist.
Valerio Galli, ein noch junger Dirigent, versucht das wie Tosca auf einem Drama von Sardou fußende Stück nicht künstlich zu verfeinern, sondern geht orchestral dankenswerterweise in die Vollen. Um das Protagonistenpaar versammelt sich ein Ensemble von soliden Sängern, so mit dem sonoren Bariton von Alfonso Antoniozzi, der das Chanson „Ecco la Russa“ geschmackvoll vorträgt, der Soubrette Daria Kovalenko, die nicht nur mit dem Couplet von La Vedova Clicquot als Olga alle Klischees ihres Fachs bedient, sogar dem Urgestein Luigi Roni als immer noch basspotentem Cirillo. Etwas mehr Sexappeal hätte man sich von dem umschwärmten Klavierstar Lazinski gewünscht, als ihn Sirio Restani aufbieten kann. Unangenehm dumpf klingt die Stimme von Roberto Maietta als Polizeiagent Cretch.
Nach den vielen schönstimmigen, aber optisch allzu biederen Fedoras von Mirella Freni, die sowohl Domingo als Carreras an ihrer Seite hatte, ist Daniela Dessì optisch eine Traumbesetzung, weiß (wie man der DVD/Blu-ray Dynamic 57772 der Aufnahme entnehmen kann) kostbare Roben in Szene zu setzen und ungezügelte Leidenschaft über die Bühnenrampe zu bringen. Zwar hat die Stimme ein auch für diese Verismopartie sehr ausgeprägtes Vibrato, aber bei den vielen temperamentvollen, dramatischen Ausbrüchen, die dem Sopran abverlangt werden, stört das nicht so sehr, und diese, so wie der Racheschwur, bringen sie nie in Verlegenheit. Fabio Armiliato singt ein dunkel glühendes „Amor ti vieta“, bringt den Hörer zu einem wohligen Erschauern in „la mia viltà“ und ist durchweg akustisch und optisch so präsent, dass man merkt, dass die Partie sich nicht auf den einen Ohrwurm reduzieren lässt. Mit dieser Aufnahme hat das nun leider getrennte Paar seiner Liebe und seiner künstlerischen Zusammenarbeit ein schönes Denkmal gesetzt (Dynamic ). Ingrid Wanja
 Ach ja diese Zauber-Gärten: Wir befinden uns in einem fantastischen Garten. Drei Damen treten auf und umschmeicheln einen hübschen Burschen, der im Schatten eines Baumes eingeschlafen ist. Nein, es handelt sich nicht um den Beginn von Mozarts Zauberflöte, die Damen sind Nymphen im Gefolge der Göttin Diana, der Mann ein Hirte namens Doristo. Die Oper heißt L’arbore di Diana, wurde 1787 in Wien uraufgeführt, der Text stammt von keinem Geringeren als Lorenzo da Ponte, die Musik von Vicent Martin i Soler, einem äußerst populären Zeitgenossen Mozarts. Der so beliebt war, dass der Salzburger Komponist eine Melodie aus dessen „Una cosa rara“ in seinem Don Giovanni zitierte. L’arbore di Diana ist nicht nur ein hübsches, ironisch verpacktes Hohelied auf sinnliche Freuden, sondern auch ein musikalisches Vergnügen, reizvoll instrumentiert, mit ausgedehnten Arien für das hohe Paar Diana/ Endimione, quicklebendigen Buffoszenen und vielen munteren Ensembles, die sich fast immer aus Solonummern entwickeln. Sie besonders machen Spaß in dieser von Harry Bicket mit mitreißendem Schwung und bisweilen aberwitzigem Tempo geleiteten Aufnahme. Da sind die drei Nymphen Ainhoa Garmendia, Marisa Martins und Jossie Perez, die mit wunderbarer Homogenität ihre Terzette vortragen. Oder sich mit dem trefflichen Herrentrio Steve Davislim, Charles Workman und Marco Vinco zu entzückenden Sextetten zusammenfinden, in denen man seine Freude hat am flinken, rhythmisch prononcierten Plappern, Wispern und Gurren. Beherrscht werden sie von der Diana Laura Aikins, die sich am Anfang mit feurigen Koloraturen, höchsten, mühelos abgeschossenen Spitzennoten und einem expressiven Furor als dominante Männer Verachtende effektvoll in Szene setzt, im zweiten Teil dann aber auch zu weicheren Tönen findet. Dass sie ihr Herz für den seine Soli kultiviert und geschliffen singenden Endimione von Steve Davislim entdeckt, ist vokal nur zu verständlich, zumal der zweite Tenor Charles Workman sängerisch weniger umfangreich bedacht ist und Marco Vinco, der als Doristo alle Bufforegister zieht, als Partner nicht in Frage kommt. Über allen wacht der Amor, dem Michael Maniaci nicht nur Keckheit und einen süßen männlichen Sopran leiht, sondern der auch zuständig ist für manch Zaubereien. Das ist ein weiteres Plus der Aufnahme: die lebendige Atmosphäre, die mit Theaterdonner und auch beim Hören anschaulichen Bühnengeräuschen einhergeht (Dynamic, CDS 651/1-2). K. C.
Ach ja diese Zauber-Gärten: Wir befinden uns in einem fantastischen Garten. Drei Damen treten auf und umschmeicheln einen hübschen Burschen, der im Schatten eines Baumes eingeschlafen ist. Nein, es handelt sich nicht um den Beginn von Mozarts Zauberflöte, die Damen sind Nymphen im Gefolge der Göttin Diana, der Mann ein Hirte namens Doristo. Die Oper heißt L’arbore di Diana, wurde 1787 in Wien uraufgeführt, der Text stammt von keinem Geringeren als Lorenzo da Ponte, die Musik von Vicent Martin i Soler, einem äußerst populären Zeitgenossen Mozarts. Der so beliebt war, dass der Salzburger Komponist eine Melodie aus dessen „Una cosa rara“ in seinem Don Giovanni zitierte. L’arbore di Diana ist nicht nur ein hübsches, ironisch verpacktes Hohelied auf sinnliche Freuden, sondern auch ein musikalisches Vergnügen, reizvoll instrumentiert, mit ausgedehnten Arien für das hohe Paar Diana/ Endimione, quicklebendigen Buffoszenen und vielen munteren Ensembles, die sich fast immer aus Solonummern entwickeln. Sie besonders machen Spaß in dieser von Harry Bicket mit mitreißendem Schwung und bisweilen aberwitzigem Tempo geleiteten Aufnahme. Da sind die drei Nymphen Ainhoa Garmendia, Marisa Martins und Jossie Perez, die mit wunderbarer Homogenität ihre Terzette vortragen. Oder sich mit dem trefflichen Herrentrio Steve Davislim, Charles Workman und Marco Vinco zu entzückenden Sextetten zusammenfinden, in denen man seine Freude hat am flinken, rhythmisch prononcierten Plappern, Wispern und Gurren. Beherrscht werden sie von der Diana Laura Aikins, die sich am Anfang mit feurigen Koloraturen, höchsten, mühelos abgeschossenen Spitzennoten und einem expressiven Furor als dominante Männer Verachtende effektvoll in Szene setzt, im zweiten Teil dann aber auch zu weicheren Tönen findet. Dass sie ihr Herz für den seine Soli kultiviert und geschliffen singenden Endimione von Steve Davislim entdeckt, ist vokal nur zu verständlich, zumal der zweite Tenor Charles Workman sängerisch weniger umfangreich bedacht ist und Marco Vinco, der als Doristo alle Bufforegister zieht, als Partner nicht in Frage kommt. Über allen wacht der Amor, dem Michael Maniaci nicht nur Keckheit und einen süßen männlichen Sopran leiht, sondern der auch zuständig ist für manch Zaubereien. Das ist ein weiteres Plus der Aufnahme: die lebendige Atmosphäre, die mit Theaterdonner und auch beim Hören anschaulichen Bühnengeräuschen einhergeht (Dynamic, CDS 651/1-2). K. C.
Italienische Festspieldokumente: Auf einige Veröffentlichungen von DYNAMIC, welche Festspielaufführungen in Martina Franca und Pesaro zwischen 2001 und 2012 dokumentiert haben, soll hier noch einmal hingewiesen werden.
Vom Rossini Festival 2007 stammt der Live-Mitschnitt des Melodramma La gazza ladra auf drei CDs (CDS 567/1-3). Für die Geschichte um eine diebische Elster, die für allerlei Verwirrungen sorgt und das vermeintlich schuldige Dienstmädchen Ninetta ins Gefängnis bringt, hat Rossini eine spritzige Musik erdacht, die Lü Jia mit dem Orchestra Haydn di Bolzano e Trento sprühen und funkeln lässt. Die Sinfonia mit ihrem einleitenden Trommelwirbel zählt bis heute zu den beliebtesten Wunschkonzertnummern. Hier hört man sie in wirkungsvoller accelerando-Steigerung. Der Prague Chamber Choir (Lubomír Mátl) absolviert seine Auftritte engagiert und munter.
 Die Besetzung vereint mehrere Rossini-Koryphäen, so Paolo Bordogna als reicher Pächter Fabrizio – ein beim ROF vielfach erprobter Buffo-Haudegen, der viel aus den Rezitativen herauszuholen weiß. Im Duett mit Ninetta, „Per questo amplesso“, kann er in den plappernden Passagen seine Trümpfe effektvoll ausspielen. Regelmäßig sind die beiden Bässe Alex Esposito und Michele Pertusi auf den Besetzungslisten des ROF zu finden. Ersterer gibt Ninettas Vater Fernando mit virilem Timbre und stupender Geläufigkeit, zweiter den Podestà Gottardo mit autoritärem Duktus, aber aufgerautem Ton. Auch Dmitry Korchak ist ein gern gesehener Gast an der Adria. Als Fabrizios Sohn Gianetto führt sich der Tenor mit dem schwärmerischen „Vieni fra queste braccia“ ein, das ihm sogleich Noten in der Extremhöhe abverlangt. Bei seiner Szene im 2. Akt, „Aspettate“, hat die Stimme mehr Glanz.
Die Besetzung vereint mehrere Rossini-Koryphäen, so Paolo Bordogna als reicher Pächter Fabrizio – ein beim ROF vielfach erprobter Buffo-Haudegen, der viel aus den Rezitativen herauszuholen weiß. Im Duett mit Ninetta, „Per questo amplesso“, kann er in den plappernden Passagen seine Trümpfe effektvoll ausspielen. Regelmäßig sind die beiden Bässe Alex Esposito und Michele Pertusi auf den Besetzungslisten des ROF zu finden. Ersterer gibt Ninettas Vater Fernando mit virilem Timbre und stupender Geläufigkeit, zweiter den Podestà Gottardo mit autoritärem Duktus, aber aufgerautem Ton. Auch Dmitry Korchak ist ein gern gesehener Gast an der Adria. Als Fabrizios Sohn Gianetto führt sich der Tenor mit dem schwärmerischen „Vieni fra queste braccia“ ein, das ihm sogleich Noten in der Extremhöhe abverlangt. Bei seiner Szene im 2. Akt, „Aspettate“, hat die Stimme mehr Glanz.
Die spanische Sopranistin Mariola Cantarero kennt man eher von Aufführungen am Gran Teatre del Liceu in Barcelona und am Teatro Real von Madrid. Hier ist sie als Ninetta zu hören. Ihr Sopran hat oft einen säuerlichen Beiklang, besitzt aber die nötige Flexibilität für das Zierwerk der Partie. Die Besetzung komplettieren Kleopatra Papatheologou als Fabrizios Frau Lucia mit angenehmem, eloquentem Mezzo, Cosimo Panozzo als Kerkermeister Antonio mit charaktervollem Tenor sowie Manuela Custer in der Hosenrolle von Fabrizios Diener Pippo mit getrübtem Mezzo.
 Beim Festival della Valle d’Itria gab es 2001 ein selten anzutreffendes Werk mit Musik Rossinis in der Bearbeitung/Edition von Antonio Pacini, einem Accolat des in Paris im Alterssitz residierenden Meisters, zu hören – das Pastiche Ivanhoé auf ein neues französisches Libretto nach Scott von Emile Deschamps und Gabriel-Gustave de Wailly –, welches auf zwei CDs herausgebracht wurde (CDS 397/1-2/ wenig später gab die Oper von Montpellier das Ganze noch einmal konzertant – seitdem ist es wieder verschwunden). Mit Billigung des Komponisten hatte Pacini (nicht zu verwechseln mit dem Komponisten Giovanni Pacini) für diese Kreation Motive aus Rossinis Opern La Cenerentola, Bianca e Faliero, Aureliano in Palmira, La gazza ladra, Tancredi, Semiramide u. a. zusammengestellt, um mit der „Neuschöpfung“ noch einmal die riesige Nachfrage nach einer neuen Oper Rossinis zu befriedigen. Paolo Arrivabeni am Pult des Orchestra Internazionale d’Italia bietet schon in der Overture (der Semiramide entnommen) stimmungsvolle und spannende Momente, die sich auch später immer wieder einstellen. Der Coro da Camera di Bratislava (Pavol Procházka) beweist in den temporeichen Chören (u. a. aus der Cenerentola und La gazza ladra) Eloquenz und Musikalität.
Beim Festival della Valle d’Itria gab es 2001 ein selten anzutreffendes Werk mit Musik Rossinis in der Bearbeitung/Edition von Antonio Pacini, einem Accolat des in Paris im Alterssitz residierenden Meisters, zu hören – das Pastiche Ivanhoé auf ein neues französisches Libretto nach Scott von Emile Deschamps und Gabriel-Gustave de Wailly –, welches auf zwei CDs herausgebracht wurde (CDS 397/1-2/ wenig später gab die Oper von Montpellier das Ganze noch einmal konzertant – seitdem ist es wieder verschwunden). Mit Billigung des Komponisten hatte Pacini (nicht zu verwechseln mit dem Komponisten Giovanni Pacini) für diese Kreation Motive aus Rossinis Opern La Cenerentola, Bianca e Faliero, Aureliano in Palmira, La gazza ladra, Tancredi, Semiramide u. a. zusammengestellt, um mit der „Neuschöpfung“ noch einmal die riesige Nachfrage nach einer neuen Oper Rossinis zu befriedigen. Paolo Arrivabeni am Pult des Orchestra Internazionale d’Italia bietet schon in der Overture (der Semiramide entnommen) stimmungsvolle und spannende Momente, die sich auch später immer wieder einstellen. Der Coro da Camera di Bratislava (Pavol Procházka) beweist in den temporeichen Chören (u. a. aus der Cenerentola und La gazza ladra) Eloquenz und Musikalität.
Die Besetzung vereint hierzulande weniger prominente Namen. In der Titelpartie ist der Tenor Simon Edwards zu hören. Sein träumerischer Auftritt („Blessé sur la terre étrangère“) ist Bianca e Faliero entnommen. Die Stimme von weicher Textur und zärtlichem Ausdruck ist für das französische Idiom durchaus passend. Nur die exponierten Töne fallen aus der Linie heraus. Ivanhoés Herz gehört Leila, die ihn einst als verwundeten Ritter gepflegt hat. Sie ist die Tochter Ismaels (Filippo Morace mit resonantem Bariton) und wird von Inga Balabanova mit apartem Sopran von dunkler Tönung gesungen. Zu Beginn des 2. Aktes lässt sie bei ihrem Liebesbekenntnis für Ivanhoé melancholisch umflorten Gesang hören. Leila wird auch von dem Normannen Boisguilbert begehrt, den Soon-Won Kang mit profunden und auftrumpfenden Basstönen ausstattet.
Ivanhoés Vater Cedric ist der Bariton Massimiliano Chiarolla, der im Finale (aus Torvaldo e Dorliska) die Verbindung seines Sohnes mit Leila segnet.
2007 stand der Palazzo Ducale in Martina Franca ganz im Zeichen des italienischen Barock, als Domenico Sarros Dramma per musica Achille in Sciro gezeigt wurde. 1737 hatte es Premiere zur Eröffnung des berühmten Teatro San Carlo in Neapel unter Mitwirkung gefeierter Primadonnen und Soprankastraten. Der Mitschnitt vom Festival della Valle d’Itria auf drei CDs (CDS 571/1-3) weist natürlich solche Legenden nicht auf, auch das Orchestra Internazionale d’Italia ist kein spezialisierter Klangkörper auf historischen Instrumenten. Mit Federico Maria Sardelli steht jedoch ein ausgewiesener Kenner der Barockmusik an dessen Pult. Er sorgt schon in der festlichen Sinfonia für Aufmerksamkeit und weiß vor allem die Sänger aufmerksam zu stützen. Ein Glanzlicht setzt er mit der pompösen Bläserbegleitung des Chores „Lungi, lungi“ im 2. Akt, in welchem der Bratislava Chamber Choir (Pavol Procházka) brilliert.
In der Titelrolle ist Gabriella Martellacci mit resolut-strengem Mezzo zu hören. In „Risponderti vorrei“ oder der von der obligaten Mandoline begleiteten Arie „Se un core“ im 2. Akt bietet sie auch anmutige Klänge. Als Frau verkleidet, weilt Achille am Hof von Licomede, König von Skyros (Marcello Nardis mit zu buffonesk klingender Stimme und technischen Problemen). Dessen Tochter Deidamia ist in ihn verliebt. Maria Laura Martorana überzeugt schon in der mit Koloraturen und Extremtönen gespickten Auftrittsarie „No, ingrato“. Mit den vehementen Gefühlsausbrüchen in „Del sen gli ardor“ und „Non vedi“ erringt sie die Palme der Besetzung. Auf Befehl ihres Vaters soll sie Teagene (der Sopranist Massimiliano Arizzi mit substanzreicher Stimme und technischer Virtuosität) heiraten, wogegen sie sich weigert. Ulisse (der Tenor Francisco Ruben Brito mit bemühten Koloraturen und limitierter Höhe) erscheint und fordert Achille, den er erkannt hat, auf, ihm in den Trojanischen Krieg zu folgen. Der Höfling Nearco (Eufemia Tufano mit androgynem Stimmklang) versucht ihn zurückzuhalten. Deidamia ist verzweifelt über die Abreise ihres Geliebten („Ah perfido!“). Doch im 3. Akt kommt das klassische lieto fine, denn der König gibt Deidamia Achille zur Frau, was der Chor mit „Ecco, felici amanti“ preist. Aufhorchen lässt die Sopranistin Dolores Carlucci in der Nebenrolle des Arcade durch ihre brillanten Verzierungen und glitzernden staccati in der Arie „Si varia in ciel talora“.
Als jüngstes Dokument unserer Auswahl wurde im Juli 2012 Johann Adolf Hasses Dramma per musica Artaserse aufgezeichnet und auf drei CDs veröffentlicht (CDS 7715/1-3). Das Libretto stammt von Metastasio und wurde mehrfach vertont, u. a. von Gluck, Jommelli, Vinci und Galuppi. Die Version von Hasse zeichnet sich durch besonders hohe und anspruchsvolle Virtuosität aus. Die Besetzung der Uraufführung in Venedig 1730 zierten illustre Namen: Farinelli und Francesca Cuzzoni als die Liebenden Arbace und Mandane. Das Geschehen kreist um den persischen General Artabano, der König Serse erschlagen hat und seinen Sohn Arbace der Tat bezichtigt. Der persische Prinz Artaserse vermag seinen Jugendfreund jedoch nicht zu verurteilen und lässt ihn frei. Am Ende nimmt er Artabanos Tochter Semira zur Gemahlin und verbindet Arbace mit Artaserses Schwester Mandane.
Die Aufführung der Erstfassung von 1730 in Martina Franca hält einen frühen Auftritt von Franco Fagioli fest, der damals noch nicht jenen Ausnahmestatus unter den Countertenören besaß, wie er ihm heute zusteht. Mit dem Arsace hat er die Farinelli-Partie mit nicht weniger als fünf Auftritten zu bewältigen. Der erste, „Fra cento affanni“, umspannt einen weiten Radius, auffällig ist die effektvolle Tiefe, während die Spitzentöne noch nicht den späteren Aplomb aufweisen. Das zweite Solo, „Se al labbro“ am Ende des 1. Aktes, ist von schöner Kantabilität und tiefer Erfindung. Der sinnliche Reiz der Stimme kommt hier zu starker Wirkung. Auch „Lascia cadermi in volto“ zu Beginn des 2. Aktes ist ein getragenes, eher introvertiertes Stück, in welchem Fagioli zärtlich-weiche Töne hören lässt. Das sanft wiegende „Per questo dolce amplesso“ zählt zu jenen Arien, welche Farinelli dem depressiven spanischen König Filipe V. in Madrid vortrug und lässt Fagiolis Stimme in ihrem schmeichelnden Duktus wunderbar aufleuchten. Im 3. Akt gibt es mit „Parto qual pastorello“ eine jener stürmischen Bravourarien, welche Höhe und Tiefe effektvoll ausreizt und mit heftigen Koloraturläufen dem Interpreten alles abverlangt – ein cavallo di battaglia für den Argentinier, das verdienten Beifallssturm auslöst. Und im letzten Akt hat er noch das Duett mit Mandane, „Tu vuoi ch’io viva “, in welchem sich beider Stimmen mit raffinierten abbellimenti kunstvoll verschlingen.
Die Sopranistin Maria Grazia Schiavo – keine Unbekannte im Barock-Repertoire – nimmt die lyrische Cuzzoni-Partie der Mandane wahr. Das Timbre der Italienerin ist recht allgemein, ihre Technik solide, die Interpretation insgesamt wenig memorabel. Nur am Ende des 2. Aktes lässt beim furiosen „Va’ tra le selve ircane“ mit dem rasenden Ausdruck aufhorchen.
Auch Sonia Prina ist eine feste Größe im internationalen Barock-Geschehen. Ihr robust-erdiger Alt und die eigenwillige Koloraturtechnik, wie schon bei Artabanos resolutem Auftritt mit „S’impugni la spada“ zu vernehmen, sind allerdings gewöhnungsbedürftig. Aber ihre Soli finden beim Publikum großen Anklang, so am Ende des 2. Aktes das kosende„Pallido sole“, welches ebenfalls zu Farinellis Auswahl für Filipe V. gehörte.
Die weniger fordernde Titelpartie ist mit dem Tenor Anicio Zorzi Giustiniani solide besetzt, die Nebenrolle des Generals Megabise mit dem Counter Antonio Giovannini. Rosa Bove komplettiert den Cast als Semira mit beherztem Alt. Am Ende vereinen sich alle Sänger zum jubelnden Schlusschor „Giusto Re la Persia adora“.
Das regelmäßig in Martina Franca eingesetzte Orchestra Internazionale d’Italia wird geleitet von Corrado Rovaris, der schon in der Sinfonia für Drive sorgt und auch danach Affekt betonte Akzente setzt. Bernd Hoppe
 Stünde über der Partitur von Saverio Mercadantes Oper Pelagio der Name Giuseppe Verdis, dann würde das Werk sicherlich wesentlich öfter aufgeführt worden sein, hätte nicht auf die Fleißarbeit von Dirigent Mariano Rivas und das experimentierfreudige Festival della Valle d’Itria in Martina Franca warten müssen, das sich schon des Komponisten Oper IL Bravo angenommen hatte. In vielem an die Opern der Galeerenjahre des Komponisten aus Busseto erinnert das effektvolle Musikstück mit Rollen, die einen Verdibariton und einen Sopran ähnlich wie den für die Elvira aus Ernani erfordern. Die Handlung führt in das Spanien der ersten Versuche einer Reconquista, die ihren Höhe- und Endpunkt mit dem Erscheinen des Cid finden wird. Der Komponist lebte selbst jahrelang in Spanien und war mit dessen Geschichte vertraut. Die Uraufführung dieses seines letzten Werks in Neapel war ein Riesenerfolg. Die Partitur ging bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg verloren, aus einer kaum lesbaren Abschrift in Neapel und einer solchen aus Spanien entwickelte Mariano Rivas die Fassung für Martina Franca.
Stünde über der Partitur von Saverio Mercadantes Oper Pelagio der Name Giuseppe Verdis, dann würde das Werk sicherlich wesentlich öfter aufgeführt worden sein, hätte nicht auf die Fleißarbeit von Dirigent Mariano Rivas und das experimentierfreudige Festival della Valle d’Itria in Martina Franca warten müssen, das sich schon des Komponisten Oper IL Bravo angenommen hatte. In vielem an die Opern der Galeerenjahre des Komponisten aus Busseto erinnert das effektvolle Musikstück mit Rollen, die einen Verdibariton und einen Sopran ähnlich wie den für die Elvira aus Ernani erfordern. Die Handlung führt in das Spanien der ersten Versuche einer Reconquista, die ihren Höhe- und Endpunkt mit dem Erscheinen des Cid finden wird. Der Komponist lebte selbst jahrelang in Spanien und war mit dessen Geschichte vertraut. Die Uraufführung dieses seines letzten Werks in Neapel war ein Riesenerfolg. Die Partitur ging bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg verloren, aus einer kaum lesbaren Abschrift in Neapel und einer solchen aus Spanien entwickelte Mariano Rivas die Fassung für Martina Franca.
Bianca, Tochter des spanischen Adligen Pelagio, glaubt ihren Vater tot, will mit der Heirat des maurischen Prinzen Abdel-Aor die beiden Religionen miteinander versöhnen. Als ihr Vater, der sie ihrerseits verstorben glaubte, davon hört, will er die Hochzeit verhindern. Als Bianca ihm nicht folgt, verflucht er sie, auch Abdel-Aor wendet sich von ihr ab, weil er glaubt, sie stehe auf der Seite ihres Vaters. Pelagio wird beim Sturm auf die Burg des Mauren gefangen genommen, dieser will ihn töten, was Bianca verhindert. Nun ist sein Misstrauen erwacht, er sieht in ihr eine Verräterin und ersticht sie, als er davon hört, dass sein Widersacher aus der Burg entfliehen konnte. Pelagio erobert mit den Seinen die Burg, Bianca stirbt in seinen Armen und der Vater schwört den Mauren ewige Rache. Die Geschichte spielte vor einigen hundert Jahren, doch das Problem ist ein durchaus heutiges, Ehrenmorde sind nicht nur von gestern.
Die Oper hat drei so dankbare wie anspruchsvolle Partien. Costantino Finucci verfügt über eine ausgesprochen gute Diktion, was für den Hörer, der das Libretto aus dem Internet herunterladen müsste, sehr nützlich ist. Die Stimme ist wie aus einem Guss, die Höhe gut, etwas holprig bewegt der Sänger sich in den Verzierungen, recht zittrig beginnt „Io non aveva più lacrime“, was vielleicht durch den Gemütszustand, in dem sich der Vater befindet, mitbedingt ist. Eine Aufsehen erregende Fermate versöhnt, allerdings nicht die folgende , gaumig klingende Cabaletta, in der die einheitliche Linie fehlt. Man kann sich den Sänger auch als soliden Verdi-Bariton vorstellen.
Mit ihrem umfangreichen Tonumfang ist die Bianca ebenfalls eine anspruchsvolle Rolle, der die dunkle Mittellage von Clara Polito gut ansteht. Die Intonation ist nicht immer eine sichere, aber die Sängerin erfreut durch raffinierte Sfumaturen, kann schillernd und ausgesprochen apart klingen und meistert die Intervallsprünge sicher. Sehr schön singt sie ihr Gebet im letzten Akt, „D’un infelice oh ciel“, erfreut mit innigem canto elegiaco.
Der Tenor Danilo Formaggia kämpft mit der hohen Tessitura des Abdel-Aor., sein Gesang klingt streckenweise unstet, in der Höhe oft eng, gut gelingt ihm der Schluss des zweiten Akts, ein erregtes Rezitativ gelingt ihm gut mit „Ch’ella non osi offrirsi“, aber insgesamt erscheint der Tenor einfach zu flach, zu eindimensional für die Partie zu sein.
Weder vom Chor aus der Slowakei noch vom Orchestra Internazionale d’Italia hört man Sensationelles, noch von einer Aufnahme aus dem akustisch schwierigen Innenhof des Palazzo Ducale, aber was Mariano Rivas trotz widriger Umstände auf die Beine gestellt hat, ist aller Ehren wert und das Werk auf jeden Fall einer größeren Beachtung, als sie ihm bisher, es gab noch eine Aufführung am Ort des Geschehens in jüngerer Zeit, zuteil wurde (Dynamic CDS 636/1-2). Ingrid Wanja
 Der Tod ist weiblich: Jeder für sich war ein begabter Komponist, aber zu Höchstleistungen waren sie wohl nur in gemeinsamer Anstrengung fähig die Brüder Luigi und Federico Ricci, deren letzte von vier Opern, Crispino e la Comare, ein Riesenerfolg war, der bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts andauerte, und auch in jüngster Vergangenheit gab es hin und wieder Aufführungen, so in Bad Aibling, beim Festival in Wexford, in einem kleinen Theater in New York, in Venedig, Neapel (woher die CD bei Bongiovanni von 1989 stammt) und 2013 beim Festival della Valle d’Itria in Martina Franca, wovon es eine DVD und eine CD gibt. Stoff für eine Oper, wenngleich nicht für eine opera buffa oder vielmehr ein Melodramma fantastico-giocoso hätte auch das Leben zumindest eines der Brüder hergegeben, das Luigis, der eine von zwei Zwillingsschwestern heiratete und sich die andere als Geliebte hielt, die ihn beide zum Vater machten. Das wäre aber wohl selbst einem so phantasiereichen Librettisten wie Francesco Maria Piave, vielfacher Textschreiber auch für Giuseppe Verdi, zu viel an Verwicklungen gewesen. Dafür wartet das Werk der Gebrüder Ricci mit einer Besonderheit für die italienische Oper auf, ohne die kaum eine deutsche Oper des 19.Jahrhunderts auskam: das Wirken überirdischer Kräfte auf das Schicksal der Menschen. La Comare nämlich ist der Tod persönlich, la Morte, wie er im Unterschied zu unseren Breiten in romanischen Ländern mit weiblichem Artikel bedacht wird. Eine weitere Besonderheit von Crispino ist, dass, obwohl letztendlich eine opera buffa, tatsächlich ein Mensch im Verlauf der Handlung stirbt, allerdings geschieht das, damit ein Liebespaar endlich zueinander finden kann.
Der Tod ist weiblich: Jeder für sich war ein begabter Komponist, aber zu Höchstleistungen waren sie wohl nur in gemeinsamer Anstrengung fähig die Brüder Luigi und Federico Ricci, deren letzte von vier Opern, Crispino e la Comare, ein Riesenerfolg war, der bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts andauerte, und auch in jüngster Vergangenheit gab es hin und wieder Aufführungen, so in Bad Aibling, beim Festival in Wexford, in einem kleinen Theater in New York, in Venedig, Neapel (woher die CD bei Bongiovanni von 1989 stammt) und 2013 beim Festival della Valle d’Itria in Martina Franca, wovon es eine DVD und eine CD gibt. Stoff für eine Oper, wenngleich nicht für eine opera buffa oder vielmehr ein Melodramma fantastico-giocoso hätte auch das Leben zumindest eines der Brüder hergegeben, das Luigis, der eine von zwei Zwillingsschwestern heiratete und sich die andere als Geliebte hielt, die ihn beide zum Vater machten. Das wäre aber wohl selbst einem so phantasiereichen Librettisten wie Francesco Maria Piave, vielfacher Textschreiber auch für Giuseppe Verdi, zu viel an Verwicklungen gewesen. Dafür wartet das Werk der Gebrüder Ricci mit einer Besonderheit für die italienische Oper auf, ohne die kaum eine deutsche Oper des 19.Jahrhunderts auskam: das Wirken überirdischer Kräfte auf das Schicksal der Menschen. La Comare nämlich ist der Tod persönlich, la Morte, wie er im Unterschied zu unseren Breiten in romanischen Ländern mit weiblichem Artikel bedacht wird. Eine weitere Besonderheit von Crispino ist, dass, obwohl letztendlich eine opera buffa, tatsächlich ein Mensch im Verlauf der Handlung stirbt, allerdings geschieht das, damit ein Liebespaar endlich zueinander finden kann.
Die Musik ist höchst eingängig und erfindungsreich, man meint von einer neapolitanischen Canzone zur nächsten geführt zu werden, vermerkt Einflüsse Rossinis, und die Musik scheint unaufhörlich zum Tanzen aufzufordern. Obwohl die männlichen Partien weit überwiegen, der Herrenchor stets präsent ist, ist die anspruchsvollste und dankbarste Rolle einem Sopran vorbehalten, Annetta, der Gattin des Titelhelden, die von Sängerinnen wie Adelina Patti, Luisa Tetrazzini oder Amelita Galli Curzi gesungen wurde. In Martina Franca verkörpert sie Stefania Bonfadelli, ein aufstrebender Stern am Opernhimmel, besonders als Traviata und Lucia, von vielen Gesangskrisen verfolgt und inzwischen als Regisseurin, so auch in Martina Franca, tätig.
Dem nichtitalienischen Opernfreund sei dringend die DVD anstelle der CD empfohlen, denn wenn der Sprachkundige durchaus auch ohne Libretto viel vom Text dank der gut artikulierenden Sänger versteht, ist jeder andere Hörer hilf- und ratlos, da das Booklet zwar einen guten einführenden Artikel, aber zur Trackliste keine Namen, zum Personenverzeichnis nur Vornamen der Rollen, nicht ihre Funktion in der Oper liefert oder das Stimmfach angibt und die Inhaltsangabe nicht trennt zwischen dem, was wirklich auf der Bühne geschieht, und dem, was vorausgegangen ist.
Crispino ist ein armer Schuster, seine Frau verkauft Geschichten und Lieder. Als die Schulden übermächtig werden, will sich Crispino ertränken, La Comare, der Tod, erscheint und verleiht ihm die Fähigkeit, vorauszusagen, welcher Kranke sterben, welcher geheilt werden wird. So kann der Schuster den allwissenden Arzt spielen, verhilft dadurch einem Liebespaar zu seinem Glück, verändert aber seinen Charakter zum Schlechten. Als der Tod ihm sein erlöschendes Lebenslicht zeigt, bittet er um Aufschub, erhält ihn und wird wohl nun ein vorbildliches Leben führen.
 Wie bereits gesagt, ist die der Annetta die herausragende Gesangspartie. Stefania Bonfadelli meistert die schwierigen Koloraturen mit duftig und kapriziös klingendem Sopran, manchmal etwas gläsern oder scharf klingend, niedliche Koketterie vermittelnd, mit einem innigen Gebet “Nume benefico salva Crispino“ erfreuend und sehr virtuos in „Io non sono più Annetta“ auftrumpfend. Anspruchsvoll ist auch die Tenorpartie des Contino del Fiore, den Fabrizio Paesano mit klarem tenore di grazia, der auch mal zum Charaktertenor mutieren kann, singt. Sein „Bella come un angelo“ ist nicht zu verwechseln mit Don Pasquale, aber ähnlich gefühlvoll. Ein munteres Krähen ist sein Kennzeichen bei guter Laune. Romina Boscolo gibt mit so verführerischem wie bedrohlich klingendem Mezzosopran-Sirenenklang die Tödin. Den Schalk in der Stimme hat Domenico Colaianni für die Titelpartie, sein Bariton besticht eher durch Flexibilität und eine vorbildliche Diktion als durch Schönheit, italienische Buffotradition wird mit ihm eindrucksvoll fortgeführt. Auch alle anderen Partien sind rollengerecht besetzt. Der Chor des Opernhauses Bari weiß hörbar, was er singt, das Orchestra Internazionale d’Italia unter Jader Bignamini hat mit dieser Aufnahme einen seiner besten Auftritte in seiner inzwischen auch schon langen Geschichte (CDS 7675/1-2). Ingrid Wanja
Wie bereits gesagt, ist die der Annetta die herausragende Gesangspartie. Stefania Bonfadelli meistert die schwierigen Koloraturen mit duftig und kapriziös klingendem Sopran, manchmal etwas gläsern oder scharf klingend, niedliche Koketterie vermittelnd, mit einem innigen Gebet “Nume benefico salva Crispino“ erfreuend und sehr virtuos in „Io non sono più Annetta“ auftrumpfend. Anspruchsvoll ist auch die Tenorpartie des Contino del Fiore, den Fabrizio Paesano mit klarem tenore di grazia, der auch mal zum Charaktertenor mutieren kann, singt. Sein „Bella come un angelo“ ist nicht zu verwechseln mit Don Pasquale, aber ähnlich gefühlvoll. Ein munteres Krähen ist sein Kennzeichen bei guter Laune. Romina Boscolo gibt mit so verführerischem wie bedrohlich klingendem Mezzosopran-Sirenenklang die Tödin. Den Schalk in der Stimme hat Domenico Colaianni für die Titelpartie, sein Bariton besticht eher durch Flexibilität und eine vorbildliche Diktion als durch Schönheit, italienische Buffotradition wird mit ihm eindrucksvoll fortgeführt. Auch alle anderen Partien sind rollengerecht besetzt. Der Chor des Opernhauses Bari weiß hörbar, was er singt, das Orchestra Internazionale d’Italia unter Jader Bignamini hat mit dieser Aufnahme einen seiner besten Auftritte in seiner inzwischen auch schon langen Geschichte (CDS 7675/1-2). Ingrid Wanja
Kein Meisterwerk: Es kommt nicht oft vor, dass im Booklet zu einer Opern-CD ein anderes Werk, das denselben Stoff als Grundlage hat, gelobt und zur Aufführung empfohlen wird. So geschehen aber mit Albert Lortzings Zar und Zimmermann, die Donizettis l Borgomastro di Saardam gegenübergestellt werden. Tatsächlich war der deutsche Komponist gut beraten, sein eigener Textdichter zu sein, denn gerade die populärsten Nummern und Handlungsstränge in seiner Oper, die Einstudierung der Kantate zum Ruhme des Zaren, der Wettstreit der beiden Gesandten um die Gunst des Zaren, der Holzschuhtanz, die Reflexion des Zaren über sein Leben als Herrscher oder das charmante „Lebe wohl, mein flandrisch Mädchen“ haben keine Entsprechung bei Donizetti, der sich sein Libretto von Domenico Gilardoni zurechtschustern ließ und eine Nullachtfünfzehn-Buffa-Handlung erhielt mit einer abschließenden Bravourarie für den Sopran und einer seconda donna ohne dramaturgischen Sinn. Das mag damit zu tun haben, dass der einzige Star bei der Mailänder Premiere, die auf die in Neapel folgte und ein Riesenreinfall war, die Sängerin Carolina Ungher war. Das erste Finale hingegen bietet dem Hörer den üblichen Plapperunsinn, von russischem oder holländischem Kolorit keine Spur.
Immerhin gab es 1973 im Handlungsort Zaadam eine Aufführung mit Renato Capecchi in der Titelpartie, und das Donizetti-Festival in Bergamo, woher die hier besprochene Aufnahme stammt, lässt es sich natürlich nicht nehmen, alles, was der Sohn der Stadt komponiert hat, auch aufzuführen. Selbstverständlich übernahm man hier nicht die im neapolitanischen Dialekt geschriebene Fassung, sondern die aus Mailand von 1828, revidiert von Alberto Sonzogni.
Die Besetzung aus Bergamo ist durchwachsen. Giorgio Caoduro hat für den Zaren immerhin einen markanten Bariton, mit herrscherlicher Attitüde erfolgreich eingesetzt, in den Koloraturen etwas meckernd, eindrucksvoll wird „Vili! Qual folle ardite“, durch die Cabaletta stolpert der Sänger eher, als dass er lustvoll gestaltet. Ein typischer Donizetti-Tenor ist Juan Francisco Gateli, in der Mittellage recht flach klingend, sehr hübsch hingegen im Duett über die Liebe mit dem Zaren , und mit „Allor che tutto tace“ gewinnt er hörbar an corpo und damit vokaler Präsenz. Einen satten Bass setzt Andrea Concetti für den Bürgermeister, der hier Wambett heißt und sein Mündel heiraten will, ein, die Prestissimo-Passagen beherrscht er und in „Ma se son proprio un asino“ kann er sogar etwas an „Ja, ich bin klug und weise“ erinnern. Der Vertraute des Zaren namens Leforte ist Pietro Di Bianco mit sonorer Stimme, einen Intrigentenor hat Pasquale Scircoli für die Partie des Ali Mahmed.
Einen recht ältlich klingenden Mezzo setzt Aya Wakizono für die Carlotta ein, die weibliche Hauptrolle ist die der Marietta, für die Irina Dubrovskaja eine frische Soubrettenstimme hat, eine kristallklare Höhe und die notwendige Virtuosität für den Schluss.
Zum Glück war mit Roberto Rizzi Brignoli ein erfahrener Dirigent gewonnen worden, der das muntere, aber unspezifische Werk sicher durch die Vorstellung führt, der Chor, ob nur Herren- oder Gesamtchor, schlägt sich ebenfalls wacker, aber auch sie können dem Hörer nicht weismachen, dass es sich mit diesem um eines der bedeutenden Werke Donizettis handelt (Dynamic CDS 7812.02). Ingrid Wanja
(Weitere Information zu den CDs/DVDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de.)
.



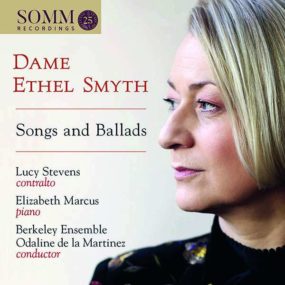 In den letzten Jahren werden die Werke von
In den letzten Jahren werden die Werke von 
 Norma mit zwei Sopranen:
Norma mit zwei Sopranen: Eher wohl die Verkleinerungsform Operchen als die Gattungsbezeichnung Operette ist im italienischen Booklet zur „operetta“
Eher wohl die Verkleinerungsform Operchen als die Gattungsbezeichnung Operette ist im italienischen Booklet zur „operetta“  Man könnte sich beim Erleben von Giordanos
Man könnte sich beim Erleben von Giordanos  Ach ja diese Zauber-Gärten:
Ach ja diese Zauber-Gärten: Die Besetzung vereint mehrere Rossini-Koryphäen, so
Die Besetzung vereint mehrere Rossini-Koryphäen, so  Beim Festival della
Beim Festival della  Stünde über der Partitur von
Stünde über der Partitur von 
 Wie bereits gesagt, ist die der Annetta die herausragende Gesangspartie.
Wie bereits gesagt, ist die der Annetta die herausragende Gesangspartie. 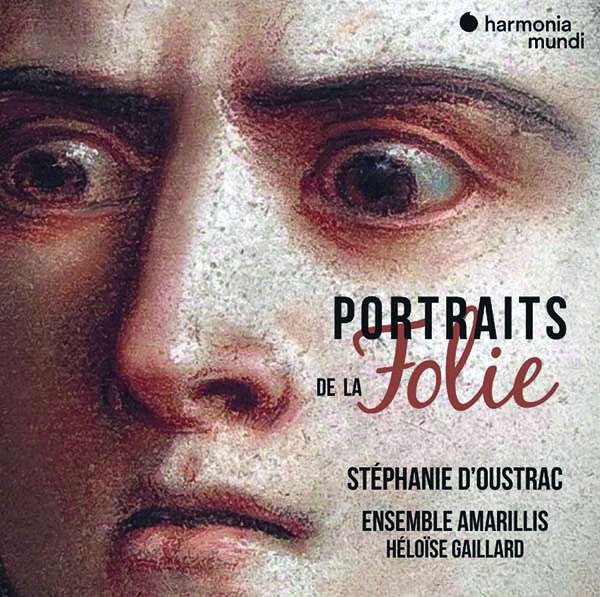
 Ein Jahr danach komponierte Berlioz die von Shakespeares Hamlet inspirierte Ballade „La Mort d’Ophélie“, welche in ihrem Fließen an Schuberts Wasser-Gesänge erinnert. Die Stimme ertönt träumerisch-entrückt, das Klavier steuert poetische Passagen bei.
Ein Jahr danach komponierte Berlioz die von Shakespeares Hamlet inspirierte Ballade „La Mort d’Ophélie“, welche in ihrem Fließen an Schuberts Wasser-Gesänge erinnert. Die Stimme ertönt träumerisch-entrückt, das Klavier steuert poetische Passagen bei.




 Das ist eine ganze Menge, die interpretatorisch und überwiegend auch klanglich noch heute höchsten Ansprüchen genügt. Was nun allerdings die
Das ist eine ganze Menge, die interpretatorisch und überwiegend auch klanglich noch heute höchsten Ansprüchen genügt. Was nun allerdings die