Ein Gespräch über Entwicklung und die Lust, vertraute Rollen immer wieder neu zu vertiefen: Erika Grimaldi steht in Bonn vor einem wichtigen Rollendebüt: als Abigaille in „Nabucco“. Im Interview mit Beat Schmid spricht die Sopranistin unter anderem über die Faszination einer Rolle, in der Stärke und Zerbrechlichkeit unmittelbar nebeneinander stehen, warum für sie alles beim Libretto beginnt, und weshalb Respekt vor dem eigenen Instrument wichtiger ist als jeder Effekt.
.
Frau Grimaldi, Sie geben in einer Neuproduktion von „Nabucco“ ihr Debüt in Bonn und in der Rolle der Abigaille. Was hat Sie an dieser Partie gereizt und wie haben Sie die Rolle vorbereitet? Da ich bereits Lady Macbeth interpretiert habe – eine Rolle, die mir großen Spaß gemacht hat -, hatte ich das Gefühl, dass mich diese Erfahrung in gewisser Weise auch Abigaille näherbringt. Sie ist eine Figur, die sehr weit von dem entfernt ist, wie ich im Alltag bin, und gerade deshalb bietet sie mir die Möglichkeit, über mich hinauszugehen, zu übertreiben und beim Spielen umso größeren Spaß zu haben. Der erste Schritt in der Vorbereitung der Rolle war die Frage, was für eine Frau Abigaille ist und woher ihre Bosheit und ihr Machtstreben kommen, der Wunsch, den Thron zu erobern und sich als Nummer eins durchzusetzen. Deshalb habe ich beim Wesentlichen begonnen: beim Libretto.
.

Erika Grimaldi: Tosca am Teatro Regio di Parma, Credit: Roberto Ricci
Abigaille ist eine widersprüchliche Figur, letztlich die Antagonistin der Oper. Gibt es Momente, in denen Sie Mitgefühl für sie empfinden? Sicherlich ist Abigaille eine der widersprüchlichsten Gestalten der Opernliteratur. Sie ist eine äußerst kämpferische Frau, und trotz all ihrer Aggressivität glaube ich, dass ihre Wut daraus entsteht, dass ihr Liebe fehlt. In ihrem gewaltsamen Handeln steckt der tiefe Wunsch nach einer Art sozialer Rehabilitation.
Es gibt viele Seiten, die man berücksichtigen muss: Zum einen die intime, persönliche Dimension, die mit ihrer Vergangenheit zusammenhängt und der Entdeckung, die Tochter von Sklaven und adoptiert zu sein. Zum anderen ihre politische Ambition, um jeden Preis den Thron zu erobern. Und es fehlt auch nicht der Liebesaspekt: die nicht erwiderte Leidenschaft für Ismaele, die in ihr ein Rachegefühl auslöst, auch gegenüber der Schwester.
Aus diesem Grund weiß ich nicht, ob ich Mitgefühl für sie empfinde, außer am Ende der Oper, kurz vor ihrem Tod, wenn sie um Vergebung bittet und sich ihrer Fehler wirklich bewusst wird. In diesem Moment erwacht die Frau, die sie ursprünglich war, wie auch ihre Kavatine erzählt: einfach, gut, empathiefähig.
.
Es handelt sich in Bonn um eine Neuproduktion: Wie wird Abigaille gezeigt, und wo setzen Sie Ihre persönlichen Akzente? Es ist eine moderne Inszenierung. Die Handlung ist in die Gegenwart verlegt, das Konzept eindeutig zeitgenössisch.
Meine interpretatorischen Akzente sind natürlich von den musikalischen und szenischen Entscheidungen dieser Produktion geprägt, die jedoch der Natur der Figur treu bleiben. Meine Abigaille bewahrt daher ihre gesamte dramatische Kraft und ihre Momente der Verletzlichkeit, so wie es Verdi und das Libretto vorsehen, lediglich in einen anderen Kontext übertragen als den ursprünglichen: in einen modernen, der heutigen Zeit nahen Rahmen.
.
Aus technischer Sicht gilt Abigaille als extreme Partie (Lage, Registerwechsel, Koloraturen, Tiefe und Höhe). Wie gehen Sie diese Rolle stimmlich an? Ich muss sagen, es handelt sich wirklich um eine extreme Partie und meiner Erfahrung nach wahrscheinlich um eine der schwierigsten. Die Schreibweise ist in jeder Hinsicht heikel: Die Koloraturen zum Beispiel haben nichts Leichtes oder Schwebendes, sondern sind dramatisch. Dazu kommt der ständige Wechsel von einem äußerst tiefen in ein äußerst hohes Register, was eine zusätzliche technische und interpretatorische Herausforderung darstellt.
An Sanftem, Zartem oder Lyrischem gibt es fast nichts – abgesehen von wenigen Momenten wie der Kavatine und der finalen Todesszene, die ein intimeres, introspektiveres Intermezzo bieten. Ansonsten ist es eine Rolle, die keine Improvisation zulässt: Man muss sie von Anfang an mit äußerster Sorgfalt angehen, weil sie aus technischer Sicht gefährlich werden kann. Man muss Note für Note, Übergang für Übergang abwägen und sie sich nach und nach aneignen.
.

Erica Grimaldi: Mimì am Teatro Regio di Torino, credit: Edoardo Pica
Seit 2022 haben Sie in fünf große Verdi-Rollen debütiert: Leonora in „Il trovatore“, Leonora in „La forza del destino“, Aida, Lady Macbeth und Amelia in „Un ballo in maschera“. Gab es eine Rolle, die Ihnen die Richtung der Entwicklung Ihrer Stimme besonders deutlich gezeigt hat? Und haben diese Debüts Ihren Blick auf Ihr Instrument verändert? Die erste wirkliche Repertoireveränderung kam mit Leonora im „Trovatore“. Im Nachhinein würde ich diesen Einstand jedoch nicht als echten Wendepunkt bezeichnen, denn es ist eine Rolle, die viel Lyrisches hat und nicht ausgesprochen dramatisch ist. Die wahre Offenbarung war Aida: eine lange, komplexe Rolle, die viele Nuancen vereint und für jeden, der sie zum ersten Mal angeht, einen wirklichen Meilenstein darstellt. Obwohl auch sie eine sehr lyrische Ader hat, hat mir Aida erlaubt, über mich hinauszugehen, und von dort aus kamen Rollen wie Leonora in „La forza del destino“, Lady Macbeth, Amelia in „Un ballo in maschera“ und weitere.
Diese Debüts haben jedoch nie meinen technischen Ansatz oder meinen Blick auf mein Instrument verändert. Ich glaube, jede Stimme durchläuft eine natürliche Entwicklung, die respektiert werden muss, ohne Zwang oder Abkürzungen. Meine Stimme war nicht von Anfang an dramatisch: Ich habe mich diesem Repertoire später genähert, mit mehr Erfahrung und Reife.
Mein Instrument hat sich sicherlich entwickelt und ist gereift, aber mein technischer Ansatz beim Erarbeiten dieser Rollen ist absolut derselbe geblieben. Wobei das Ziel selbst bei der Interpretation einer „schweren“ Partie immer darin besteht, eine gewisse Leichtigkeit und stimmliche Reinheit zu bewahren, ohne je zu übertreiben oder dem Wunsch nachzugeben, mehr zu geben, wenn das nicht zur eigenen physischen Stimmstruktur passt. Das ist sehr wichtig: der Respekt vor dem eigenen Instrument.
.
Wie ordnen Sie Abigaille innerhalb Ihrer Verdi-Rollen ein: als vorläufigen Höhepunkt oder als Ausgangspunkt? Nach Lady Macbeth und Abigaille würden Rollen wie Odabella in „Attila“ oder Elvira in „Ernani“ naheliegen… Das ist eine schwierige Frage, denn Abigaille kann nicht als Ausgangspunkt gelten, sondern eher als Zielpunkt. Es ist eine Rolle, zu der man nur mit viel Erfahrung gelangt, die man nicht jeden Tag singen kann. Sie stellt die Stimme auf eine harte Probe, und um die stimmliche Gesundheit zu bewahren, sollte man sie nur bei entsprechender Gelegenheit und mit den richtigen Abständen angehen.
Natürlich kann man, blickt man in der Zukunft auf Rollen wie Odabella, sagen: Abigaille – zusammen mit Lady Macbeth – kann auch als Ausgangspunkt für weitere Entwicklungen gesehen werden. Persönlich finde ich Lady Macbeth leichter als Abigaille, während ich Odabella noch nicht beurteilen kann, da ich sie nie gesungen habe. Elvira in „Ernani“ hingegen würde ich nicht zu diesen „extremen“ Heldinnen zählen: Im Gegenteil, ich glaube, ich hätte sie auch vor Lady Macbeth oder Abigaille singen können.
Kurz gesagt: Abigaille ist eine Rolle, zu der man erst mit solider Erfahrung gelangt, die zugleich aber den Weg zu neuen Debüts öffnen kann. Sie ist also – je nach Perspektive – sowohl ein Ziel- als auch ein Ausgangspunkt.
.
Gibt es in Bonn einen besonderen Ort, der während der Proben zu Ihrem Rückzugsort geworden ist? Ich muss sagen, ich kannte diese Stadt und das Theater nicht, ich war vorher noch nie dort. Sie hat mich sehr beeindruckt: Es ist keine große Stadt, aber gerade deshalb lebt es sich dort sehr gut. Ich habe eine herzliche Aufnahme und ein wirklich positives Umfeld gefunden. Auch das Theater war eine schöne Entdeckung für mich. Es gibt keinen konkreten Ort, der zu meinem Rückzugsort geworden wäre, aber ich habe die Stadt und das Theater als Ganzes als sehr entspannt erlebt.
.
Im Juni kehren Sie als Tosca nach Bonn zurück, eine Rolle, die Sie erstmals im vergangenen Jahr gesungen haben. Wie hat sich die Rolle seit Ihrem Debüt entwickelt? Wie bei jeder neuer Rolle wächst mit der Zeit die Vertrautheit mit der Figur. Tosca ist ein Charakter, den ich besonders liebe und den ich mittlerweile mehrfach gesungen habe: Jedes Mal, wenn ich sie interpretiere, fühle ich mich ihr näher. Ich würde nicht sagen, dass sich meine Interpretation gegenüber dem Debüt radikal verändert hat, sie ist vielmehr gereift.
Das Schönste, wenn man eine Rolle mehrmals interpretiert, ist, dass Passagen und Intentionen, die man anfangs nur im Kopf klar hat, die aber nicht immer sofort zum Vorschein kommen, mit der Zeit natürlicher werden, mehr zu den eigenen werden. Diese wachsende Vertrautheit bringt eine größere Ausdrucksfreiheit mit sich: Die Interpretation an sich ändert sich nicht, aber die Art, sie zu vermitteln, weil man mehr Mittel hat, den Charakter lebendig und authentisch zu gestalten.
.

Erica Grimaldi: „La forza del destino“ in Bologna, Credit: Andrea Ranzi
In weniger als zwei Jahren haben Sie in drei großen Puccini-Rollen debütiert: Manon Lescaut, Madama Butterfly und Tosca. Was verbindet diese Figuren für Sie, und worin unterscheiden sich ihre stimmlichen Anforderungen? Ich würde sagen, alle drei sind sehr leidenschaftliche und zugleich tragische Frauen. Sie leben die Liebe absolut, doch wird die Liebe für sie zu einer zerstörerischen Kraft, geprägt von Betrug, Eifersucht oder, im Fall von Butterfly, gesellschaftlichen Zwängen. Und alle drei enden mit dem Tod: Tosca, die sich von der Engelsburg stürzt; Butterfly, die sich ersticht; und Manon, die in der Wüste stirbt. Drei unterschiedliche Schlüsse, aber alle mit einem fatalen Ausgang.
Ein weiteres verbindendes Element ist das Verhältnis zu dem Mann, den sie lieben und der auf unterschiedliche Weise die Ursache ihres Schmerzes und ihres Endes ist. Tosca mit Cavaradossi – und indirekt mit Scarpia; Butterfly mit Pinkerton; Manon mit Des Grieux. Diese Männer sind der Motor ihrer Geschichte, aber auch ihres Endes.
Natürlich gibt es wichtige psychologische Unterschiede. Tosca ist vielleicht die Stärkste: impulsiv, mutig, stolz, fähig, Scarpia die Stirn zu bieten. Butterfly hingegen ist das Gegenteil: zerbrechlich, ihrem Gefährten absolut treu, bereit, sich bis zum Äußersten zu opfern. Ihre Tragödie entspringt der Illusion, zu glauben, dass Warten und absolute Treue Sinn haben und sich lohnen könnten. Manon schließlich ist eine ambivalentere, komplexere Figur: Einerseits liebt sie Des Grieux aufrichtig, andererseits fühlt sie sich vom Luxus und vom Vergnügen angezogen, darin ist sie sehr viel irdischer. Man könnte sagen: Tosca ist eine Heldin, Butterfly ein Opfer und Manon die widersprüchlichste der drei.
Auch stimmlich gibt es grundlegende Unterschiede. Für mich ist Madama Butterfly die anspruchsvollste: eine sehr lange Oper, in der die Protagonistin die Bühne nie verlässt und keinen Moment zum Atemholen hat. Die Schreibweise verlangt eine kontinuierliche Intensität, große Bögen, die in die Höhe steigen und in den dramatischsten Momenten in die Tiefe gehen, ohne Möglichkeit, sich zu schonen. Manon Lescaut ist technisch etwas weniger heikel, aber sehr kompliziert wegen der ständigen Stilwechsel: Es gibt typisch puccineske, weite, leidenschaftliche Seiten, die sich mit fragileren, fast sogar „frühklassischen“ Momenten abwechseln. Und das führt dazu, dass man stimmlich und darstellerisch ständig umzuschalten muss. Tosca hingegen ist vokal geradliniger, gewiss nicht einfach, aber weniger strapaziös als die beiden anderen, während die größte Schwierigkeit darin besteht, ihrem feurigen, leidenschaftlichen Temperament stets Ausdruck zu verleihen.
.
Im nächsten Jahr folgen Giorgetta („Il tabarro“) und Suor Angelica in Washington, D.C., und in der Carnegie Hall. Was fasziniert Sie an diesen beiden Frauen des „Trittico“, auch im Kontrast zu Tosca und Manon? Vorweg: Es handelt sich um zwei Debüts, das der Giorgetta und das der Suor Angelica. Rollen also, die ich noch nicht ganz als „meine“ empfinde. Was mich jedoch sofort beeindruckt hat, ist der Unterschied zwischen diesen beiden weiblichen Welten. Es sind sehr unterschiedliche Figuren, die beide zutiefst menschliche Aspekte des Lebens erzählen.
Giorgetta ist eine sehr leidenschaftliche Frau, die in ihrer Ehe gefangen ist und ihr Glück anderswo sucht. Suor Angelica hingegen ist eine transzendentalere Figur, die konstant im Schmerz lebt und im Finale Erfüllung findet, wenn sie ihren Weg mit totaler Hingabe beschließt. Giorgetta und Angelica leben intimere, alltäglichere Gefühle als etwa Tosca oder Manon.
Ich glaube, die große Besonderheit des „Trittico“ ist, dass Puccini sich dazu entscheidet, Frauenfiguren zu zeichnen, die vielleicht weniger heroisch, aber unseren Alltagserfahrungen näher sind. Frauen, die lieben, die Fehler machen, die leiden und die – auf unterschiedliche Weise – einen Weg suchen, sich vom Schmerz zu befreien.
.
Die Rolle, die Sie am häufigsten gesungen haben, ist Mimì. Inwiefern hilft Ihnen diese lange Erfahrung, die dramatischeren Puccini-Figuren wie Butterfly oder Tosca anzugehen? Mimì war für mich – das sage ich jetzt und bestätige es im Rückblick – eine fundamental wichtige Rolle und ist es bis heute. Ich kann in der Gegenwartsform sprechen, weil ich sie weiterhin singe und mich ihr verbunden fühle. Es ist die Puccini-Rolle, die ich mit Abstand am häufigsten interpretiert habe, mit der ich am vertrautesten bin und die ich am besten kenne, und gerade deshalb ist sie auch die Partie, von der ich am meisten gelernt habe.
Aus stimmlicher Sicht ist die Schreibweise typisch für Puccini, die sich dann in Tosca und Butterfly weiterentwickelt. Mimì ist ein junges Mädchen, und deshalb verlangt ihre Interpretation Reinheit: Reinheit des Gesangs, Reinheit der Linie und eine große Fähigkeit, stets „auf dem Atem“ zu singen. Sie ist eine unschuldige Figur, und man muss ihre Emotionen mit größtmöglicher Natürlichkeit und Intimität wiedergeben.
Diese lange Beschäftigung mit Mimì hat mir solide technische Grundlagen gegeben, aber auch ein szenisches Bewusstsein, das ich dann in dramatischere Rollen wie Butterfly und Tosca mitnehmen konnte. Mit Butterfly gibt es sogar eine gewisse Kontinuität: Im ersten Teil finden wir dieselbe Zartheit und Unschuld von Mimì wieder, die sich dann aber ab dem zweiten Akt entwickelt. Tosca hingegen ist völlig anders: eine theatralische, stolze, dramatische Figur. Und doch hat mich auch hier die Erfahrung mit Mimì gelehrt, nie die Intimität und die emotionale Wahrheit zu verlieren, selbst in Momenten größter dramatischer Kraft.
Letztlich war Mimì für mich eine wertvolle Wegweiserin, weil sie mir geholfen hat, das Gleichgewicht zwischen rein lyrischem Gesang und szenischer Wahrheit zu finden, das man auch für die „heroischeren“ Puccini-Figuren braucht.
.
Ein Blick in die Zukunft: Welche neuen Rollen würden Sie in den nächsten Jahren gern interpretieren? Was ich mir im Moment am meisten wünsche, ist, die Rollen weiter zu singen, die ich in letzter Zeit debütiert habe. Ich möchte sie oft singen, um sie wirklich zu vertiefen, sie mir vollständig zu eigen zu machen und zu hundert Prozent zu leben, natürlich einschließlich Abigaille. Das Debüt ist immer ein besonderer Moment, voller Energie und Adrenalin, aber ich glaube, die eigentliche Arbeit beginnt erst danach.
Deshalb ist mein großer Wunsch, diese Rollen, die ich zutiefst liebe und die zugleich jene sind, von denen jede Sopranistin träumt, sie mindestens einmal im Leben zu singen, häufig wiederholen zu können. Jetzt, da dieser Moment für mich gekommen ist, möchte ich ihn in vollen Zügen genießen, ohne zu sehr an die Zukunft zu denken, sondern im Hier und Jetzt zu leben.
Natürlich gibt es auch Rollen, die ich noch nicht gesungen habe und die ich gern angehen würde. Ein Beispiel? Elisabetta di Valois in Verdis „Don Carlo“. Eine Oper, die ich gut kenne und die mich immer gefesselt hat. Ich würde sie sehr gern interpretieren. Wir werden sehen, was die Zukunft bereithält.
.
Sie singen regelmäßig auf den großen internationalen Bühnen. Gibt es dennoch ein Opernhaus oder Festival, auf dessen Bühne zu stehen Sie träumen? Oh ja, gewiss. Einer der großen Träume eines jeden Künstlers ist es, an der Metropolitan Opera in New York zu singen: Nun, da dieses Debüt in der Spielzeit 2026/27 endlich konkret auf dem Programm steht, empfinde ich einfach eine riesengroße Vorfreude. Ein weiterer Wunsch ist es, an eines der wichtigsten Theater nicht nur der Welt, sondern vor allem meines Landes zurückzukehren: an die Scala. Damit nehme ich den anderen Theatern nichts – ich liebe sie wirklich alle -, aber wenn ich einen besonderen Traum nennen soll, dann ist es genau dieser.
Welchen Rat würden Sie der jüngeren Erika Grimaldi am Beginn ihrer Karriere heute geben? Man darf die Dinge niemals als selbstverständlich hinnehmen – ein Grundsatz, den man sowohl in jungen Jahren als auch mit fortschreitender Karriere im Blick behalten sollte. Wenn man einen künstlerischen Weg einschlägt, gelangt man an einen Punkt der Vorbereitung, der es erlaubt, mit Bewusstsein auf die Bühne zu gehen. Das bedeutet aber nicht, dass damit alles für immer erworben wäre: Jede Rolle ist eine eigene Welt mit spezifischen Eigenschaften, die gemeinsam mit dem Künstler wachsen, unabhängig davon, ob es eine große oder kleine Rolle ist.
Deshalb gilt: Auch nach den ersten Erfolgen sollte man eine gewisse kritische Distanz zu dem bewahren, was man singt. Jede Partie hebt unterschiedliche Aspekte der Stimme hervor und bringt Schwierigkeiten mit sich, die angegangen, verinnerlicht und überwunden werden müssen. Kurzum: Man darf nie etwas als gegeben ansehen, sondern sollte jede Partitur mit Demut angehen und das Beste geben, mit den Kenntnissen, die man in diesem Moment hat. Es ist ein Beruf, der ständige Weiterentwicklung verlangt – die kontinuierliche Aneignung neuer Mittel, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Wer stehen bleibt, geht unweigerlich rückwärts. Deshalb sind Studium, Demut und die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu hinterfragen, grundlegend.
.

Erica Grimaldi: In ihrer Garderobe während einer Vorstellung von „Un ballo in maschera“ am Opernhaus Zürich, Credit: Tim Weiler
Wenn Sie eine Opernfigur zum Abendessen einladen könnten: Wen würden Sie wählen und worüber würden Sie sprechen? Wen ich zum Abendessen einladen würde? Gute Frage. Für mich muss das Abendessen ein Moment der Entspannung und des Vergnügens sein – eine Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen. Vielleicht könnte ich andersherum antworten: Anstatt gleich zu sagen, wer es ist, beschreibe ich die Eigenschaften – und dann müssen die Leser raten.
Also… Ich würde eine sehr witzige Frau einladen, eine Buffofigur aus der Oper des 18. Jahrhunderts: schlau, äußerst pragmatisch, schlagfertig und vor allem Meisterin der Verkleidung. Eine echte Komplizin in ihrer Rolle, skeptisch gegenüber treuer Liebe, bereit, ohne allzu viele Skrupel Ratschläge zu erteilen… und fähig, mich das ganze Abendessen über zum Lachen zu bringen.
Wer könnte das wohl sein? [* Auflösung am Ende des Interviews]
.
Welche Musik hören Sie privat, wenn Sie gerade keine Opernpartitur in der Hand haben? Ich habe kein bevorzugtes Musikgenre, sondern mag ein bisschen von allem. Ich höre auch einfach die Musik, die im Radio läuft, und verfolge, wenn ich kann, gern das Festival di Sanremo. Ich habe keine besonderen Vorlieben, obwohl ich Jazz sehr schätze.
Privat hängen meine Hörgewohnheiten ein wenig vom Moment ab, von dem, was im Fernsehen oder anderswo zufällig auftaucht: Ich suche nicht gezielt nach bestimmten Dingen. Anders ist es, wenn es um meine Arbeit geht: Da suche und höre ich mit besonderer Aufmerksamkeit, mit der Konzentration, die die professionelle Vorbereitung erfordert.
Ich würde also sagen, ich höre alles – mit einer einzigen Ausnahme: Ich mag keine Diskothekenmusik, dieses etwas „hämmernde“. Mir ist wichtig, dass Musik – auch in anderen Genres als meinem – eine Entwicklung hat, einen roten Faden, etwas Interessantes aus musikalischer Sicht oder zumindest einen erzählerischen Gehalt im Lied.
.Auf der Bühne interpretieren Sie oft Königinnen und tragische Heldinnen. Welche ganz „alltägliche“ Rolle im Leben bereitet Ihnen die meiste Freude? Es stimmt, auf der Bühne verkörpere ich oft Königinnen oder tragische Heldinnen. Aber im Alltag ist die wichtigste Rolle leicht zu benennen: die der Mutter. Sie ist zweifellos anstrengend, manchmal sehr fordernd, aber ohne Zweifel die schönste der Welt, denn sie holt mich sofort in die Realität und in die Spontaneität zurück. Es ist eine Rolle ohne Applaus – das stimmt -, aber voller Liebe. Beat Schmid
.
* Despina in „Così fan tutte”



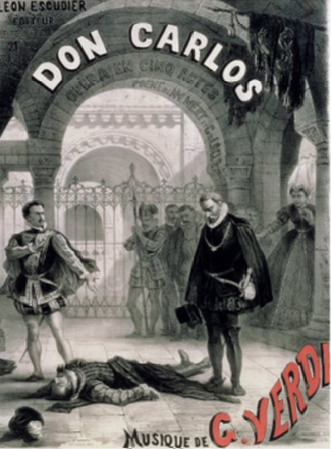

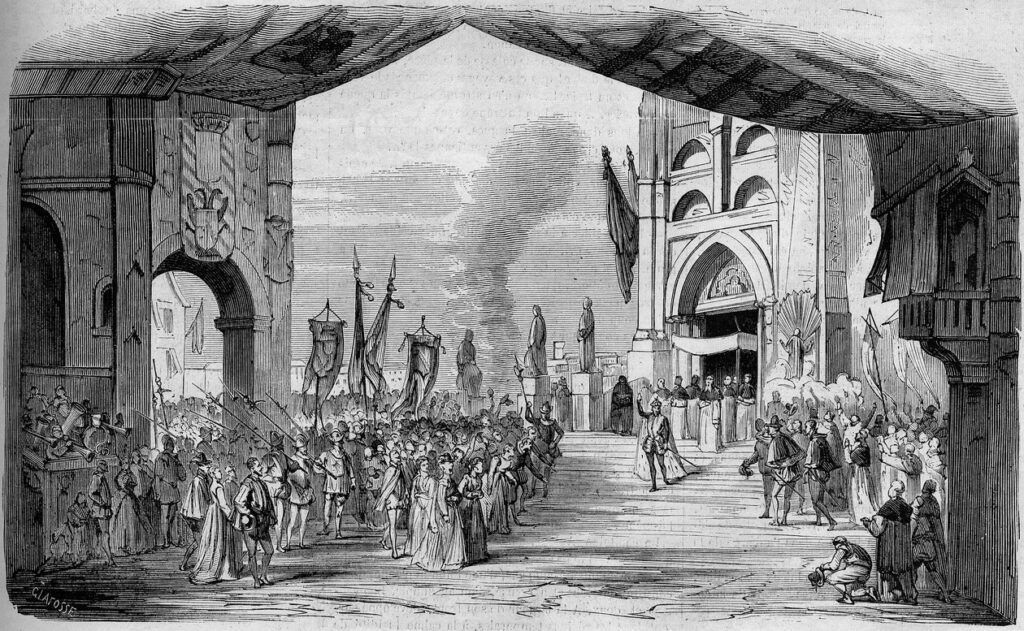
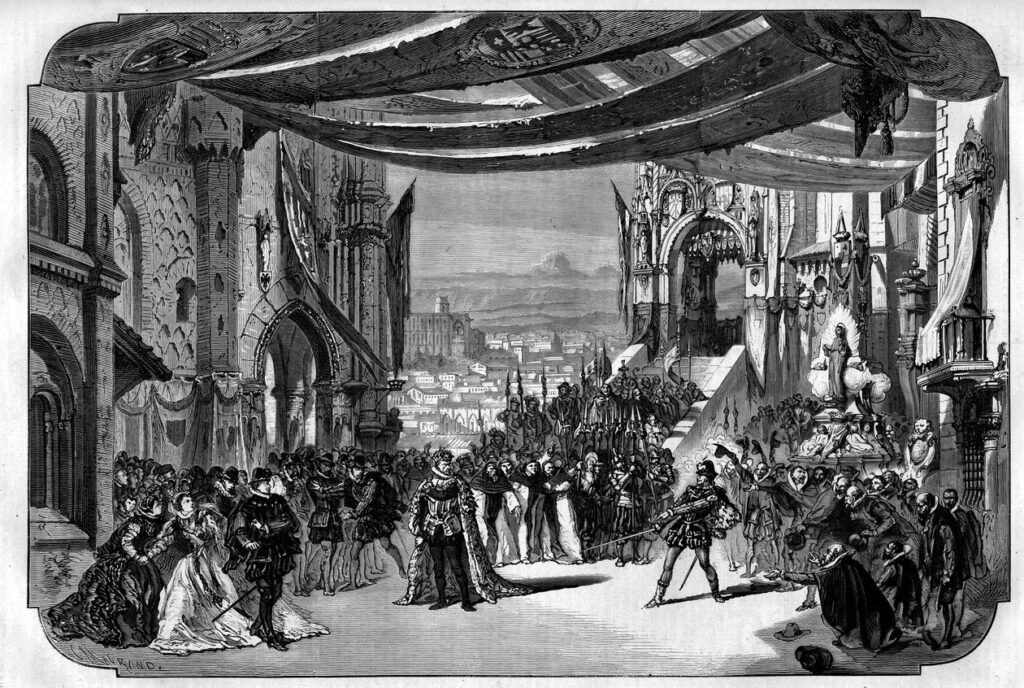



 In den
In den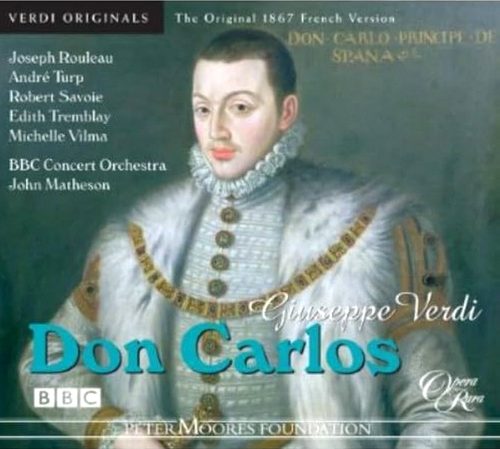 Die ebenfalls und eigentlich noch bedeutendere, pionierhafte
Die ebenfalls und eigentlich noch bedeutendere, pionierhafte  Erst
Erst An
An 


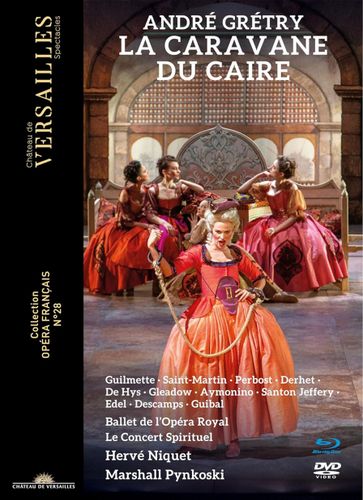


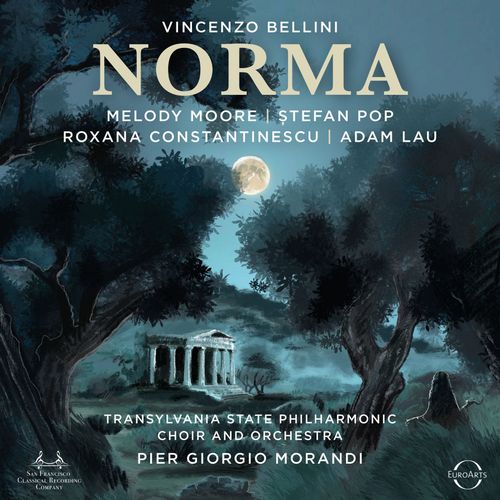







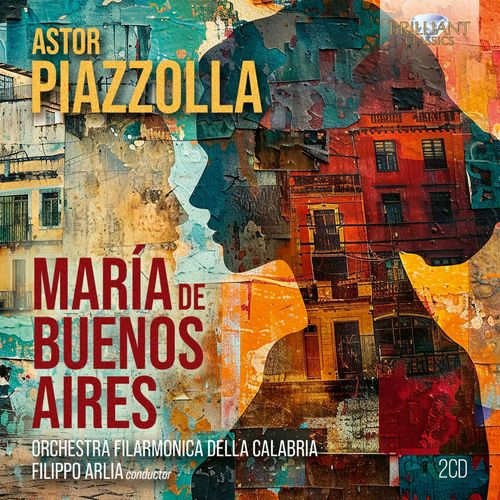

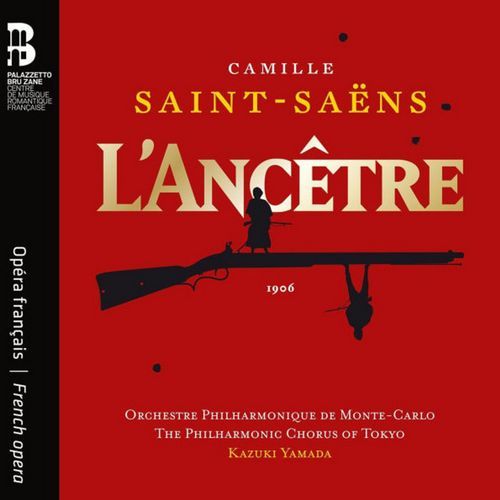 Diese interessante späte Oper (die x.te im Katalog des Palazzetto Bru Zane, mit der etwas eingenwillige Liebe des Künstlerischen Directors
Diese interessante späte Oper (die x.te im Katalog des Palazzetto Bru Zane, mit der etwas eingenwillige Liebe des Künstlerischen Directors 






