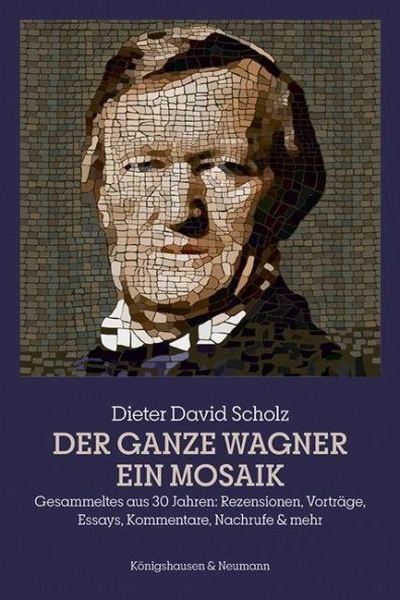.
Der italienische Dirigent Matteo Beltrami gilt als Experte fürs italienische Fach und hat sich in Deutschland in den letzten Jahren mit Opern Verdis, Puccinis, Bellinis, Donizettis oder Rossinis unter anderem an der Staatsoper Hamburg, der Deutschen Oper Berlin, der Dresdner Semperoper, dem Aalto-Theater Essen und der Staatsoper Hannover etabliert. Zur Zeit leitet er eine Neuproduktion von „La Cenerentola“ an der Oper Köln und teilt mit den Lesern von Opera Lounge spannende Gedanken über Rossinis dramma giocoso. Im Interview mit Christian Glace spricht er außerdem unter anderem über seine Anfänge, seine zukünftigen Projekte, wie er sich einem Werk nähert, seine Zeit als künstlerischer Leiter des Luglio Musicale Trapani und warum Verdi die Liebe seines Lebens ist.
.
Wie und wann wurde Ihre Leidenschaft für Musik geboren? Mein Vater wurde kurz nachdem er geheiratet hat zweiter Posaunist am Teatro Comunale in Genua und zog mit meiner Mutter aus Bergamo dorthin. In dieser Stadt hatten sie keine Verwandten, also nahm er mich als Kind immer mit ins Theater. Das Politeama Margherita war riesig… So kam es mir jedenfalls als Kind vor. Garderoben, die jeden Monat mit anderen Kostümen, Perücken und Gegenständen aus allen erdenklichen Epochen gefüllt waren… Schutzschilde, Schwerter, Gewehre, Hüte, Bäume, Kutschen… Kurzum, ein riesiger Vergnügungspark nur für mich! Und dann all diese Musikinstrumente, die in den Garderoben so unterschiedlich aussahen. Die verschiedene Sprachen zu sprechen schienen und die sich dann auf der Bühne wie von Zauberhand in perfekter Harmonie miteinander unterhielten… Es gab keinen „Urknall“ für meine Leidenschaft, es war einfach so, dass ich seit ich ein Baby war nicht nur Luft, sondern auch Musik geatmet habe!
.
Warum haben Sie sich dazu entschieden, Dirigent zu werden, statt sich einem Instrument zu widmen? Ich begann im Alter von sechs Jahren Geige zu lernen und machte meinen Abschluss am Konservatorium von Genua. Eines der Pflichtfächer war Orchesterpraxis und ich hatte die Stelle des Assistenten für die zweiten Violinen inne. Nachdem dem Lehrer Maestro Gilberto Serembe von meinem Traum, Dirigieren zu studieren erzählte, unterbrach er eines Tages ohne Vorwarnung eine Probe und lud mich zum Dirigieren ein. Es war Beethovens achte Symphonie. Zu meiner Überraschung stellte ich fest, dass mir das Geigenspielen in der Öffentlichkeit viel Stress bereitete, ich mich aber auf dem Podium sehr wohl fühlte. Ich nahm einige Stunden Unterricht bei Maestro Serembe. Mit 20 Jahren hatte ich die erste Gelegenheit, eine Oper zu dirigieren, und ab dem folgenden Tag hängte ich meine Geige an die Wand. Ich habe sie nie wieder in meinem Leben angerührt und habe diese radikale Entscheidung nie bereut.
.
Welche Erinnerungen haben Sie an ihre erste Vorstellung? Das war Verdis Trovatore. Eines der schwierigsten Werke für einen Dirigenten. Weniger technisch gesehen, auch wenn es einige unvorhersehbare rhythmische Unterteilungen mit sich bringt. Sondern vielmehr was die künstlerischen Reife angeht, die dieses Werk erfordert, um eine kohärente Interpretation zu liefern. Ich habe also wirklich unbewusst gesündigt, als ich das Stück so jung dirigiert habe. Aber beim Dirigieren fühlte sich mein tiefstes Wesen so frei, Musik zu machen, dass ich keinen Zweifel daran hatte, dass dies mein Beruf sein würde.
.

Matteo Beltrami/ Foto Teresa Rothwangl
Zu welchen Komponisten haben Sie die größte Affinität und warum? Obwohl die Figur des Dirigenten in der kollektiven Vorstellung eine sagenumwobene Aura umweht und ihr geradezu übernatürliche Fähigkeiten zugesprochen werden, sieht die Realität ganz anders aus. Wir widmen einen großen Teil unserer Zeit, unserer Energie und unseres Willens dem Studium der Musik. Selbst wenn wir denken, dass wir uns ausruhen, verarbeiten unsere Gehirnzellen Klänge. Wir bauen mit den Komponisten, deren Musik wir aufführen, echte Beziehungen auf, die oft länger halten als jene, die wir privat führen. Und es sind nicht immer Liebesgeschichten! Wenn ich ein Werk dirigiere, ist es für mich von grundlegender Bedeutung, dass ich so stark davon angezogen werde, dass ein kreativer Prozess freigesetzt wird. Bei manchen Komponisten stellt sich dieses Gefühl nach langem Studium und einer tiefen Auseinandersetzung ein, bei anderen ist es vergleichbar mit einem Blitzeinschlag. Und dann gibt es da noch die große Liebe meines Lebens. Wie schon mehrfach gesagt, ist Giuseppe Verdi für mich ein Beweis für die Existenz Gottes. Sein Werk ist gekennzeichnet von Meilensteinen, von absoluten Meisterwerken, oft sehr unterschiedlich, denen experimentelle Werke folgen, die von großartigen Momenten gekennzeichnet sind, denen weniger gelungene folgen. Wenn man beispielsweise „Il corsaro“ studiert, versteht man, dass das Rigoletto‐Quartett keine glückliche Intuition ist, sondern ein Modell der Perfektion, die der Komponist dank verschiedener früherer Versuche erreicht hat. Deshalb war er ein großartiger Komponist, aber vor allem ein absolutes Genie darin, die Essenz eines Dramas einzufangen, indem er es auf einfache und lineare Weise synthetisiert. Seine Musik erforscht die menschliche Seele, wie es nur wenige andere konnten. Dabei öffnet sie kontinuierlich Türen, durch die Antworten auf die Fragen gesucht werden, die die Menschheit seit jeher beschäftigen. Und je mehr das Studium dieses Giganten vertieft wird, desto mehr steigt die Zahl der Fragen im Vergleich zu den Antworten. Das ist übrigens bei den meisten Genies so, die wie Verdi in die Geschichtsbücher eingegangen sind.
.
Bisher haben Sie sich mehr dem Opernrepertoire als dem symphonischen Repertoire verschrieben. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Während meines Studiums habe ich mich immer mit beidem beschäftigt, aber hatte wahrscheinlich eine besondere Leichtigkeit im Lösen der Probleme, mit denen ein Dirigent beim Vorbereitung einer Oper konfrontiert wird. Und das öffnete mir sofort die Türen der Opernhäuser. Darüber hinaus sind sowohl ausländische Orchester als auch Sänger besonders bestrebt, ihre Interpretationen und ihren Stil im italienischen Opernrepertoire des 19. Jahrhunderts zu vertiefen. Vor allem wenn sie erkennen, dass sie es mit einem Dirigenten zu tun haben, der ihnen maßgeblich dabei helfen kann. Erst vor wenigen Tagen stellte mir eine Konzertmeisterin eine konkrete Frage zum „Auftakt“ der Anfangsakkorde vieler Musiknummern von italienischen Belcanto‐Werken.
Als italienischer Dirigent habe ich auch die Pflicht, mich um die richtige Aussprache und das Textverständnis ausländischer Sänger zu kümmern, die oft nur grob die Bedeutung der von ihnen gesungenen Phrasen kennen.
.
Wie nähern Sie sich einem Werk, das Sie noch nie dirigiert haben? Wenn es ein im Voraus geplantes Debüt ist, studiere ich immer ein paar Seiten am Tag. Zuerst singe ich alles. Ich brauche das nicht nur, um ein Werk auswendig zu lernen, ich bekomme, indem ich im Laufe der Zeit Dutzende Male denselben Satz singe, eine genaue Vorstellung der musikalischen Intentionen, die ich dann während der Proben von den Interpreten möchte. Manchmal verweile ich bei einem ganzen Satz, oder auch nur bei einem Wort oder einer Silbe. Beispielsweise bei „Pensa che un popolo, vinto, straziato per te soltanto risorger può“ [aus dem dritten Akt von Aida interessiert mich der große melodische Bogen. Deshalb singe ich diese Phrase in einem einzigen Atemzug und stelle mir Verdis Akzent innerhalb eines großen Legatobogens vor. In La Cenerentola müssen die Stiefschwestern einen Akzent auf der Silbe „ve“ von „Ma poi non è un Venere“ singen und hier liegt meine Aufmerksamkeit geradezu chirurgisch auf diesem kleinen Detail.
Nach dem Erlernen der Gesangsstimme konzentriere ich mich auf die Orchestrierung und anders als man meinen könnte, ist da das Auswendiglernen nicht mein Hauptziel. Sicher kenne ich die Partitur, bevor ich auf die Bühne gehe wie meine Westentasche, aber was mich wirklich interessiert ist, das Orchester mit der Gesangsstimme in Beziehung zu setzen. Wann soll das Orchester den Gesang unterstützen? Wann und wie soll es mit ihm in Dialog treten? Wie kann ein bestimmter Moment geschaffen werden, in dem das, was man im Graben hört, in scharfem Kontrast zur Bühne steht? Oder wenn ein einzelnes Instrument die Stimmungen offenbart, die die Protagonisten so sehr zu verbergen versuchen, dass sie sich ihnen gegenüber sogar widersprüchlich verhalten?
.

Matteo Beltrami/ Foto wie oben Teresa Rothwangl
Sie waren auch künstlerischer Leiter eines der dynamischsten Theater Italiens, des Luglio Musicale Trapani. Nach welchen Kriterien haben Sie dort den Spielplan gestaltet? Als künstlerischer Leiter habe ich mich als Manager ausprobiert. Die Rolle des Managers ist ein wesentlicher Bestandteil der Theaterwelt und ich habe versucht, anregende Programme anzubieten, teils innovativ, aber immer mit Respekt vor den kulturellen Wurzeln der Oper. Und natürlich musste ich immer darauf achten, Budgets und Budgetbeschränkungen zu respektieren. Ich habe auf ungewöhnlichen Bühnen spielen lassen (Konzerte am Meer bei Sonnenuntergang, Opern in halbszenischer Form in Klöstern, Konzerte in archäologischen Parks, umherziehende Flashmobs durch von Touristen überflutete Straßen der Stadt). Außerdem habe ich neben sehr gefragten Operntiteln Musik des 20. Jahrhunderts viel Raum gegeben und Uraufführungen zeitgenössischer Kompositionen auf die Bühne gebracht.
.
In Köln leiten Sie eine Neuinszenierung von „La Cenerentola“. Wie viele Rossini-Opern haben Sie bereits dirigiert? Bevorzugen Sie die opere serie Rossinis oder die opere buffe? Ich ziehe das eine dem anderen nicht vor, aber ich finde, seine komischen Opern, oder noch besser, seine halbernsten (da sie je nach Werk in unterschiedlicher Dosis eine ernste Ader enthalten) sind den ernsten auf keinen Fall unterlegen.
Und das gilt nicht nur für Rossini. Ein Beweis dafür ist, dass sowohl die Cenerentola, als auch der Barbiere und die Italiana, sowohl Donizettis Don Pasquale als auch Verdis Falstaff allgemein als absolute Meisterwerke gelten.
Für die Cenerentola etwa hatte ich schon immer eine besondere Vorliebe: Es ist ein Werk, das von einer Ader des Wahnsinns und einem manchmal surrealen Humor geprägt ist. Respektlos, inkohärent und erhaben, hat es seine Wurzeln in der Tradition der Commedia dell’arte, scheint aber zu einem gewissen „Absurden Theater“ des 20. Jahrhunderts zu tendieren. Die scheinbar stereotypen Charaktere der Oper (der geizige, mürrische und prahlerische Bassbuffo, die reife, gerechte und weise Protagonistin im Gegensatz zu den perfiden, stumpfen und egoistischen Stiefschwestern, der verliebte Tenor und der Handlanger- und Gaunerbariton) durchbrechen plötzlich die vierte Wand, verlassen quasi die Leinwand wie Tom Baxter in The Purple Rose of Cairo und nehmen ein Eigenleben in der realen Welt an. Rhythmus und Melodie kämpfen ständig miteinander und reißen die Charaktere in einen wirbelnden Tanz. Jeder, außer Angelina, die in all dem die Figur ist, die ein Schiff vor Anker hält, das sonst außer Kontrolle geraten würde. Unnachgiebig in ihren Überzeugungen, ist sie wie ein Samen, der geduldig auf den richtigen Moment wartet, um zu keimen. Auch aus gesanglicher Sicht wartet die Protagonistin mehr als zwei Stunden, bevor sie ihr Können zeigen kann. Aber wenn ihre Zeit kommt, ist es, als ob die Welt anhält und ihr zuhört. Deshalb ist das Erfinden neuer Koloraturen, Variationen und Kadenzen nicht nur eine philologische Praxis, sondern eine dramaturgische Notwendigkeit!
Welche Träume haben Sie? Gibt es ein bestimmtes Werk, das Sie noch nicht dirigiert haben, aber gern einmal leiten würden? Ich habe mehr als 50 Opern dirigiert und hatte so das Glück, schon viele Träume zu realisieren. Einen habe ich aber noch, und das ist, Verdis „Don Carlo“ zu dirigieren. Abgesehen davon, dass es sich um ein Meisterwerk handelt, das ich schon immer dirigieren wollte, war ich diesem Debüt zweimal schon so nahe und am Ende hat es leider nicht funktioniert, weil das Projekt dann doch nicht stattgefunden hat oder ich einfach nicht frei war.

Matteo Beltrami/ Foto Wikipedia
Was sind Ihre nächsten Verpflichtungen? Auf mich wartet ein richtig spannendes erstes Halbjahr 2023. Nach den erfolgreichen Vorstellungen im vergangenen Herbst kehre ich für Traviata nochmals nach Graz zurück. Mehr als drei Jahre nachdem ich das Stück das letzte Mal dirigiert habe, hatte ich bereits bei der Vorstellungsserie diesen Herbst das Glück, dieses Meisterwerk erneut mit einem Orchester zu erarbeiten, mit dem ich eine besondere Verbindung habe. Und das Ergebnis war eine jener Aufführungen, die mich Stolz machen. Anschließend habe ich das Vergnügen, mit La bohème an einem Theater zu arbeiten, an dem ich viele Freunde habe, in Palma de Mallorca. In Piacenza, wo ich mich jetzt auch dank der exquisiten Gastfreundschaft einer besonderen Frau, Cristina Ferrari, der dortigen Generalintendantin und künstlerische Leiterin des Theaters, zu Hause fühle, dirigiere ich Il trovatore und ein Konzert, das großartige Requiem in c-Moll von Cherubini. Schließlich kehre ich mit Lucia di Lammermoor zurück an die Deutsche Oper Berlin.




 Als Fricka hinterließ die einst weltweit gefeierte Wagnerheroine eine letzte leuchtende Spur auf dem internationalen Musikmarkt. Sie starb 1962. Eine Decca-Platte zu ihrem Gedenken wurde denn auch mit einer großen Szene aus dem neuen Rheingold bestückt. Die Flagstad was das mit Abstand älteste Ensemblemitglied, gefolgt von dem neun Jahre jüngeren
Als Fricka hinterließ die einst weltweit gefeierte Wagnerheroine eine letzte leuchtende Spur auf dem internationalen Musikmarkt. Sie starb 1962. Eine Decca-Platte zu ihrem Gedenken wurde denn auch mit einer großen Szene aus dem neuen Rheingold bestückt. Die Flagstad was das mit Abstand älteste Ensemblemitglied, gefolgt von dem neun Jahre jüngeren  Legge, der gewöhnlich als weitsichtig galt und mit den von ihm betreuten Aufnahmen kräftige Akzente setzte, die bis in die Gegenwart nachwirken, hatte sich diesmal geirrt – und zwar gewaltig. Mehrfach preisgekrönt, entpuppte sich dieser Ring als eine der erfolgreichsten Produktionen der Schallplattengeschichte. Endlich konnte Wagners Bühnenweihfestspiel auch in den eigenen vier Wänden gehört werden, immer und immer wieder, bei Tag und bei Nacht. Es bedurfte keiner Notenkenntnisse, um das Werk in seiner Kühnheit und Genialität kennenzulernen. Wer wissen wollte, wie Wagner klingen kann, kam daran nicht vorbei. Selbst Skeptiker griffen irgendwann danach. In kaum einer Sammlung dürfte er fehlen. Die erste Studioaufnahme, die erst 1965 vollendet wurde, war nie von Markt verschwunden, war immer griffbereit und landete auf keinem Wühltisch in Kaufhäusern. Vor diesem Schicksal bewahrte sie auch ein angemessener Preis.
Legge, der gewöhnlich als weitsichtig galt und mit den von ihm betreuten Aufnahmen kräftige Akzente setzte, die bis in die Gegenwart nachwirken, hatte sich diesmal geirrt – und zwar gewaltig. Mehrfach preisgekrönt, entpuppte sich dieser Ring als eine der erfolgreichsten Produktionen der Schallplattengeschichte. Endlich konnte Wagners Bühnenweihfestspiel auch in den eigenen vier Wänden gehört werden, immer und immer wieder, bei Tag und bei Nacht. Es bedurfte keiner Notenkenntnisse, um das Werk in seiner Kühnheit und Genialität kennenzulernen. Wer wissen wollte, wie Wagner klingen kann, kam daran nicht vorbei. Selbst Skeptiker griffen irgendwann danach. In kaum einer Sammlung dürfte er fehlen. Die erste Studioaufnahme, die erst 1965 vollendet wurde, war nie von Markt verschwunden, war immer griffbereit und landete auf keinem Wühltisch in Kaufhäusern. Vor diesem Schicksal bewahrte sie auch ein angemessener Preis. 




 Mich hatte bisher noch keine Interpretation durch einen Sänger, der auch auf Tonträgern nachzuhören ist, vollumfänglich überzeugt. Nicht einmal Nicolai Gedda, der in seiner Zeit ähnlich hohe Maßstäbe für Berlioz gesetzt hatte wie jetzt Spyres. Erst zweiundvierzig Jahre alt, ist der amerikanische Tenor als Énée, Benvenuto Cellini, Faust und Récitant in L’enfance du Christ im Musikbetrieb und auf CD fest etabliert. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis er sich den Liedern zuwenden würde. Nun ist es soweit. Seine Umtriebigkeit und sängerische Unerschrockenheit, die auch vor Wagners Tristan keinen Halt machte, ist bemerkenswert. Es besteht immerhin die Gefahr, dass die Stimme auf Dauer nicht mithält, was sehr schade wäre. Und dennoch scheint sich sein Repertoire, zu dem auch Händel und Mozart gehören, in der Summe in seiner Interpretation der Lieder niederzuschlagen. Er singt als Wissender. Mit sicherem Instinkt trifft er genau das, was Berlioz in seiner Zerrissenheit und Depression, in seinem Ungestüm ist. Hinter betörender, in Duft gehüllter Melancholie lauern Gefahren. Besonders in
Mich hatte bisher noch keine Interpretation durch einen Sänger, der auch auf Tonträgern nachzuhören ist, vollumfänglich überzeugt. Nicht einmal Nicolai Gedda, der in seiner Zeit ähnlich hohe Maßstäbe für Berlioz gesetzt hatte wie jetzt Spyres. Erst zweiundvierzig Jahre alt, ist der amerikanische Tenor als Énée, Benvenuto Cellini, Faust und Récitant in L’enfance du Christ im Musikbetrieb und auf CD fest etabliert. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis er sich den Liedern zuwenden würde. Nun ist es soweit. Seine Umtriebigkeit und sängerische Unerschrockenheit, die auch vor Wagners Tristan keinen Halt machte, ist bemerkenswert. Es besteht immerhin die Gefahr, dass die Stimme auf Dauer nicht mithält, was sehr schade wäre. Und dennoch scheint sich sein Repertoire, zu dem auch Händel und Mozart gehören, in der Summe in seiner Interpretation der Lieder niederzuschlagen. Er singt als Wissender. Mit sicherem Instinkt trifft er genau das, was Berlioz in seiner Zerrissenheit und Depression, in seinem Ungestüm ist. Hinter betörender, in Duft gehüllter Melancholie lauern Gefahren. Besonders in