Traurig schaut die Braut drein. Verhärmt und spitzmäusig steht sie neben dem kräftigen, auch nicht sehr glücklich blickenden. Man muss zweimal hinschauen. Es ist Natalie Dessay neben ihrem Pianisten Philippe Cassard. In der Manier von Hochzeitsfotos aus der Urgroßelternzeit haben sich die beiden für das Cover und die Innenseiten ihrer Aufnahme mit Liedern aus der Epoche zwischen 1870 und 1940 von Fauré, Chabrier, Chausson und Duparc ablichten lassen. In Schwarz-Weiß. Das Motiv und der Brautschleier, den sich Dessay auf die Ringellöckchen gesetzt hat, gilt wohl vor allem Poulencs Fiançailles pour rire, die der Sammlung auch den Titel gaben (Erato 4614405). Den Auftakt der im Juni 2014 in der Salle Colonne in Paris entstandenen Aufnahme bilden sechs Lieder von Fauré, darunter das frühe Meisterwerk Après un rêve, drei Lieder nach Texten aus Verlaines Gedichtsammlung Fȇtes galantes sowie Spleen aus dessen späterer Sammlung Romances sans paroles. Irritiert ist man auch beim Hören. Dessay, so der Eindruck, muss sich mächtig anstrengen, und dennoch entfaltet die ungemein zerbrechlich wirkende Stimme keine Kraft und Volumen. Ich drehe den Ton auf, doch dann wird bei Mandoline nur der von Cassard brillant ausgekostete Klavierpart lauter.
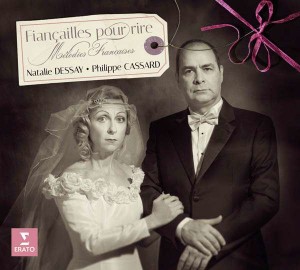 Dessays zirpender Sopran bleibt fein und dezent, ist oft schlierig und unsauber, und macht auch wenig aus dem Text. Nicht aus Chabriers strophischem Chanson pour Jeanne, nicht aus Poulencs kleinem Zyklus Fiançailles pour rire (Verlobung zum Spaß) nach Gedichten der Autorin Louise de Vilmorine, welche Poulenc bezauberte, „weil sie schön ist, weil sie hinkt, weil sie ein Französisch von natürlicher Schönheit schreibt“; in ihren Gedichten, darunter ein Titel wie Mein Leichnam ist weich wie ein Handschuh fand er „eine Art gemütvolle Impertinenz, Libertinage, Naschhaftigkeit“. Es stellt sich offenbar eine gewisse Gewöhnung ein, denn Duparc und Chausson, darunter Les temps des lilas, quasi eine Reflektion von Duparcs Soupir, gelingen Dessay, die bereits ihren Abschied von der Oper angekündigt hat, in Nuancen vorteilhafter, man gerät in den Bann der Musik und des sensiblen Spiels von Philippe Cassard. Der Vollständigkeit halber: Bei einem Lied von Poulenc ist Gatte Laurent Naouri beteiligt, bei Chaussons Chanson perpétuelle das Quatuor Ebène.
Dessays zirpender Sopran bleibt fein und dezent, ist oft schlierig und unsauber, und macht auch wenig aus dem Text. Nicht aus Chabriers strophischem Chanson pour Jeanne, nicht aus Poulencs kleinem Zyklus Fiançailles pour rire (Verlobung zum Spaß) nach Gedichten der Autorin Louise de Vilmorine, welche Poulenc bezauberte, „weil sie schön ist, weil sie hinkt, weil sie ein Französisch von natürlicher Schönheit schreibt“; in ihren Gedichten, darunter ein Titel wie Mein Leichnam ist weich wie ein Handschuh fand er „eine Art gemütvolle Impertinenz, Libertinage, Naschhaftigkeit“. Es stellt sich offenbar eine gewisse Gewöhnung ein, denn Duparc und Chausson, darunter Les temps des lilas, quasi eine Reflektion von Duparcs Soupir, gelingen Dessay, die bereits ihren Abschied von der Oper angekündigt hat, in Nuancen vorteilhafter, man gerät in den Bann der Musik und des sensiblen Spiels von Philippe Cassard. Der Vollständigkeit halber: Bei einem Lied von Poulenc ist Gatte Laurent Naouri beteiligt, bei Chaussons Chanson perpétuelle das Quatuor Ebène.
Eine absolute Gegenposition dazu bezieht Joyce Di Donato. Alles ist glut- und blutvoll gesungen, da pulsiert das Leben. Es war „ein vergnüglicher Abend“ schrieb die Presse, nach dem Abend von Joyce DiDonato und Antonio Pappano, mit dem sie im September 2014 die Saison der Wigmore Hall eröffneten. Der Abend von Joyce & Tony. Live at Wigmore Hall ist jetzt auf zwei CD erschienen (Erato 0825646107898, dreisprachiges Beiheft, dessen dt. Übersetzung abbricht). Sicherlich eine schöne Erinnerung an das Konzert. Ansonsten ist mir manches zu bullerig, zu gewollt und energisch, eher flüssig als charmant, in Non ti scordar di me wirkt DiDonatos Mezzosopran unruhig, streng und grell. Haydns Arianna a Naxos, Rossinis Beltà Crudele, La Danza und der vierteilige Zyklus I canti della sera von Francesco Santoliquido, verhangen gefühlvoll, nicht ganz auf DiDonato-Niveau, bilden den ersten Teil. Auf der zweiten CD dann ein kunterbuntes Programm, was gar nicht störend wäre, American Songbook von Fosters Beautiful Dreamer über Musical-Evergreens von Kern (Can’t help lovin‘ Dat Man, All the Things You Are) bis zu Arlens Over the Rainbow, dessen Stimmungen DiDonato derartig ausreizt, in zirzensischen Flitter auflöst und auf Effekt anlegt, dass man selbst bei dem virtuosen, südamerikanisch inspirierten Amor von William Bolcom und All the Things you Are, das eine Norman im Vergleich geradezu unverkünstelt und spontan anging, zwischendurch die Lust am Hören verliert.
 Das wird bei Juan Diego Flórez nicht passieren. Aus dem kleinen Prinzen, der in Rossinis Opern brillierte, ist inzwischen fast ein Draufgänger geworden, der für seinen einstündigen Italia-Ausflug (Decca 47884088) nicht mehr Cenerentola-like mit der Märchenkutsche anreist, sondern im roten Lamborghini vorgefahren kommt, wie einst Corelli und di Stefano bei Neapolitan Songs – die saßen allerdings selbst am Steuer oder entstiegen dem Wagen, während Flórez nur daran lehnt. Vielleicht ist ihm im Flitzer doch nicht ganz geheuer. Siebzehn Lieder (Canzoni), mehr oder weniger der eiserne Bestand eines Italian Songbook, wie es schon von Caruso über Schipa und Gigli bis Corelli, di Stefano und Pavarotti hoch gehalten wurde, bilden das kurzweilige Programm, darunter Rossinis Bolero, La Danza und Leoncavallos Mattinata ebenso wie Torna a Surriento und Non ti Scordar di me von De Curtis, Gastaldons Musica Proibita, Tostis Marechiare und L‘ alba separa dalla luce l‘ ombra. Flórez singt nicht mit dem draufgängerischen Elan (bei La Danza dann schon) und der Wärme eines di Stefano, aber generös, mit der gewohnten Finesse, Geschmack und Kultur, etwas sehr ausgestellten Höhen, mit betörendem Diminuendo, mit klar-präzisem Ton, mit Glanz und crescendierender Stimmentfaltung, das gilt auch für Schlager wie Chitarra Romana und Nel Blu, Dipinto di Blu. Man kann nicht genug davon bekommen. Einziger Schwachpunkt des von Carlo Tenan, einer Reihe von Solisten (Mandoline, Gitarre, Gitarre) und der Filarmonica Gioachino Rossini begleiteten Recitals ist das nichts sagend, vielsprachige Beiheft mit einer Grußwort des Tenors (natürlich: ein „sehr persönliches Album“). Da wird doch sicherlich eine Fortsetzung folgen, schließlich sagte Flórez „Arrivederci“.
Das wird bei Juan Diego Flórez nicht passieren. Aus dem kleinen Prinzen, der in Rossinis Opern brillierte, ist inzwischen fast ein Draufgänger geworden, der für seinen einstündigen Italia-Ausflug (Decca 47884088) nicht mehr Cenerentola-like mit der Märchenkutsche anreist, sondern im roten Lamborghini vorgefahren kommt, wie einst Corelli und di Stefano bei Neapolitan Songs – die saßen allerdings selbst am Steuer oder entstiegen dem Wagen, während Flórez nur daran lehnt. Vielleicht ist ihm im Flitzer doch nicht ganz geheuer. Siebzehn Lieder (Canzoni), mehr oder weniger der eiserne Bestand eines Italian Songbook, wie es schon von Caruso über Schipa und Gigli bis Corelli, di Stefano und Pavarotti hoch gehalten wurde, bilden das kurzweilige Programm, darunter Rossinis Bolero, La Danza und Leoncavallos Mattinata ebenso wie Torna a Surriento und Non ti Scordar di me von De Curtis, Gastaldons Musica Proibita, Tostis Marechiare und L‘ alba separa dalla luce l‘ ombra. Flórez singt nicht mit dem draufgängerischen Elan (bei La Danza dann schon) und der Wärme eines di Stefano, aber generös, mit der gewohnten Finesse, Geschmack und Kultur, etwas sehr ausgestellten Höhen, mit betörendem Diminuendo, mit klar-präzisem Ton, mit Glanz und crescendierender Stimmentfaltung, das gilt auch für Schlager wie Chitarra Romana und Nel Blu, Dipinto di Blu. Man kann nicht genug davon bekommen. Einziger Schwachpunkt des von Carlo Tenan, einer Reihe von Solisten (Mandoline, Gitarre, Gitarre) und der Filarmonica Gioachino Rossini begleiteten Recitals ist das nichts sagend, vielsprachige Beiheft mit einer Grußwort des Tenors (natürlich: ein „sehr persönliches Album“). Da wird doch sicherlich eine Fortsetzung folgen, schließlich sagte Flórez „Arrivederci“.
 Im Februar diesen Jahres hat der 28jährige Schweizer Tenor Mauro Peter in Zürich ein Schubert-Programm mit Goethe-Liedern aufgenommen (Sony 88875083883), mit dem er im Sommer auch bei der einst von Hermann Prey gegründeten Schubertiade auftrat. Sein Begleiter hier wie dort war Helmut Deutsch, der nicht nur beim Goethe-Programm bereits mit Prey zusammenarbeitete und jetzt Peters CD-Debüt adelt. Umrahmt von den Sturm-und-Drang -Gedichten Ganymed und Willkommen und Abschied erklingen u. a. die Gesänge des Harfners, Erlkönig, Der König von Thule, Heidenröslein, für die Peter jeweils einen individuellen Ton und erzählerische Klangpoesie entwickelt. Das wirkt in den kurzen Rastlosen Liebe und Der Musensohn spontan, doch nie unreflektiert, und bei beispielhafter Textdeutlichkeit stets mustergültig und eindringlich gestaltet. Peters lyrischer Mozart-Tenor besitzt Gewicht, ist klangvoll durchgebildet – in An den Mond leuchtend ausgemalt -, wird der im zarten Piano verhauchenden Poesie des Heiderösleins ebenso gerecht wie dem Strophenlied Der Fischer oder dem mächtigen Gemälde des Erlkönigs. Ein ausgezeichneter Einstand. Rolf Fath
Im Februar diesen Jahres hat der 28jährige Schweizer Tenor Mauro Peter in Zürich ein Schubert-Programm mit Goethe-Liedern aufgenommen (Sony 88875083883), mit dem er im Sommer auch bei der einst von Hermann Prey gegründeten Schubertiade auftrat. Sein Begleiter hier wie dort war Helmut Deutsch, der nicht nur beim Goethe-Programm bereits mit Prey zusammenarbeitete und jetzt Peters CD-Debüt adelt. Umrahmt von den Sturm-und-Drang -Gedichten Ganymed und Willkommen und Abschied erklingen u. a. die Gesänge des Harfners, Erlkönig, Der König von Thule, Heidenröslein, für die Peter jeweils einen individuellen Ton und erzählerische Klangpoesie entwickelt. Das wirkt in den kurzen Rastlosen Liebe und Der Musensohn spontan, doch nie unreflektiert, und bei beispielhafter Textdeutlichkeit stets mustergültig und eindringlich gestaltet. Peters lyrischer Mozart-Tenor besitzt Gewicht, ist klangvoll durchgebildet – in An den Mond leuchtend ausgemalt -, wird der im zarten Piano verhauchenden Poesie des Heiderösleins ebenso gerecht wie dem Strophenlied Der Fischer oder dem mächtigen Gemälde des Erlkönigs. Ein ausgezeichneter Einstand. Rolf Fath


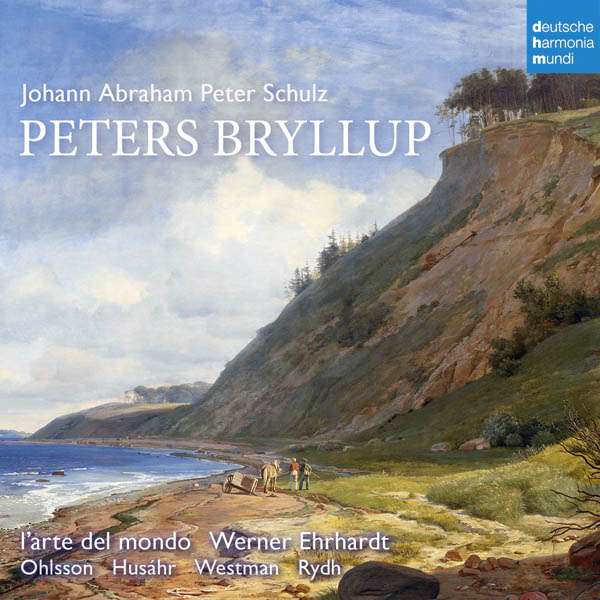



 Erwähnung findet die Arbeit mit
Erwähnung findet die Arbeit mit 


