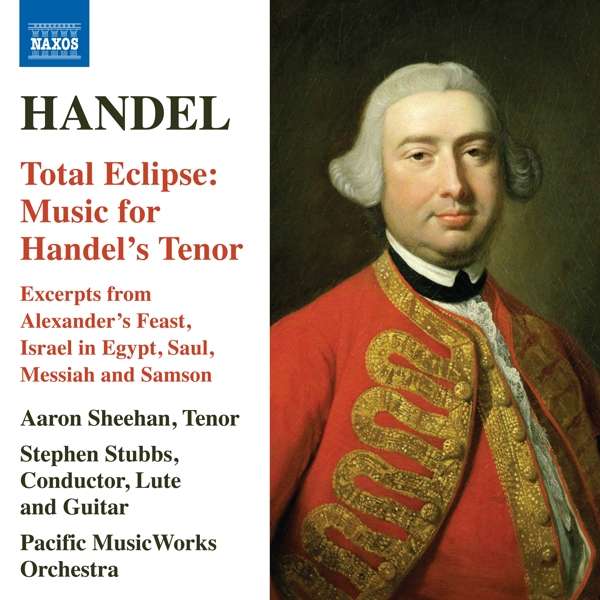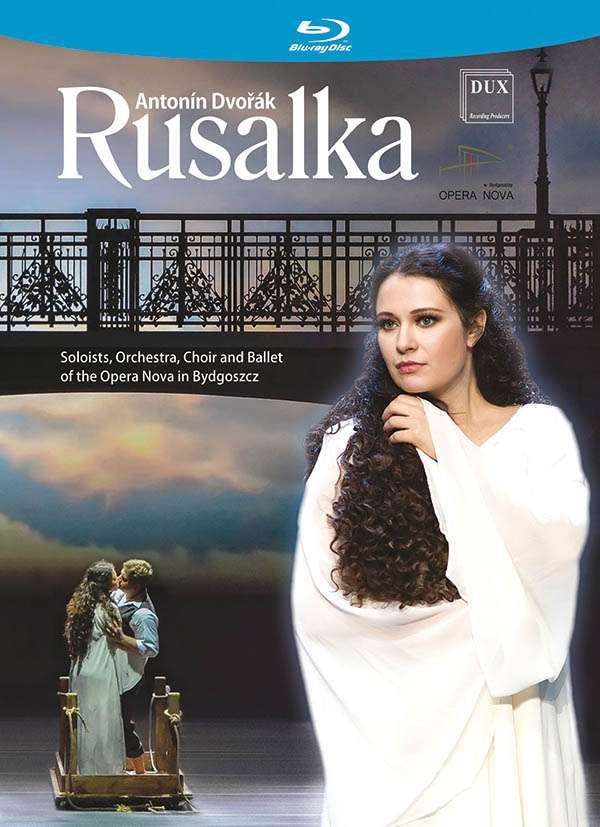Mit Kirill Kondraschin verband mich eine nachhaltige Seelen-Freundschaft, die in jenen langen Wochen seiner Deutschlandtournee mit wechselnden Rundfunkorchestern im Frühjahr 1979 begann, als ich ihn für die deutsche Agentur Wolfgang Wiesbaden im Auftrag der russischen Zentralagentur betreute. Ich hätte ihn zwar am Ende des Sommer erwürgen können, als er plötzlich im besten Deutsch zu einem Gelage einlud, während er vorher sich stets von einem der vielen russischen Orchestermitgleider dolmetschen ließ und wir beide in seinem zweifelhaften Englisch kommunizierten. Aber er öffnete sich mir und sprach viel von seinen Gründen, in den Westen, Amsterdam, flüchten zu wollen. Wobei ich ihm half. Das war eine schwere Entscheidung – zumal seine Frau Nina wieder zurück nach Moskau wollte, wegen der Kinder. Später wurden sie geschieden und Kondraschin heiratete in Holland neu. Er war ein wunderbarer Mensch und Mann, durchdrungen von Musik wie nur Russen das sind. Seine Proben zu Schostakowitsch waren ein unvergessliches Erlebnis, das sich jedes Mal neu wiederholte, wenn er vor einem anderen Orchester stand. Seine Kommunikation mit den Musikern war eine unglaublich spontane, fast ein Liebesakt. Intensiv und mir bis heute eingebrannt in die Erinnerung. Wir blieben lange jahre im Kontakt, und ich besuchte ihn in Amsterdam einige Male. Er war wie John Barbirolli einer der bedeutendsten Musiker, den ich kennen durfte.
Deshalb ist es uns ein Anliegen, die nachstehenden Kollektionen auf BR Klassik vom Beyerischen Rundfunk und bei Hänssler Profil vorzustellen und an ihn zu denken. Daniel Hauser berichtet. G. H.

Kyrill Kondraschin/ European Collections
Kirill Kondraschin war fraglos einer der bedeutendsten sowjetischen Dirigenten überhaupt. Anders als seine wichtigsten Kollegen, der anderthalb Jahrzehnte ältere Jewgeni Mrawinski und die anderthalb Jahrzehnte jüngeren Jewgeni Swetlanow und Gennadi Roschdestwenski, wagte er am Ende seines Lebens, 1978, den Sprung in den Westen. Dort arbeitete er besonders mit dem Concertgebouw-Orchester in Amsterdam, dessen Zweiter Dirigent er wurde, sowie mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, zu dessen Chefdirigenten er bereits designiert war, als er im März 1981 völlig überraschend erst 67-jährig starb. Die vom BR-Eigenlabel vorgelegten Aufnahmen (BR Klassik 9007004) entstanden ein gutes Jahr zuvor, am 7. und 8. Februar 1980, im Herkulessaal der Münchner Residenz. Es handelt sich um die Konzertouvertüre Russische Ostern von Nikolai Rimski-Korsakow sowie um die Sinfonie in d-Moll von César Franck.
Mit beiden Komponisten setzte sich Kondraschin in seinen späten Jahren verstärkt auseinander. So spielte der Rimski-Korsakows Scheherazade in einer von der Kritik gefeierten Aufnahme mit dem Concertgebouw-Orchester 1979 für Philips ein. Die Sinfonie von Franck hatte er bereits 1977 ebenfalls in Amsterdam dirigiert; der Mitschnitt wurde von Tahra veröffentlich (vergriffen). Dass der russische Dirigent ein Händchen für die Musik seiner Landsleute hat, braucht an dieser Stelle wahrlich nicht näher belegt zu werden. So nimmt es nicht wunder, dass Kondraschins farbenprächtige Wiedergabe der Oster-Ouvertüre gerade auch wegen der Klasse des BR-Symphonieorchesters zu den empfehlenswertesten gerechnet werden darf.
Der gebürtige Belgier und spätere Wahlfranzose Franck legte gewiss eine der bedeutendsten französischen Sinfonien des 19. Jahrhunderts vor. Trotz aller Bemühungen tut sich dieses etwas sperrige Werk aber noch heute schwer, sich wirklich zum Standardrepertoire rechnen zu lassen. Sie ist vor allem auch ein Spätwerk dieses Komponisten, 1888 gerade zwei Jahre vor seinem Tode vollendet. Kondraschin, der nicht eben als Experte für französische Musik berühmt wurde, legt nichtsdestotrotz eine überzeugende Lesart vor, die im großformatigen Kopfsatz zwischen der stetig auftretenden Ruhelosigkeit einerseits und der Majestät des Hauptthemas zu kontrastieren versteht. Der gar nicht so langsame Mittelsatz mit seiner vergeistigten Aura bildet eine Phase der Verinnerlichung. Beschlossen wird die Sinfonie durch ein furios dargebotenes Finale, das das Werk mit seiner per aspera ad astra-Anlage freudig ausklingen lässt. An bedeutenden Vergleichsaufnahmen besteht kein Mangel, angefangen beim exemplarischen Pierre Monteux (RCA) über Ernest Ansermet (Decca) bis hin zu Leonard Bernsteins exzentrischer Interpretation mit breitem Zeitmaß (DG). Auch von Kondraschins Landsmann Jewgeni Swetlanow ist eine Aufnahme überliefert (Weitblick). Neben all diesen kann sich die BR-Einspielung sehr gut behaupten, die Francks nicht eben sofort zugängliche Sinfonie fast kurzweilig erscheinen lässt.
Die klangliche Qualität ist glücklicherweise insgesamt auf einem ähnlich hohen Niveau wie die künstlerische, so dass eine volle Kaufempfehlung für diese in allen wesentlichen Punkten überzeugende BR-Produktion ausgesprochen werden kann. Einzig die mit gerade 52 Minuten kurze Gesamtspielzeit der CD wäre anzumerken. Daniel Hauser

Kirill Kondraschin in Japan 1980/ youtube
Unter den großen russischen Dirigenten des 20. Jahrhunderts hat Kirill Kondraschin (1914-1981; in dieser Edition mit „y“ geschrieben) seinen festen Platz, gilt er doch als der bedeutendste Dirigent Russlands in der Generation zwischen Jewgeni Mrawinski (1903-1988) und Jewgeni Swetlanow (1928-2002). Was ihn von diesen unterscheidet, ist gerade auch, dass er 1978 die Sowjetunion verließ und in den Westen emigrierte. In den Niederlanden fand er eine zweite Heimat, heiratete und wurde bereits im selben Jahr zweiter Dirigent des renommierten Concertgebouw-Orchesters in Amsterdam. Sein früher Tod im März 1981 infolge einer Herzattacke setzte diesem neuen Lebensabschnitt leider unerwartet rasch ein jähes Ende.
Profil Edition Günter Hänssler (PH 18046) bedenkt ihn nun mit einer 13 CDs umfassenden Kollektion, welche Aufnahmen zwischen 1937 und 1963 beinhaltet, wobei der Schwerpunkt auf den späten 1950er und frühen 60er Jahren liegt. Tatsächlich erlangte Kondraschin besonders ab 1960 internationale Berühmtheit, stand er doch ab diesem Jahre den Moskauer Philharmonikern für anderthalb Jahrzehnte als Chefdirigent vor. Dass hier die letzten, künstlerisch so ertragreichen beiden Lebensjahrzehnte des Dirigenten völlig ausgespart wurden, ist erst einmal unverständlich, wohl aber nicht zuletzt auf Lizenz-Gründe zurückzuführen. Es werden hier also der frühe und mittlere Kondraschin abgedeckt, seine späteren Jahre indes ausgeklammert.
 Bei der ältesten in der Box inkludierten Aufnahme handelt es sich um die Ouvertüre zur Verkauften Braut von Smetana aus Leningrad 1937. Hier ist sogar ein Vergleich möglich, ist doch auch eine (russisch gesungene) Gesamtaufnahme dieses Werkes von 1949 aus dem Moskauer Bolschoi-Theater enthalten. Sicherlich keine besonders idiomatische Angelegenheit, doch trösten das inspirierte Dirigat und das gute Sängerensemble (darunter Elisabeta Schumilowa, Georgi Nelepp, Anatole Orfenow und Nikolai Schtschelgolkow) darüber hinweg. Der Klang ist selbst in der 1937er Einspielung durchaus erträglich, wie übrigens in der gesamten Kollektion, in der etwa die Hälfte aus Monoaufnahmen besteht.
Bei der ältesten in der Box inkludierten Aufnahme handelt es sich um die Ouvertüre zur Verkauften Braut von Smetana aus Leningrad 1937. Hier ist sogar ein Vergleich möglich, ist doch auch eine (russisch gesungene) Gesamtaufnahme dieses Werkes von 1949 aus dem Moskauer Bolschoi-Theater enthalten. Sicherlich keine besonders idiomatische Angelegenheit, doch trösten das inspirierte Dirigat und das gute Sängerensemble (darunter Elisabeta Schumilowa, Georgi Nelepp, Anatole Orfenow und Nikolai Schtschelgolkow) darüber hinweg. Der Klang ist selbst in der 1937er Einspielung durchaus erträglich, wie übrigens in der gesamten Kollektion, in der etwa die Hälfte aus Monoaufnahmen besteht.
Außer dieser einzigen Oper sind ansonsten reine Instrumentalaufnahmen enthalten: Sinfonien, Konzerte, Serenaden und sonstige Orchesterwerke. Von besonderem Interesse ist die Welturaufführung der 13. Sinfonie Babi Jar von Schostakowitsch vom 18. Dezember 1962 aus dem Großen Saal des Moskauer Konservatoriums. Es spielten die Moskauer Philharmoniker, Bassist war Witali Gromadski. Bis heute muss sich wohl jede Neuaufnahme an dieser Interpretation messen, die (am Ende aufgrund des enthusiastischen Applauses hörbar) ein gewaltiger Erfolg war und mit zum Ruhm des Dirigenten Kirill Kondraschin beitrug. Der Klang ist, zieht man das Alter und die Live-Situation in Betracht, ganz ausgezeichnetes Stereo.
Nicht weniger überzeugend fällt Kondraschins Einspielung der Sinfonie Nr. 6 Pathétique von Tschaikowski aus, die bereits 1959 im Studio entstand. Sie darf sich ebenfalls einreihen in die bedeutenden Darbietungen dieses häufig aufgenommenen Werkes. Interessanterweise hat sich Kondraschin den übrigen Tschaikowski-Sinfonien nicht in offiziellen Studioproduktionen angenommen, auch wenn – abgesehen von der Zweiten – eine jede in mindestens einem Live-Mitschnitt vorliegt. Gleichwohl spielt dieser Komponist eine bedeutende Rolle in der Box, sind doch noch das Capriccio Italien, die Streicherserenade, die Suite Nr. 3, das Klavierkonzert Nr. 1 (Solist: Emil Gilels), das Violinkonzert (Solist: David Oistrach) und die weniger im Mittelpunkt stehende Sérénade mélancolique (wiederum mit Oistrach) sowie das Pezzo capriccioso (Solist: Mstislaw Rostropowitsch) berücksichtigt. Es ist hier also die illustre Crème de la Crème der bedeutenden seinerzeitigen sowjetischen Solisten versammelt, die zum Gelingen kongenial beiträgt. Besonders Oistrach kommt noch weiters zum Zuge, so in der Suite de Concert von Tanejew, im Violinkonzert von Strawinski und in Tzigane von Ravel. Swjatoslaw Richter steht im Klavierkonzert von Rimski-Korsakow zur Seite, Leonid Kogan im Violinkonzert Nr. 1 von Schostakowitsch sowie im Violinkonzert von Weinberg, Emil Gilels in Ravels Klavierkonzert für die linke Hand und Wiktor Pikaisen schließlich im 1. Violinkonzert von Paganini. Den Solopart im 1. Cellokonzert von Schostakowitsch übernimmt wiederum Rostropowitsch. Die enorme Bandbreite des Repertoires, welches Kirill Kondraschin abdeckte, wird bereits daraus ersichtlich.

Kirill Kondraschin in Japan 1980/ youtube
Abgerundet wird dies durch weitere Orchesterwerke wie das Capriccio Espagnol von Rimski-Korsakow, die Rapsodie Espagnole sowie La valse von Ravel und die Paganiniana von Alfredo Casella. Eher randständiges Repertoire wie Weinbergs Sinfonie Nr. 4 geht Hand in Hand mit Rachmaninows Sinfonie Nr. 3 und seinen Sinfonischen Tänzen. Dass Kondraschin sich gerade auch zeitgenössischen Komponisten widmete, zeigte bereits der Fall Schostakowitsch, doch auch Paul Hindemith (Sinfonische Metamorphosen von Themen Carl Maria von Webers) und Rodion Schtschedrin (Konzert für Orchester Nr. 1 Freche Orchesterscherze) sind in dieser Kollektion zu finden.Obwohl also die letzten achtzehn Jahre des Wirkens Kondraschins hier keine Berücksichtigung finden, darf die Box insgesamt als große Bereicherung gelten, sind in ihr doch neben einigen „Blockbustern“ vor allen Dingen ansonsten weniger beachtete Werke in tadellosen Interpretationen enthalten. Die etwa die Hälfte ausmachenden Stereoproduktionen sind klanglich über jeden Zweifel erhaben, aber auch die älteren Monoaufnahmen wurden bemerkenswert überzeugend aufbereitet. Insofern steht einer uneingeschränkten Empfehlung nichts im Wege (Fotos: Screenshots aus dem Japan-Konzert 1980 auf youtube) . Daniel Hauser
















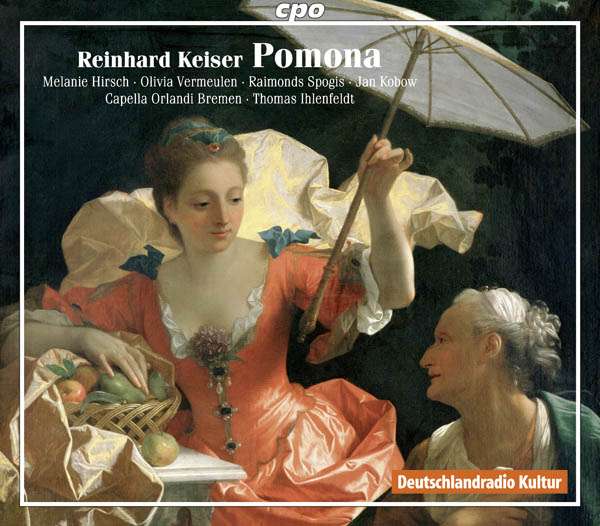








 Louis-Nicolas Clérambault
Louis-Nicolas Clérambault