.
Im November 2014 gab es – wohlverdient, wenngleich vielleicht als Werk etwas wenig schwungvoll und zudem natürlich nicht erstmals in der Moderne vorgeführt, sondern bereits 1984 in Oberhausen gehört/gesehen – im Münchner Prinzregententheater Die Loreley von Max Bruch, Mendelssohn-verhaftet und spätromantisch-deutsch, inzwischen gibt es davon auch eine Cd-Einspielung..
Das brachte uns auf die Idee – sozusagen als europäischer Süd-Nord-Kontrast – einen Artikel über die andere, berühmtere Loreley von Alfredo Catalani zu bringen, die in verschiedenen Live-Aufnahmen und sogar offiziell, wenngleich inzwischen vielleicht auch vergessen, bei Bongiovanni, opera.net und Gala vorliegt und die ganz anders mit dem „deutschen“ Sujet umgeht, eben spätromantisch-nach vorne blickend, schwungvoll. Vor allem Ausdruck einer Idee der Erneuerung verhaftet, bietet diese Oper doch – mehr noch als die Wally, finde ich – diese spannende Symbiose von italienischer, schon in die Neuzeit drängender Melodik und deutscher Beeinflussung in der Folge Wagners, dazu (wie bei Franchetti und anderen der Zeit) diese Hinwendung zur cisalpinen Kultur des deutschsprachigen Raums. Eine wirklich packende Mischung!

„Loreley“: Alfredo Catalani vor der Mailänder Scala (OBA)
Seine Oper Wally erinnert uns, dass er immer noch weitgehend der Vergessenheit anheim gefallen ist und als „Ein-Opern-Komponist“ (eben der Wally) gilt. Es gab Zeiten, wenigstens in ltalien, während derer die beiden erfolgreichsten Werke des Komponisten aus Lucca, die Loreley und die reifere Wally, regelmäßig sogar in den kleineren Theatern der Provinz zirkulierten, sehr akklamiert und bleibende Begeisterung hinterlassend.
Dies war nur bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges möglich. Dann, in der Nachkriegszeit, gerieten die beiden bekannteren Kompositionen Catalanis in Vergessenheit. Andererseits hatten fast alle melodramatischen Opern-Werke der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehr oder weniger das gleiche Schicksal: Sie wurden buchstäblich verdrängt durch die alles überwaltigende Präsenz eines reifen Verdi. Außerdem trug die (in ltalien ziemlich späte) Erscheinung der Werke Wagners zur Verwirrung der einheimischen Musiker bei. Wie auf diesen Giganten reagieren?
.
Was bleibt heute übrig von Namen wie Apolloni, Petrella, Marchetti, Gomes oder Cagnoni – alles seriöse Komponisten einer großen, wenn auch vielleicht kurzlebigen Popularität. Nur zwei Werke überlebten. wenn auch aus verschiedenen Gründen: Boitos Mefistofele und Ponchiellis Gioconda – ersteres wegen seiner beruhigenden Rückwärtsgewandtheit, letzteres wegen seiner Melodienseligkeit.

„Loreley“: Salomea Krushelnytska war eine brühmte Loreley/OBA
Mit dieser Hypothek Verdi und Wagner im Rücken: Wieviel Raum blieb da im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in einem problematischen konservativen Kontext für einen jungen, unerfahrenen Komponisten wie Alfredo Catalani, der mit seiner angegriffenen Gesundheit von halluzinativer Imagination gequält und von den Fieberträumen einer musikalischen und ästhetischen Erneuerung dominiert wurde, deren Umsetzung schwierig, wenn nicht gar unmöglich schien? Nichtsdestotrotz begeisterte der junge Mann aus Lucca mit seiner guten literarischen Ausbildung und soliden musikalischen Kultur, die er am Mailänder Konservatorium erworben und danach vertieft hatte während eines kurzen, gewinnbringenden Aufenthaltes in Paris. Dies schlug sich nieder in der ersten kurzen Oper, La Falce, die er gegen Ende seines Studiums vorstellte. In der Folge davon scharte er eine Gruppe glühender, einflussreicher Verehrer um sich, zu denen auch Boito und Faccio (Verdis Aida-Dirigent und kürzlich hier in operalounge.de mit seinem Amleto in Albuquerque gewürdigt), aber auch die kluge Verlegerin Lucca gehörten, letztere stets auf der Ausschau nach vermarktbaren Talenten. Sie wie die anderen stellte fest, dass hier ein exquisiter Sinn für Harmonie, eine ungewöhnliche musikalische Transparenz herrschten, vor allem eine erstaunliche Begabung für die Erstellung einer Geschichte auf der Basis eine logischen, symphonischen Sujets. Das alles reichte aus, um den jungen Catalani als einen Exponenten eines intellektuellen Wendepunktes zu feiern, der endlich das italienische melodramma von seiner altmodischen, wenn auch vielgeliebt-brillanten Verhaftung an ein altes Regime zu befreien und wieder in das Zentrum der europäischen, nicht nur der als altbacken-italienischen empfundenen Kultur rücken würde. Der alte Traum der Mailänder Bohème, der Scappigliatura, schien in Erfüllung zu gehen, die bislang nur mit Boitos Erneuerungen des italienischen Klanges hervorgetreten war.

„Loreley“: Lucca 1982 (GB)
Obwohl sich der Beginn von Catalanis Karriere also so gut angelassen hatte und er als strahlender Hoffnungsträger galt, stand der nachfolgende Teil unter keinem guten Stern. Er kämpfte sein ganzes kurzes Leben gegen alle Energien verzehrende Krankheiten, die ihm einen frühen Tod bereiteten. Dennoch setzte er sich mit zäher Energie als Bühnenkomponist durch, nun auch trotz der allgemeinen Gleichgültigkeit, die den ehemaligen Enthusiasmus der Öffentlichkeit ersetzt hatte – eine Tatsache, die der Catalani-Champion Toscanini vielfach beklagte und die sich bis heute auswirkt. Viele Häuser und Dirigenten können davon ein Lied erzählen, wenn sie Catalanis Werke, außer der Wally, aufführen wollten und mit den Ricordischen „Schwierigkeiten des Orchestermaterials“ kämpfen mussten. Die Blockade Ricordis, um den favorisierten Puccini zu protegieren, galt noch bis in die Nachkriegszeit (die bereits erwähnte Verlegerin Lucca hatte Catalani durchaus zu einem Konkurrenten Verdis und des jungen Puccini aufgebaut; nach ihrem Tod kaufte der kluge Ricordi das ganze Noten-Konvolut auf, darunter eben auch Catalanis Partituren, die erst einmal für lange Zeit in den Tiefen des Ricordi-Archives verschwanden und von dem Verlag eben auch nicht mehr zur Aufführung angeboten wurden – so wie es auch anderen Komponisten wie Faccio erging).
.

„Loreley“: Buenos Aires 2010/Teatro Colón/Liliana Morsia
In dieser schon Tuberkulose-fiebrigen, anstrengenden Atmosphäre einer kurzen Lebensspanne entstand ein Werk nach dem anderen: die phantastische Elda (1880), die fragmentarische und faszinierende Dejanice (1883), die zugänglichere, bizarre Edmea (1886), die reifere Loreley (1890) und vor allem die Wally (1892), der ein langes Bühnenleben beschieden war, nicht zuletzt wegen des imperativen Einsatzes von Arturo Toscanini, dem Freund und Bewunderer Catalanis.
Loreley, die vom Publikum des Teatro Reggio in Turin anfänglich lauwarm, später begeisterter und überzeugter aufgenommen wurde, besteht aus einer Überarbeitung des Jugendwerkes Elda unter Verwendung des Großteils der Musik, jedoch mit plausiblerer Orchestrierung. Die Handlung (inspiriert von nordischen Sagen), vom Elda-Librettisten Carlo D ‚Ormeville an die baltische Küste verlegt, wurde für die Loreley an ihren neuen Schauplatz am Ufer des Rheins transportiert, der durch Heinrich Heines Gedicht, auch in der Vertonung Liszts, sich großer Beliebtheit erfreute und allgemein bekannt war – der Inbegriff der deutschen Romantik.

„Loreley“: Koblenz 1980/ OBA
Aber das lnteressante an dieser Oper ist nicht das Libretto, wenngleich die Wahl eines so phantastischen, für ltalien ungewöhnlichen Sujets in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts durch den Einfluss Wagners plausibel erscheint (Lohengrin grüßt). Selbst wenn die Loreley letztendlich kein wirklich erfolgreiches Werk wurde, so erscheint sie doch bedeutend wegen der träumerischen Phantasie, wegen Catalanis Gabe für harmonische und instrumentale Feinheiten und wegen eines müden Sich-Sehnens frei jeder Schematisierung, mit der er die realen und unwirklichen Umstände seiner Charaktere, vor allem der weiblichen, charakterisiert. Musikalische Momente wie Annas unvergesslicher, quälender Begräbnismarsch mit seinem Wechsel von schmerzlichen Chor- und Solostellen oder der berühmte und auch oft im Konzert gegebene „Danza delle Ondine“ (Tanz der Undinen) schaffen eine irreale und doch reichhaltige Atmosphäre, sind beide Höhepunkte in der Opern-Literatur nicht nur Italiens.

„Loreley“: Scala 1968 Elena Souliotis und Gianfranco Cecchele/Opera d´Oro
Wenn man genau in die Musik hineinhört, erscheint das imponierende Finale des zweiten Aktes hervorragend konstruiert und das abschließende Schluss-Duett sehr wirkungsvoll, wenn auch ein wenig emphatisch, während einige der Chorteile nur als Beiwerk wirken und wenig zur Dramatik beitragen. Bei den Solopartien macht Anna den größten Eindruck mit ihrer Arie „Amor celeste ebrezza“, dem bekanntesten Stück der Oper und fälschlicherweise stets mit der Loreley selber assoziiert. Die einst beliebte Romanze Walters im ersten Akt erscheint uns heute doch eher sentimental im konservativ-alten Stil

„Loreley“: Gigliola Frazzoni/Gala
Die Frage nach der Aufführbarkeit der Oper muss man unbedingt bejahen, besonders weil Loreley einen noblen, wenngleich glücklosen Versuch darstellt, das italienische Musiktheater des auslaufenden 19. Jahrhunderts auf einen neuen, unabhängigen, eigenen Kurs zu bringen – weg van Verdis Einfluss und Wagners Lehren -, zwei Hypotheken, die man als gar nicht gravierend genug für die Folgezeit und für die neue Komponistengeneration die Folgezeit begreifen muss.
Der Tod hinderte Catalani an der Erfüllung seines ambitionierten Traumes. Dieser wurde später von der Jungen Schule mit größerem Nachdruck verfolgt – vor allem von Giacomo Puccini. Während Puccini eine kluge Distanz zu der träumerischen Illusion der nordischen Nebel und der traumverhafteten Romantik bewahrte, wandte er sich den ästhetischen, kulturellen und menschlichen Realitäten seiner Zeit zu und fand so den entscheidenden Stil, den Catalani nicht erfolgreich verwirklichen konnte. Als der alte Verdi die Nachricht von dem Tod seines jungen Kollegen erhielt, schrieb er an den Dirigenten Mascheroni: „Armer Catalani! Er war ein guter Mann und ein exzellenter Musiker! Schade, schade! Beglückwünschen Sie Giulio (Ricordi) für seine kurzen und schönen Worte, die er für diesen Armen sprach. Welche Schande ! Und welche Zurechtweisung für die anderen!“ Hatte er sich selbst auch mit eingeschlossen in „die anderen“?
.

„Loreley“: Marta Colalilo/GB
Verbreitung: Nach der Premiere 1890 in Turin war die Oper in ltalien sehr erfolgreich, und auch im Ausland wurde sie wiederholt gespielt (Odessa 1901, Buenos Aires 1905, London 1907, Rio 1910, Madrid 1916, Chicago und New York 1919; Daten nach Seeger/Opernlexikon), in Deutschland erstmalig in Koblenz 1980 in deutscher Sprache. In ltalien gab es sie dann erneut wieder nach dem 2. Weltkrieg bei der italienischen RAI mit Rina Gigli unter Alfredo Simonetto 1960, szenisch in Mailand 1968, Lucca 1982 und in Genua 1993 mit Marilyn Zschau in der Titelpartie, Denia Gavazzeni-Mazzola und Nicola Martinucci unter Gianandrea Gavazzeni, der auch die Vorstellung in Mailand dirigiert hatte. Eine Loreley gab es zudem erneut bei der RAI mit der Frazzoni 1973, in 1993 Verona mit der Dimitrova, Sighele und Merighi, in Buenos Aires mit (natürlich) der Lokalmatadorin Negri 2010. Von einer Aufführung unter Guido Rumstadt in Regensburg 2013 erfuhr ich aus dem Netz.
.

„Loreley“: Anna de Cavalieri/OBA
Dokumente: Heute/2023 nachgeschaut/ muss man leider sagen, dass fast alle Live-Dokumente wegen der Copyright-Restriktionen verschollen sind – die folgenden Angaben also nur aus der Sammlertruhe. Es existierte die erste RAI-Fassung bei GAO und in Auszügen die Koblenzer Aufführung mit Anne-Meike Eskelsen auf einer Privatpressung; bei Walhall/Gala gibt es die attraktive RAI-Besetzung mit De Cavalieri, Gigli, Neate, Guelfi auf CD (Amazon), bei Hunt, Memories/Nuova Era (Amazon) u. a. die Mailänder Produktion mit Elena Suliotis, Gianfranco Cecchele und Piero Cappucculli von 1968. Bongiovanni (Amazon) gab den Mitschnitt der Aufführung in Lucca 1986 mit Marta Collalillo, Piero Visconti und Alessandro Cassis heraus, der – trotz der substanziellen Kürzungen (wie an der Scala auch) – klanglich und sängerisch der empfehlenswerte ist. Und es gab eine Ausgabe bei der Download-Firma opera-club.net und anderen mit der Verona-Aufnahme von 1993 mit der Dimitrova unter Masini, der weitere Catalani-Dokumente (u.a. die Cavalieri-Aufnahme in Auszügen) angekoppelt sind.
.
.
Loreley: Oper in 3 Akten von Alfredo Catalani, Libretto von Carlo d ‚Ormeville und Angelo Zanardini Uraufführung: Turin 1890; Personen: Rodolfo, Markgraf von Biberich – Bariton, Anna di Rehberg, seine Tochter – Sopran, Walter. Duca di Obervvesel – Tenor. Hermann. Baron – Bariton, Loreley, ein armes Fischermädchen und anschließend eine Willi/verdammte und herumirrende Seele – Sopran. Edelleute, Volk, Soldaten; Nymphen und Geister Ort/Zeit: am Rhein um 1300
.
Inhalt: Im 1. Akt erfahren wir von der Verlobung Walters, des Grafen von Oberwesel, mit der jungen Anna. Tochter des Markgrafen von Biberich. Walter ist aber auch in das arme Fischermädchen Loreley verliebt und erzählt seinem Freund Hermann, der seinerseits Anna liebt, von dieser aussichtlosen Zuneigung. Er entschließt sich bei seinem Zusammentreffen mit Loreley, sich von ihr zu trennen. Diese ist tief getroffen und verliert den Sinn für die Wirklichkeit. Sie fleht den König des Rheines, den Geisterfürsten, an, ihr ewige Schönheit zu verleihen, damit sie sich an den Männern rächen kann. Wenn sie seine Braut würde und niemandem anderem gehören wolle, verspricht der Rheinkönig, gingen ihre Wünsche in Erfüllung. Loreley stürzt sich in die Fluten und steigt als unwiderstehliche Geistererscheinung daraus hervor.

„Loreley“: Adelaide Negri/OBA
Im 2. Akt werden auf der Burg von Annas Vater die letzten Vorbereitungen zur Hochzeit getroffen. Hermann versucht, seine heimliche Geliebte vor der Untreue ihres Bräutigams zu warnen, aber sie hört nicht auf ihn, sondern singt ein Lied auf die Liebe („Amor celeste ebrezza“). Als der Hochzeitszug vor der Kirche ankommt, entsteigt dem Rhein die zauberhafte Loreley und lockt die Männer mit ihrem Lied. Walter kann sich ihren Reizen nicht entziehen und stürzt ihr nach, die Hochzeitsgesellschaft verflucht ihn.
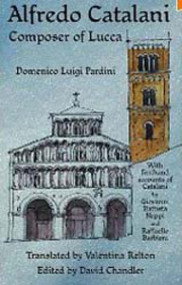 Im 3. Akt sind wir am Ufer des Rheins, wo sich Holzfäller von der magischen jungen Frau erzählen, die vom Felsen die Schiffer in den Tod lockt. Anna wird auf der Totenbahre vorbei getragen, sie ist an gebrochenem Herzen gestorben. Walter naht sich der Bahre voll Reue, wird aber von Hermann und dem Vater zurück gestoßen. lrrend zieht es ihn wieder und wieder an den Rhein, aus dem Loreley auftaucht. Er fleht sie an, zu ihm zurückzukehren; da mahnen sie die Geister an ihren Schwur, nur dem Rheinkönig gehören zu wollen. Verzweiflung packt Walter, und er stürzt sich in die kalten Fluten, von den Willis (den Geistern verlassener und verstorbener Mädchen) herabgezogen. Geerd Heinsen
Im 3. Akt sind wir am Ufer des Rheins, wo sich Holzfäller von der magischen jungen Frau erzählen, die vom Felsen die Schiffer in den Tod lockt. Anna wird auf der Totenbahre vorbei getragen, sie ist an gebrochenem Herzen gestorben. Walter naht sich der Bahre voll Reue, wird aber von Hermann und dem Vater zurück gestoßen. lrrend zieht es ihn wieder und wieder an den Rhein, aus dem Loreley auftaucht. Er fleht sie an, zu ihm zurückzukehren; da mahnen sie die Geister an ihren Schwur, nur dem Rheinkönig gehören zu wollen. Verzweiflung packt Walter, und er stürzt sich in die kalten Fluten, von den Willis (den Geistern verlassener und verstorbener Mädchen) herabgezogen. Geerd Heinsen
.
.
(Zum Werk und zum Komponisten vergl. auch den Aufsatz von Fernando Battaglia in der Bongiovanni-Ausgabe/GB 2015/6 vom Mitschnitt in Lucca 1982; unbedingt hingewiesen werden muss auf die beiden Bücher über Catalani von David Chandler, Hrsg./Durrant Publishing ISBN 978-1-905946-09-9 und 978-1-905946-26-6, die auch in operalounge.de besprochen wurden.)
.
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.










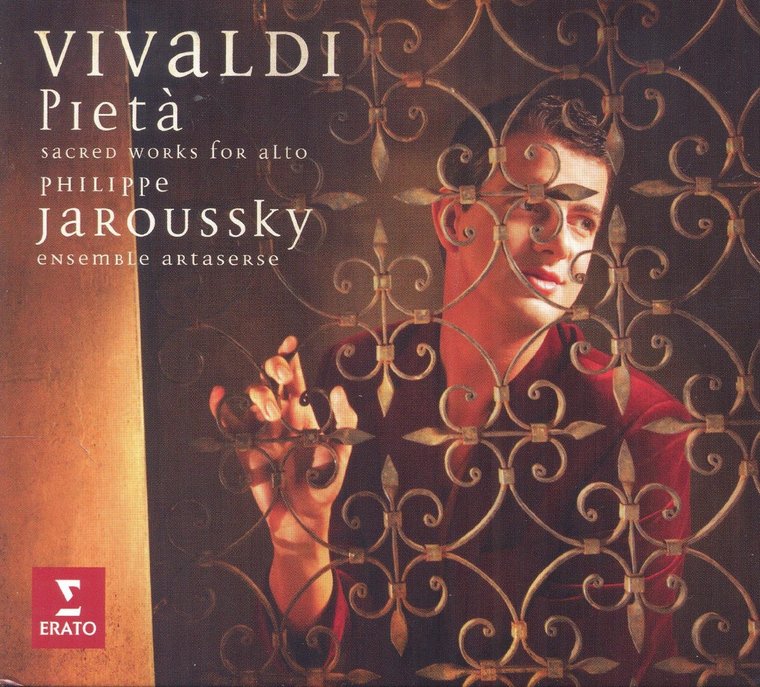




















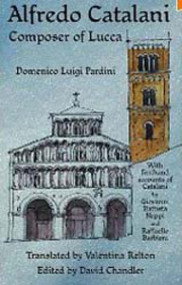

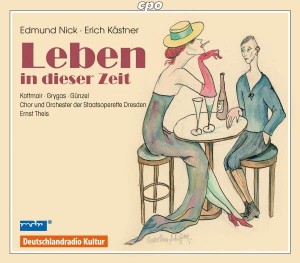
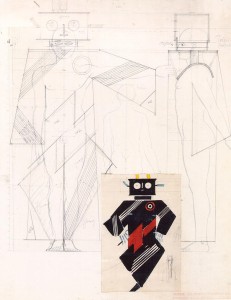

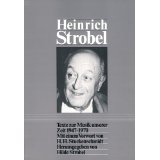 Die politische und wirtschaftliche Situation ist günstig: Der Rundfunk ist „vom ersten Augenblick seines Daseins an eine wirtschaftliche Macht. In einer Zeit allgemeiner finanzieller Depression war hier ein Unternehmer entstanden, der durch seine regelmäßigen und so gut wie sicheren Einnahmen die Möglichkeit hatte, einen Teil der notleidenden Künstlerschaft durch Engagements zu unterstützen. Im Lauf von fünf Jahren hat sich der Rundfunk zu einem Opern- und Konzertinstitut allergrößten Stils entwickelt, dessen Abonnentenzahl in Deutschland in die Millionen geht. (…)“
Die politische und wirtschaftliche Situation ist günstig: Der Rundfunk ist „vom ersten Augenblick seines Daseins an eine wirtschaftliche Macht. In einer Zeit allgemeiner finanzieller Depression war hier ein Unternehmer entstanden, der durch seine regelmäßigen und so gut wie sicheren Einnahmen die Möglichkeit hatte, einen Teil der notleidenden Künstlerschaft durch Engagements zu unterstützen. Im Lauf von fünf Jahren hat sich der Rundfunk zu einem Opern- und Konzertinstitut allergrößten Stils entwickelt, dessen Abonnentenzahl in Deutschland in die Millionen geht. (…)“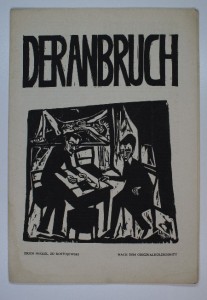 Und weiter erfahren wir von ihm in seiner „Rundfunk-Umschau“, dass diese Aufträge geeignet seien, das Schaffen in eine „bestimmte Bahn“ zu lenken, Werke ganz „besonderer Eigenart“ hervorzubringen: „Die von Max Butting propagierte Idee einer ‚Rundfunkmusik‘ wird hier aufgegriffen und einer Verwirklichung nähergeführt. Der Rundfunk begnügt sich nicht mehr mit der allgemeinen Musikliteratur, die er seinen besonderen Gesetzen entsprechend interpretiert, sondern er fördert die Entstehung einer neuen Musik, die nicht erst rundfunkgemäß wiedergegeben sondern gleich rundfunkgemäß konzipiert sein will. Nicht der Kapellmeister soll die in fünf Jahren gemachten Erfahrungen verwerten, sondern der Komponist. Damit ist der Grundstein gelegt zu einer Literatur, die in Inhalt und Form nicht rein musikalischen sondern funkischen Gesetzen folgt. Diese Gesetze werden die zeitliche Ausdehnung der Werke einengen, sie werden gewisse Formen gegenüber anderen bevorzugen – so ist es kein Zufall, dass bisher ein Konzert und eine Suite auf diesem Gebiet entstanden sind, beides Formen, deren Eigenart den Forderungen des Rundfunks entgegenkommt – diese Gesetze werden sich ganz besonders bei der Instrumentation auswirken, die hier wesentlich andere Regeln befolgen muß, sie werden Phrasierung und Dynamik beeinflussen und zu allererst den Stil der Werke bestimmen indem sie eine Musik ins Leben rufen, der Form und Zeichnung wichtiger ist als Farbe, Technik wichtiger als Ausdruck. (…)“
Und weiter erfahren wir von ihm in seiner „Rundfunk-Umschau“, dass diese Aufträge geeignet seien, das Schaffen in eine „bestimmte Bahn“ zu lenken, Werke ganz „besonderer Eigenart“ hervorzubringen: „Die von Max Butting propagierte Idee einer ‚Rundfunkmusik‘ wird hier aufgegriffen und einer Verwirklichung nähergeführt. Der Rundfunk begnügt sich nicht mehr mit der allgemeinen Musikliteratur, die er seinen besonderen Gesetzen entsprechend interpretiert, sondern er fördert die Entstehung einer neuen Musik, die nicht erst rundfunkgemäß wiedergegeben sondern gleich rundfunkgemäß konzipiert sein will. Nicht der Kapellmeister soll die in fünf Jahren gemachten Erfahrungen verwerten, sondern der Komponist. Damit ist der Grundstein gelegt zu einer Literatur, die in Inhalt und Form nicht rein musikalischen sondern funkischen Gesetzen folgt. Diese Gesetze werden die zeitliche Ausdehnung der Werke einengen, sie werden gewisse Formen gegenüber anderen bevorzugen – so ist es kein Zufall, dass bisher ein Konzert und eine Suite auf diesem Gebiet entstanden sind, beides Formen, deren Eigenart den Forderungen des Rundfunks entgegenkommt – diese Gesetze werden sich ganz besonders bei der Instrumentation auswirken, die hier wesentlich andere Regeln befolgen muß, sie werden Phrasierung und Dynamik beeinflussen und zu allererst den Stil der Werke bestimmen indem sie eine Musik ins Leben rufen, der Form und Zeichnung wichtiger ist als Farbe, Technik wichtiger als Ausdruck. (…)“
