.
Johann Christoph Vogel wurde am 18. März 1756 in Nürnberg geboren und starb am 26. Juni 1788 in Paris. In seiner kurzen Laufbahn schrieb er zwei Opern, Sinfonien, Quartette, Konzerte und einige Kammermusikwerke. Im Jahr 1776 beschloss Vogel, sich in Paris niederzulassen, angezogen von der blühenden Kunstszene unter dem Einfluss von Königin Marie-Antoinette. Dort wurde er Zeuge des triumphalen Erfolges von Glucks Alceste (1776) und wurde von da an einer der glühendsten Anhänger dieses Wiener Komponisten.
Der Komponist Vogel scheint eine außergewöhnliche Persönlichkeit gewesen zu sein: „In Vogels Charakter zeigte sich ein gewisser Stolz, den er mit einer extremen Empfindsamkeit und mit dem zartesten Feingefühl verband. Man sah ihn, wie er die bewegendsten Passagen seiner Opern weinend am Klavier darbot; dabei versuchte er, aus den Gesichtern seiner Zuhörer herauszulesen, welchen Eindruck seine Musik gemacht hatte. Er beobachtete die Blicke und fällte daraufhin sein Urteil über seine eigenen Werke.“ (Courrier des Spectacles, „Notice sur Vogel“.) Seine Empfindsamkeit wurde durch seinen Hang zum Alkohol noch gesteigert, wie einige seine Biografen betont haben, die gerne folgende Anekdote zitierten: „Einer der Freunde Vogels sah sein Klavier, auf dem zahlreiche Flaschen standen, und warf ihm vor, den Wein zu sehr zu lieben. Vogel antwortete ihm, indem er ein schwungvolles und leidenschaftliches Stück spielte, und fragte ihn, nachdem er geendet hatte: ‚Kann man solche Musik etwa mit Limonade hervorbringen?'“ (Castil-Blaze, L’Académie royale de musique). Die Schwierigkeiten, die er zu bewältigen hatte, um seine Opern auf die Bühne zu bringen, führten zu wahren Exzessen auf diesem Gebiet. Sein Mangel an Enthaltsamkeit begünstigte ein bösartiges Fieber, das zu seinem vorzeitigen Tod führte – er starb als 32-Jähriger in bitterer Armut.
 Bei einem seiner feuchtfröhlichen Abende lernte der Komponist auch Philippe Desriaux, seinen zukünftigen Librettisten, kennen. In den Memoires secrets, die unter dem Namen von Louis Petit de Bachaumont veröffentlicht wurden, stand zu lesen, Vogel sei ein „guter Deutscher, der, obgleich jung, schon ein Trunkenbold war; er begab sich regelmäßig in das ‚Les Procherons‘ genannte Stadtviertel und beklagte sich darüber, keinen Autor zu finden, der ihm ein Opernlibretto zur Vertonung anvertrauen wolle. Dort lungerte auch Monsieur Desriaux herum, der ebenfalls vom Wein bereits ganz abgestumpft war, auf der Suche nach einem Musiker, der die Musik zu [seinem Libretto] La Toison d’or (Das goldene Vlies) komponieren wollte. Auf diese Weise trafen sich die beiden Hallodris, lernten einander kennen und so entstand diese Oper. „Neben La Toison d’or lieferte Desriaux dem Komponisten auch ein Libretto mit dem Titel Demophon; diese Oper wurde als erste vollendet, kam aber erst 1789 zur Aufführung, einige Monate nach dem Tod des Komponisten.
Bei einem seiner feuchtfröhlichen Abende lernte der Komponist auch Philippe Desriaux, seinen zukünftigen Librettisten, kennen. In den Memoires secrets, die unter dem Namen von Louis Petit de Bachaumont veröffentlicht wurden, stand zu lesen, Vogel sei ein „guter Deutscher, der, obgleich jung, schon ein Trunkenbold war; er begab sich regelmäßig in das ‚Les Procherons‘ genannte Stadtviertel und beklagte sich darüber, keinen Autor zu finden, der ihm ein Opernlibretto zur Vertonung anvertrauen wolle. Dort lungerte auch Monsieur Desriaux herum, der ebenfalls vom Wein bereits ganz abgestumpft war, auf der Suche nach einem Musiker, der die Musik zu [seinem Libretto] La Toison d’or (Das goldene Vlies) komponieren wollte. Auf diese Weise trafen sich die beiden Hallodris, lernten einander kennen und so entstand diese Oper. „Neben La Toison d’or lieferte Desriaux dem Komponisten auch ein Libretto mit dem Titel Demophon; diese Oper wurde als erste vollendet, kam aber erst 1789 zur Aufführung, einige Monate nach dem Tod des Komponisten.
.
Die Uraufführung von La Toison d’or fand unter schwierigen Umständen statt, denn in der Academie Royale de Musique war es zuvor zu einer ganzen Reihe von Misserfolgen gekommen. Aber die Leitung der Oper setzte große Hoffnungen auf das Werk: Es hatte nicht nur eine hochdramatische Handlung, sondern war die erste Oper seit Salieris Les Danaides aus dem Jahr 1784, das wahrhaft in der Gluck’schen Tradition stand. Doch leider wurden diese Hoffnungen durch einen abermaligen Misserfolg enttäuscht: La Toison d’or wurde zwischen dem 5. September und dem 7. November 1786 nur neun Mal aufgeführt. Man bemühte sich sofort im Anschluss, die fehlende Begeisterung des Publikums durch die Aufführung mehrerer ballets pantomimes auszugleichen, da keine andere Oper zur Aufführung bereit stand. „La Toison d’or schleppt sich mühsam dahin und hat es innerhalb von zwei Monaten lediglich zu sieben Aufführungen gebracht, und auch das nur, weil das Werk von der Verwaltung gefördert wird, nicht etwa vom Publikum“ (La Harpe, Correspondance litteraire). Aber diese künstlichen Maßnahmen reichten nicht aus, und das Werk scheiterte schließlich unter Querelen endgültig. Die Gluckisten hatten vergeblich versucht, das Debüt des jungen deutschen Komponisten zu unterstützen, aber die Anhänger der italienischen Schule – repräsentiert von Piccinni und Sacchini – traten zahlreicher und entschiedener auf. Sie taten alles, um La Toison d’or zum Scheitern zu bringen, was ihnen schließlich auch gelang.
Das Werk geriet dennoch nicht vollständig in Vergessenheit. Unter dem Titel Medée á Colchos wurde es am 17. Juni 1788 noch einmal auf den Spielplan gesetzt. Sowohl das Libretto als auch die Musik wurden überarbeitet, und die teilweise veränderten Kulissen gaben dem Ganzen den Anschein einer Neuheit. Schließlich wurden auch einige, auf das Drama abgestimmte Ballette eingefügt, um so einem Mangel abzuhelfen, der von Anfang an offensichtlich gewesen war. Dennoch kam es nur zu drei immer schlechter besuchten Aufführungen. „Man hat La Toison d’or wieder hervorgeholt, eine Oper, die schon beim ersten Anlauf wenig Erfolg hatte. Nun hat man sich bemüht, sie mit Hilfe von immer gern gesehenen Balletten ein wenig aufzuplustern, um dieser armseligen Oper in diesem Sommer wenigstens einen kleinen Erfolg zu verschaffen“, so giftete man in der Correspondance litteraire (La Harpe).
Das Scheitern wurde durch eine schreckliche Neuigkeit noch beschleunigt: Der bereits sehr geschwächte Vogel starb zwischen der zweiten und der dritten Aufführung. Sämtliche Bemühungen um das Werk wurden umgehend eingestellt, und die Partitur von La Toison d’or landete in den Regalen der Bibliothek in der Pariser Oper, wo sie noch heute steht. Das Werk wurde aus dem Repertoire genommen, und sämtliche Erinnerungen daran gerieten bald darauf durch die Uraufführung von Demophon in Vergessenheit. Diese Oper hatte Vogel bei seinem Tod vollendet hinterlassen. Wegen der Qualität des Librettos, der Musik und wegen des hohen Unterhaltungswerts galt diese zweite Oper als Meisterwerk des Komponisten, und La Toison d’or stand zu Unrecht in ihrem Schatten.
.

Und Hervé Niquet dirigierte sein Concert Spirituel/ON
Seit der Uraufführung von Iphigenie en Aulide im Jahr 1774 beherrschte Gluck die französische Opernszene. Und obwohl er Paris 1779 nach dem Scheitern von Echo & Narcisse verlassen hatte, dräute sein Schatten noch immer über der Academie Royale de Musique. Unter der Kohorte junger Komponisten, die nur darauf warteten, dass ihre Werke auf den Brettern dieser Bühne zur Aufführung kamen, bemühte sich Vogel besonders beflissen darum, Glucks Nachfolge anzutreten. Zumindest tat er sich lautstark als sein geistiger Erbe hervor; er widmete Gluck die Partitur seines Toison d’or mit berührend aufrichtigen Worten. Als Reaktion auf diese schmeichelhafte Zueignung war Gluck voll der Ermutigung für den jungen Komponisten, dem er nach der Lektüre seiner Partitur schrieb: „Das dramatische Talent, das Sie zeigen, überragt noch Ihre weiteren Qualitäten, und dazu möchte ich Sie tiefstem Herzen beglückwünschen. Dieses Talent ist eine besonders seltene Gabe, da es in Ihrer Natur liegt: nicht durch Übung erworben wurde.“
Man muss die zeitgenössischen Kritiken, Kommentare und die Reaktionen auf die Aufführungen aus den Jahren 1786 und 1788 aus der Distanz von über zwei Jahrhunderten werten: Das Werk entstand zu einer Zeit von verbitterten und unaufhörlichen Auseinandersetzungen zwischen den „Gluckisten“ (den Anhängern des »deutschen« Stils) und den „Piccinisten“ (die den „italienischen“ Stil verteidigten) geprägt war, der im Jahr 1778 aufgeflammt war. Und die angeblichen Schwächen oder Qualitäten von Libretto und Partitur wurden an diesem Maßstab gemessen, der für eine heutige Einschätzung nicht die geringste Rolle mehr spielt.
Die Figuren der Medea und des Jason auf die Bühne zu bringen war eine Versuchung, der viele Komponisten vom 17. bis zum 20. Jahrhundert nicht widerstehen konnten. Am Vorabend der Französischen Revolution hielt man dieses Sujet für „nicht lohnend und grausam“ (Guillaume Imbert, Correspondance litteraire secrete, 1788). Als Desriaux sich damit auseinandersetzte, wurde er für seine Geschicklichkeit in der Versifizierung und für seine anrührenden Szenen gelobt, aber man hielt seine dramatische Umsetzung nicht für restlos gelungen. Es ist wahr, dass sein Libretto von den ersten Szenen an daran krankt, dass Medea als kaltherzige Furie dargestellt wird, und dass er sich zu früh (im Verlauf des zweiten Aktes) von der einzigen anrührenden Figur, nämlich Hypsipyle, trennt. Was Jason betrifft, so wird er ebenso niederträchtig gezeichnet wie im Mythos: Er ist zögerlich und wechselhaft, er hat nichts Heldenhaftes an sich – von einigen kurzen Anwandlungen hier und da in den gesamten drei Akten abgesehen, die überdies meistens unangebracht sind.
Aus diesem Grund wurde Desriaux eine gewisse Monotonie zum Vorwurf gemacht, die noch durch die fast durchgängige Präsenz Medeas und ihre zahlreichen Monologe verstärkt wird. „Die Rolle der Zauberin, die zwar Charakterstärke aufweist, wurde nicht allgemein geschätzt; eine derartige Monotonie von Zornausbrüchen und Verwünschungen wirkt ermüdend. Die tragischen Ereignisse des zweiten Aktes schlagen beinahe ins Lächerliche um, und die Auflösung des Dramas ist alles andere als zufriedenstellend. Trotz dieser Mängel weist der Text Anzeichen von Talent auf, vor allem in seinem Stil, der häufig lebhaft und präzise ist.“ (Journal Generale de France, 1786.)
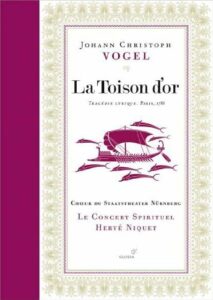 Die tragische Größe des Sujets und die Leidenschaft der von Desriaux erdachten Heldin haben Vogel wohl gereizt, das Libretto mit einer Musik umzusetzen, die eine größtmögliche Intensität erreichen sollte. Das ist ihm offensichtlich gelungen, denn man attestierte ihm, sein Werk brilliere mit „Schönheit allerersten Ranges, {…} und alle waren sich darin einig, dass die Begleitung und die Rezitative seelenvoll und expressiv sind. Kurz, Vogel scheint ein rechtmäßiger Anwärter auf den Lorbeerkranz zu sein, der die Stirn des unsterblichen Gluck krönt, dessen Fußstapfen er – vielleicht etwas zu genau – folgt“ (Journal General de France, 1786). War seine Nachahmung des Meisters denn so greifbar? Beim Mercure de France war man von den Fähigkeiten des jungen Komponisten überzeugt und versuchte, ihn dazu zu ermutigen, seinen eigenen Weg zu suchen: „Warum sklavisch dem Vorbild eines anderen folgen, wenn man doch auch seine eigene Richtung einschlagen kann? Nur durch ein eigenständiges Talent macht man von sich reden; kriecherische Nachahmer gibt es zuhauf, doch Monsieur Vogel ist nicht dazu geboren, zu diesen zu gehören.“ (Mercure de France, 1786.)
Die tragische Größe des Sujets und die Leidenschaft der von Desriaux erdachten Heldin haben Vogel wohl gereizt, das Libretto mit einer Musik umzusetzen, die eine größtmögliche Intensität erreichen sollte. Das ist ihm offensichtlich gelungen, denn man attestierte ihm, sein Werk brilliere mit „Schönheit allerersten Ranges, {…} und alle waren sich darin einig, dass die Begleitung und die Rezitative seelenvoll und expressiv sind. Kurz, Vogel scheint ein rechtmäßiger Anwärter auf den Lorbeerkranz zu sein, der die Stirn des unsterblichen Gluck krönt, dessen Fußstapfen er – vielleicht etwas zu genau – folgt“ (Journal General de France, 1786). War seine Nachahmung des Meisters denn so greifbar? Beim Mercure de France war man von den Fähigkeiten des jungen Komponisten überzeugt und versuchte, ihn dazu zu ermutigen, seinen eigenen Weg zu suchen: „Warum sklavisch dem Vorbild eines anderen folgen, wenn man doch auch seine eigene Richtung einschlagen kann? Nur durch ein eigenständiges Talent macht man von sich reden; kriecherische Nachahmer gibt es zuhauf, doch Monsieur Vogel ist nicht dazu geboren, zu diesen zu gehören.“ (Mercure de France, 1786.)

„Medea in Corinto“/ Szene Giuditta Pasta als Medea mit Kindern/ OBA
Diese Unterwerfung unter das Gluck’sche Modell schmälerte die ureigenen Verdienste Vogels nur zum Teil. Aber überall dort, wo er seinen persönlichen Ausdruck finden wollte, verfiel der Komponist in ein anderes Extrem und schrieb übertrieben glutvoll und mit zu vielen Effekten. „Das ist generell Vogels Schwäche wie auch die aller jungen Komponisten, vor allem wenn sie über eine empfindsame Seele verfugen. Aus Furcht, nicht genug auszudrücken, wollen sie allem und jedem Ausdruck verleihen und übertreiben es dabei. Fast alle Modulationen in diesem Werk stehen in Moll, und überall finden sich bizarre Akkorde sowie höchst vertrackte harmonische Übergänge. Es gibt wohl nicht einen einzigen Takt, in dem der Komponist keine besondere Absicht verfolgt. Im Ergebnis ist das Werk ermüdend, vielleicht gar langweilig. In Wahrheit handelt es sich um ein Übermaß von Talent, aber schließlich stellt auch diese Überfülle ein Scheitern dar.“ (Mercure de France, 1786.) Paradoxerweise schenkte er dem Pariser Publikum eine Partitur, „die alle Welt für erhaben hielt, die niemand verstand, und bei der man vor lauter Bewunderung gähnen musste.“ (Lettre á monsieur le comte de B*** sur la revolution arrivée en 1789.)
Das Talent, mit dem Vogel seine Orchesterstücke, seine Rezitative und die musikalische Umsetzung der Rolle der Medea erdacht hat, wurde einmütig anerkannt – unabhängig davon, ob die Musik nun Gähnen oder Applaus hervorrief: „Es gelang ihm, Medeas immer gleiche Zornausbrüche mit einer großen Vielfalt des Ausdrucks zu versehen. Die Arie ‚Ah! ne me parlez plus d’amour et d’esperance‘ im dritten Akt ist ein Meisterwerk.“ Was die Musik betraf, war das Urteil vollkommen einhellig: „Dieser erste Versuch eines jungen Komponisten gibt sicherlich Anlass zu den größten Hoffnungen.“ Man ging sogar so weit zu sagen, dass „kein junger Komponist zuvor seine Laufbahn auf eine so erlesene Weise begonnen hat“ (Mercure de France, 1786).

Benoit Dratwicki/ youtube
Man muss jedoch erkennen, dass trotz allen Lobes weder das Publikum noch die Kritiker dieser Zeit in der Lage waren, zu erkennen, wie gewagt Vogels Partitur ist und wie viel Innovatives und Originelles in ihr enthalten ist. Geschult an deutscher Musik verfügte der Komponist als direkter Erbe der großen Mannheimer Schule über einen sinfonischen Atem wie kaum ein französischer Komponist – mit Ausnahme von Gossec. In der ambitionierten Ouvertüre zeigt sich dieses Talent sofort, ebenso wie in den wenigen Tanzsätzen. Aber vor allem in der Begleitung der Chöre und einzelner Arien wird Vogels ganzes Können offensichtlich. Zu Hypsipyles Flehen, Medeas Gebrüll und Jasons kriegerischem Rachegeschrei seufzt, gewittert und trompetet das Orchester. Selbst das Rezitativ ist voll ruckartiger Bewegungen und verwirrender Punktierungen, die das Drama auf wirkungsvolle und angemessene Weise unterstützen. Übernatürliche Szenen und Naturkatastrophen bieten hervorragende Gelegenheiten, das Orchester in allen seinen Facetten vorzuführen, und Vogel lässt keine dieser Möglichkeiten aus: Der Begräbnischor, der den Tod des Hypsipyle begleitet, steht in der Tradition düsterer und kargerer Kirchengesänge, während Medeas Verwünschungen mit Harmonien und ungewöhnlichen Klängen untermalt werden, die schon auf die Romantik vorweisen. Das Gewitter im zweiten Akt und die letzte Schlacht ermöglichen es dem gesamten Orchester, eine schon beinahe furchterregende Virtuosität an den Tag zu legen, während Solisten und Chor noch Aufschreie und Ausrufe hinzufügen. La Toison d’or ist zweifellos ein bedeutendes Bindeglied zwischen Gluck und Spontini. Nicht wegen der – so gut wie nicht vorhandenen – Wirkung auf das zeitgenössische Publikum, sondern weil wir diese Oper heute als Beleg für die große Vielfalt der musikalischen Stile würdigen können, die während der Regentschaft Ludwigs XIV. und Marie-Antoinettes an der Académie Royale de Musique präsentiert wurden. Bénoit Dratwicki (Übersetzung: Susanne Lowien/Glossa)
.
.
(Den Text übernahmen wir aus dem Booklet zur Aufnahme bei Glossa unter der Leitung von Hervé Niquet, mitgeschnitten am 27. Juli 2012 beim Nürnberger Gluck-Festival 2012 mit Marie Kaline, Jean-Sébastien Bou, Judith Van Wanroij u. a. sowie dem Concert Spirituel/ Glossa/Note 1/ 2 CD GCD 921628. Dank auch an Verena Koegler von der Oper Nürnberg, wo im Sommer 2012 diese Aufführung stattfand und vom Rundfunk mitgeschnitten wurde.
.
.
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.
 Keine Strauss-Hofmannsthal-Box, was schön gewesen wäre, dafür eine Brecht-Weill-Box. Sie enthält weitgehend die ab 1927 entstandenen Ergebnisse der Zusammenarbeit von Kurt Weill mit dem zwei Jahre älteren Dichter, also Die Dreigroschenoper und Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny – beide in den maßstäblichen Aufnahmen der Philips unter Wilhelm Brückner-Rüggeberg, die damit Plattengeschichte machte, wobei ich vor allem Mahagonny (mit Lenya, Litz, Günter, Markworth) ganz großartig finde – dann Der Jasager, das Musical Happy End und das gesungene Ballett Die sieben Todsünden (beide ebenfalls unter Brückner-Rüggeberg mit Lenya). Außerdem enthält die Ausgabe den nahezu völlig verwandelten „amerikanischen Weilll“ u.a. mit dem Musical Lady in the Dark (mit dem Text von Ira Gershwin) und die „American Folk Opera“ Down in the Valley (Text von Arnold Sundgaard, der auch auf der Vorderseite von CD 9 genannt wird, wo er nichts zu suchen hat). Interessant die kleinen Schnipsel auf CD 9, die ich gleich mehrfach hörte, neben den 1930 entstandenen Dreigroschenoper-Aufschnitten unter Otto Klemperer vor allem die amerikanischen Aufnahmen unter Maurice Abranavel, darunter die Szenen aus One Touch of Venus mit den Stars der Uraufführung, der September Song in alternativen Aufnahmen mit Walter Huston, der das Musical Knickerbocker Holiday am Broadway kreiert hatte, und Sinatra, durch den der Song später in immer neuen Arrangements international berühmt wurde. Bemerkenswert auf CD 1: Theo Mackeben leitete zwei Jahre nach der von ihm dirigierten UA der Dreigroschenoper eine Einspielung, Brecht singt Die Moritat von Mackie Messer sowie Der Mensch lebt durch den Kopf und eine sehr zerbrechlich wirkende Lenya singt 1943 sechs Lieder mit Weill am Klavier.
Keine Strauss-Hofmannsthal-Box, was schön gewesen wäre, dafür eine Brecht-Weill-Box. Sie enthält weitgehend die ab 1927 entstandenen Ergebnisse der Zusammenarbeit von Kurt Weill mit dem zwei Jahre älteren Dichter, also Die Dreigroschenoper und Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny – beide in den maßstäblichen Aufnahmen der Philips unter Wilhelm Brückner-Rüggeberg, die damit Plattengeschichte machte, wobei ich vor allem Mahagonny (mit Lenya, Litz, Günter, Markworth) ganz großartig finde – dann Der Jasager, das Musical Happy End und das gesungene Ballett Die sieben Todsünden (beide ebenfalls unter Brückner-Rüggeberg mit Lenya). Außerdem enthält die Ausgabe den nahezu völlig verwandelten „amerikanischen Weilll“ u.a. mit dem Musical Lady in the Dark (mit dem Text von Ira Gershwin) und die „American Folk Opera“ Down in the Valley (Text von Arnold Sundgaard, der auch auf der Vorderseite von CD 9 genannt wird, wo er nichts zu suchen hat). Interessant die kleinen Schnipsel auf CD 9, die ich gleich mehrfach hörte, neben den 1930 entstandenen Dreigroschenoper-Aufschnitten unter Otto Klemperer vor allem die amerikanischen Aufnahmen unter Maurice Abranavel, darunter die Szenen aus One Touch of Venus mit den Stars der Uraufführung, der September Song in alternativen Aufnahmen mit Walter Huston, der das Musical Knickerbocker Holiday am Broadway kreiert hatte, und Sinatra, durch den der Song später in immer neuen Arrangements international berühmt wurde. Bemerkenswert auf CD 1: Theo Mackeben leitete zwei Jahre nach der von ihm dirigierten UA der Dreigroschenoper eine Einspielung, Brecht singt Die Moritat von Mackie Messer sowie Der Mensch lebt durch den Kopf und eine sehr zerbrechlich wirkende Lenya singt 1943 sechs Lieder mit Weill am Klavier.

 Jaroussky hat lange gezögert, die Musik Porporas in sein Repertoire aufzunehmen, aber schließlich in dessen Kompositionen viele berührende Arien entdeckt, die seiner Stimme perfekt entsprechen. Diese sind es dann auch, die den stärksten Eindruck hinterlassen. Zweifellos ist Acis „Alto Giove“ aus Polifemo der Höhepunkt dieser Sammlung – in seiner Wirkung wahrhaft mirakulös durch die körperlos schwebende Stimme, den entrückten Ausdruck, die scheinbar unendlichen Atemreserven. Das Venice Baroqe Orchestra unter Andrea Marcon, das den Sänger insgesamt sehr einfühlsam begleitet, erschafft gerade in dieser Nummer wunderbare orchestrale Stimmungen. Aus dieser Oper erklingt noch eine weitere Arie des Aci („Nel già bramoso petto“), deren heroische Koloraturläufe der Interpret stupend meistert.
Jaroussky hat lange gezögert, die Musik Porporas in sein Repertoire aufzunehmen, aber schließlich in dessen Kompositionen viele berührende Arien entdeckt, die seiner Stimme perfekt entsprechen. Diese sind es dann auch, die den stärksten Eindruck hinterlassen. Zweifellos ist Acis „Alto Giove“ aus Polifemo der Höhepunkt dieser Sammlung – in seiner Wirkung wahrhaft mirakulös durch die körperlos schwebende Stimme, den entrückten Ausdruck, die scheinbar unendlichen Atemreserven. Das Venice Baroqe Orchestra unter Andrea Marcon, das den Sänger insgesamt sehr einfühlsam begleitet, erschafft gerade in dieser Nummer wunderbare orchestrale Stimmungen. Aus dieser Oper erklingt noch eine weitere Arie des Aci („Nel già bramoso petto“), deren heroische Koloraturläufe der Interpret stupend meistert.



 Wir wollen uns heute aber auf die Gräber bedeutender Sänger beschränken. Beginnen wir mit dem wuchtigen Granit-Findling, der das Grab der gefeierten, stimmlich eher filigranen Koloratrice Frieda Hempel markiert. Nach fulminantem Karrierestart entschwand sie einst schnell an die New Yorker Met, beendete früh ihre Karriere, und konzentrierte sich anschließend auf die Mehrung ihres beträchtlichen Vermögens. Auf Schallplatten ist uns ihre agile, zu unglaublichen Höhenflügen fähige Stimme erhalten geblieben (Grabstelle I-Erb-12). Unweit davon das schlichte Urnengrab der bedeutenden Mezzosopranistin Margarete Klose und ihres Ehemannes und Lehrers Walter Bültemann. Die lebenslange Geheimhaltung ihres korrekten Geburtsdatums setzt sie konsequent auf ihrem Grabstein fort – sie unterschlägt es (Grabstelle I Ur-8).
Wir wollen uns heute aber auf die Gräber bedeutender Sänger beschränken. Beginnen wir mit dem wuchtigen Granit-Findling, der das Grab der gefeierten, stimmlich eher filigranen Koloratrice Frieda Hempel markiert. Nach fulminantem Karrierestart entschwand sie einst schnell an die New Yorker Met, beendete früh ihre Karriere, und konzentrierte sich anschließend auf die Mehrung ihres beträchtlichen Vermögens. Auf Schallplatten ist uns ihre agile, zu unglaublichen Höhenflügen fähige Stimme erhalten geblieben (Grabstelle I-Erb-12). Unweit davon das schlichte Urnengrab der bedeutenden Mezzosopranistin Margarete Klose und ihres Ehemannes und Lehrers Walter Bültemann. Die lebenslange Geheimhaltung ihres korrekten Geburtsdatums setzt sie konsequent auf ihrem Grabstein fort – sie unterschlägt es (Grabstelle I Ur-8). Noch unauffälliger und schwer auffindbar ist die Grabstelle des Heldentenors Ludwig Suthaus, Furtwänglers Tristan in der gefeierten Nachkriegsinszenierung im Berliner Admiralspalast. Durch die spätere Plattenaufnahme des Werks unter Furtwängler hat er ein Stück Unsterblichkeit erlangt (Grabstelle II Ur-3124). Ein stilisiertes steinernes kleines Teehaus schmückt das Grab der japanischen Sängerin Michiko Tanaka, die vor ihrer Heirat mit dem Schauspieler Victor de Kowa als Opernsängerin, später Filmschauspielerin erfolgreich war (Grabstelle 16 G-29).
Noch unauffälliger und schwer auffindbar ist die Grabstelle des Heldentenors Ludwig Suthaus, Furtwänglers Tristan in der gefeierten Nachkriegsinszenierung im Berliner Admiralspalast. Durch die spätere Plattenaufnahme des Werks unter Furtwängler hat er ein Stück Unsterblichkeit erlangt (Grabstelle II Ur-3124). Ein stilisiertes steinernes kleines Teehaus schmückt das Grab der japanischen Sängerin Michiko Tanaka, die vor ihrer Heirat mit dem Schauspieler Victor de Kowa als Opernsängerin, später Filmschauspielerin erfolgreich war (Grabstelle 16 G-29). Geradezu ein Wallfahrtsort für Wagnerianer ist das Grab von Frida Leider, der vielleicht bedeutendsten Wagnersängerin des 20. Jahrhunderts. Ihre Schallplatten sind bis heute wahre Ikonen des Wagnergesangs, und höchster Gesangskultur ganz allgemein. Sie ruht neben ihrem jüdischen Ehemann Rudolf Deman, einst Konzertmeister der Staatskapelle Berlin, von den Nazis verfolgt, von seiner Frau löwenhaft verteidigt, und nach seinem Schweizer Exil glücklich heimgekehrt. Auch er hat zahlreiche Tondokumente seiner Kunst hinterlassen (Grabstelle 19N-26/27). Der hünenhafte Bass-Bariton Michael Bohnen, Liebling nicht nur der Frauen, zeitweiliger Ehemann der Tänzerin La Jana, Opern- und Filmstar in der alten wie der neuen Welt, muss sich mit einem winzigen Urnengrab bescheiden, selbst dieses stand vor Jahren schon kurz vor der Einebnung, eine beherzte Enkelin hat dies verhindert. Bohnen, der als Raubein galt, hatte sich in seinem Leben nicht nur Freunde gemacht (Grabstelle 18 B-9).
Geradezu ein Wallfahrtsort für Wagnerianer ist das Grab von Frida Leider, der vielleicht bedeutendsten Wagnersängerin des 20. Jahrhunderts. Ihre Schallplatten sind bis heute wahre Ikonen des Wagnergesangs, und höchster Gesangskultur ganz allgemein. Sie ruht neben ihrem jüdischen Ehemann Rudolf Deman, einst Konzertmeister der Staatskapelle Berlin, von den Nazis verfolgt, von seiner Frau löwenhaft verteidigt, und nach seinem Schweizer Exil glücklich heimgekehrt. Auch er hat zahlreiche Tondokumente seiner Kunst hinterlassen (Grabstelle 19N-26/27). Der hünenhafte Bass-Bariton Michael Bohnen, Liebling nicht nur der Frauen, zeitweiliger Ehemann der Tänzerin La Jana, Opern- und Filmstar in der alten wie der neuen Welt, muss sich mit einem winzigen Urnengrab bescheiden, selbst dieses stand vor Jahren schon kurz vor der Einebnung, eine beherzte Enkelin hat dies verhindert. Bohnen, der als Raubein galt, hatte sich in seinem Leben nicht nur Freunde gemacht (Grabstelle 18 B-9). Tatsächlich verschwunden und selbst in den Aufzeichnungen der Friedhofsverwaltung nicht mehr auffindbar ist das Grab Leo Schützendorfs, auch er Bass-Bariton und der bedeutendste Künstler von mehreren singenden Brüdern. Gleichsam zum Trost für das verlorene Grab hat man einen Weg auf dem Friedhof nach ihm benannt. Ebenfalls nicht mehr existent ist die Grabstelle des einst gefeierten Baritons Desider Zador. Der gebürtige Ungar wirkte an fast allen wichtigen europäischen Opernhäusern, zuletzt an der heutigen Deutschen Oper in Charlottenburg. Noch vorhanden ist das Grab des Tenors Harry Steier, lange Jahre Ensemblemitglied des Charlottenburger Opernhauses, mit häufigen Auftritten in Bayreuth in kleinen Rollen, der unzählige Volksliedplatten hinterlassen hat, aber auch eine höchst dubiose Aufnahme: „Adolf Hitlers Lieblingsblume“, die offenbar selbst den Nazis zu kitschig war, und alsbald wieder aus dem Katalog gestrichen wurde (Grabstelle 12B-19/20).
Tatsächlich verschwunden und selbst in den Aufzeichnungen der Friedhofsverwaltung nicht mehr auffindbar ist das Grab Leo Schützendorfs, auch er Bass-Bariton und der bedeutendste Künstler von mehreren singenden Brüdern. Gleichsam zum Trost für das verlorene Grab hat man einen Weg auf dem Friedhof nach ihm benannt. Ebenfalls nicht mehr existent ist die Grabstelle des einst gefeierten Baritons Desider Zador. Der gebürtige Ungar wirkte an fast allen wichtigen europäischen Opernhäusern, zuletzt an der heutigen Deutschen Oper in Charlottenburg. Noch vorhanden ist das Grab des Tenors Harry Steier, lange Jahre Ensemblemitglied des Charlottenburger Opernhauses, mit häufigen Auftritten in Bayreuth in kleinen Rollen, der unzählige Volksliedplatten hinterlassen hat, aber auch eine höchst dubiose Aufnahme: „Adolf Hitlers Lieblingsblume“, die offenbar selbst den Nazis zu kitschig war, und alsbald wieder aus dem Katalog gestrichen wurde (Grabstelle 12B-19/20). Prominentester „Neuzugang“ ist der große Dietrich Fischer-Dieskau, Kammersänger, Ehrenbürger Berlins, und auch sonst mit allen nur erdenklichen Ehrungen überschüttet. Das am häufigsten nachgefragte und von Legenden umwobene Grab existiert nicht mehr: die aufstrebende Hochdramatische Gertrud Bindernagel, nach einer Siegfried-Aufführung an der Berliner Bismarckstraße von ihrem alkoholisierten Noch-Ehemann Wilhelm Hintze angeschossen, erlag Tage später einer Embolie. Das Leben ist zumeist erheblich trivialer als die letzten von ihr gesungenen Worte: „Leuchtende Liebe, lachender Tod“. Tausende sollen ihrer Beerdigung als Zaungäste beigewohnt haben, heute ist ihr Name nur noch Kennern ein Begriff. Bei der Versammlung so vieler unvergesslicher Stimmen verwundert es nicht, dass Gerüchte von in hellen Vollmondnächten stattfindenden Tristan-Aufführungen wissen wollen, wie die Welt sie noch nicht gehört hat….
Prominentester „Neuzugang“ ist der große Dietrich Fischer-Dieskau, Kammersänger, Ehrenbürger Berlins, und auch sonst mit allen nur erdenklichen Ehrungen überschüttet. Das am häufigsten nachgefragte und von Legenden umwobene Grab existiert nicht mehr: die aufstrebende Hochdramatische Gertrud Bindernagel, nach einer Siegfried-Aufführung an der Berliner Bismarckstraße von ihrem alkoholisierten Noch-Ehemann Wilhelm Hintze angeschossen, erlag Tage später einer Embolie. Das Leben ist zumeist erheblich trivialer als die letzten von ihr gesungenen Worte: „Leuchtende Liebe, lachender Tod“. Tausende sollen ihrer Beerdigung als Zaungäste beigewohnt haben, heute ist ihr Name nur noch Kennern ein Begriff. Bei der Versammlung so vieler unvergesslicher Stimmen verwundert es nicht, dass Gerüchte von in hellen Vollmondnächten stattfindenden Tristan-Aufführungen wissen wollen, wie die Welt sie noch nicht gehört hat….
 Bei einem seiner feuchtfröhlichen Abende lernte der Komponist auch Philippe Desriaux, seinen zukünftigen Librettisten, kennen. In den Memoires secrets, die unter dem Namen von Louis Petit de Bachaumont veröffentlicht wurden, stand zu lesen, Vogel sei ein „guter Deutscher, der, obgleich jung, schon ein Trunkenbold war; er begab sich regelmäßig in das ‚Les Procherons‘ genannte Stadtviertel und beklagte sich darüber, keinen Autor zu finden, der ihm ein Opernlibretto zur Vertonung anvertrauen wolle. Dort lungerte auch Monsieur Desriaux herum, der ebenfalls vom Wein bereits ganz abgestumpft war, auf der Suche nach einem Musiker, der die Musik zu [seinem Libretto] La Toison d’or (Das goldene Vlies) komponieren wollte. Auf diese Weise trafen sich die beiden Hallodris, lernten einander kennen und so entstand diese Oper. „Neben La Toison d’or lieferte Desriaux dem Komponisten auch ein Libretto mit dem Titel Demophon; diese Oper wurde als erste vollendet, kam aber erst 1789 zur Aufführung, einige Monate nach dem Tod des Komponisten.
Bei einem seiner feuchtfröhlichen Abende lernte der Komponist auch Philippe Desriaux, seinen zukünftigen Librettisten, kennen. In den Memoires secrets, die unter dem Namen von Louis Petit de Bachaumont veröffentlicht wurden, stand zu lesen, Vogel sei ein „guter Deutscher, der, obgleich jung, schon ein Trunkenbold war; er begab sich regelmäßig in das ‚Les Procherons‘ genannte Stadtviertel und beklagte sich darüber, keinen Autor zu finden, der ihm ein Opernlibretto zur Vertonung anvertrauen wolle. Dort lungerte auch Monsieur Desriaux herum, der ebenfalls vom Wein bereits ganz abgestumpft war, auf der Suche nach einem Musiker, der die Musik zu [seinem Libretto] La Toison d’or (Das goldene Vlies) komponieren wollte. Auf diese Weise trafen sich die beiden Hallodris, lernten einander kennen und so entstand diese Oper. „Neben La Toison d’or lieferte Desriaux dem Komponisten auch ein Libretto mit dem Titel Demophon; diese Oper wurde als erste vollendet, kam aber erst 1789 zur Aufführung, einige Monate nach dem Tod des Komponisten.
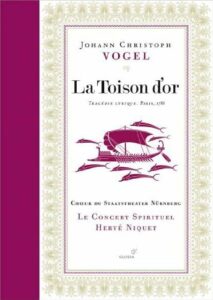 Die tragische Größe des Sujets und die Leidenschaft der von Desriaux erdachten Heldin haben Vogel wohl gereizt, das Libretto mit einer Musik umzusetzen, die eine größtmögliche Intensität erreichen sollte. Das ist ihm offensichtlich gelungen, denn man attestierte ihm, sein Werk brilliere mit „Schönheit allerersten Ranges, {…} und alle waren sich darin einig, dass die Begleitung und die Rezitative seelenvoll und expressiv sind. Kurz, Vogel scheint ein rechtmäßiger Anwärter auf den Lorbeerkranz zu sein, der die Stirn des unsterblichen Gluck krönt, dessen Fußstapfen er – vielleicht etwas zu genau – folgt“ (Journal General de France, 1786). War seine Nachahmung des Meisters denn so greifbar? Beim Mercure de France war man von den Fähigkeiten des jungen Komponisten überzeugt und versuchte, ihn dazu zu ermutigen, seinen eigenen Weg zu suchen: „Warum sklavisch dem Vorbild eines anderen folgen, wenn man doch auch seine eigene Richtung einschlagen kann? Nur durch ein eigenständiges Talent macht man von sich reden; kriecherische Nachahmer gibt es zuhauf, doch Monsieur Vogel ist nicht dazu geboren, zu diesen zu gehören.“ (Mercure de France, 1786.)
Die tragische Größe des Sujets und die Leidenschaft der von Desriaux erdachten Heldin haben Vogel wohl gereizt, das Libretto mit einer Musik umzusetzen, die eine größtmögliche Intensität erreichen sollte. Das ist ihm offensichtlich gelungen, denn man attestierte ihm, sein Werk brilliere mit „Schönheit allerersten Ranges, {…} und alle waren sich darin einig, dass die Begleitung und die Rezitative seelenvoll und expressiv sind. Kurz, Vogel scheint ein rechtmäßiger Anwärter auf den Lorbeerkranz zu sein, der die Stirn des unsterblichen Gluck krönt, dessen Fußstapfen er – vielleicht etwas zu genau – folgt“ (Journal General de France, 1786). War seine Nachahmung des Meisters denn so greifbar? Beim Mercure de France war man von den Fähigkeiten des jungen Komponisten überzeugt und versuchte, ihn dazu zu ermutigen, seinen eigenen Weg zu suchen: „Warum sklavisch dem Vorbild eines anderen folgen, wenn man doch auch seine eigene Richtung einschlagen kann? Nur durch ein eigenständiges Talent macht man von sich reden; kriecherische Nachahmer gibt es zuhauf, doch Monsieur Vogel ist nicht dazu geboren, zu diesen zu gehören.“ (Mercure de France, 1786.)
