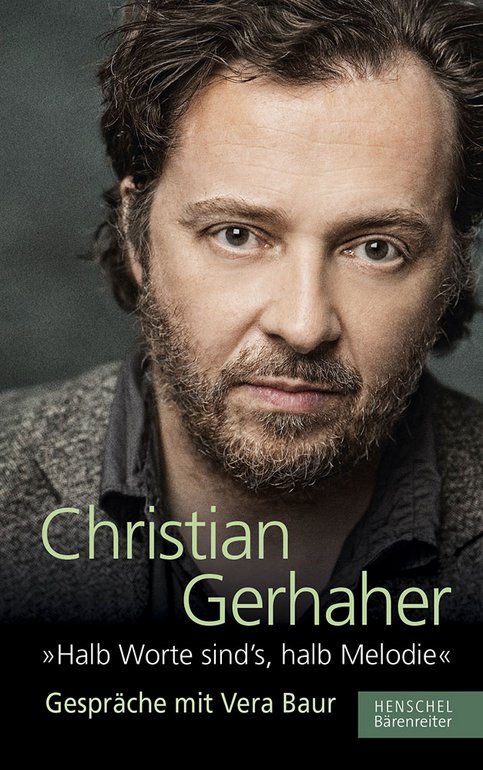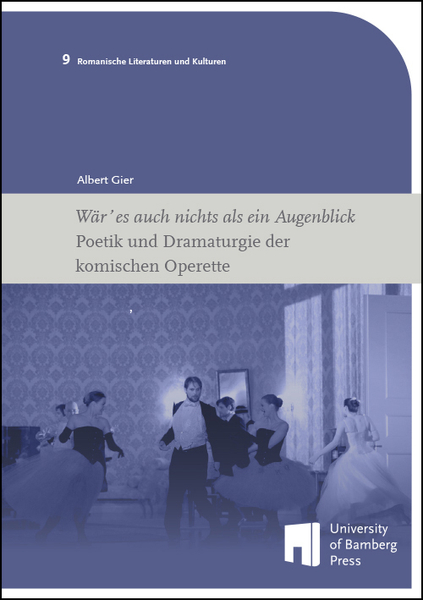Fast am Schluss ihres Gesprächsbuches stellt Vera Baur fest, dass ihr Partner Christian Gerhaher „ein Grübler und Zweifler“ sei, das aber hat auch der vom Protagonisten gefesselte Leser längst bemerkt und von dem nachdenklichen und zum Nachdenken auffordernden Werk profitiert. Wer dem vor allem und zunächst dem Lied, erst später und nun in zunehmendem Maße der Oper zugewandten Sänger durch das Liedertitel als Kapitelüberschriften verwendenden Buch bis dahin gefolgt ist, hat nicht nur, aber auch eine Menge insbesondere über Robert Schumann, den der Bariton über alles schätzt, ganz besonders aber dessen Komposition zu Goethes Faust erfahren. Der Untertitel des Buches Halb Worte sind’s, halb Melodie stammt von Joseph von Eichendorff.
Vera Baur berichtet in ihrem Vorwort darüber, wie man sich kennen lernte und auf die Idee kam, aus bereits stattgefundenen und noch zu führenden Gesprächen ein Buch werden zu lassen. In dessen erstem Kapitel, Lied eines Schmiedes, klingt ein Thema an, das das gesamte Buch durchziehen wird, die Hochschätzung Schumanns und die zumindest teilweise Ablehnung anderer Komponisten, so Brahms‘, hier wegen seiner Variationen einer Schumann-Komposition, später Richard Strauss wegen seiner frühen Lieder. Gerhaher scheut sich nicht, sehr bestimmte, persönliche Urteile abzugeben, einen Musikgeschmack zu bekunden, der vom weit verbreiteten, so das Spätwerk Schumanns betreffend, stark abweicht. Der Schluss des Buches wird eine beinahe hymnische Verteidigung („manische Begeisterung“) der oft geschmähten Vertonung von Textstellen aus Goethes Faust sein.
Es gibt durchaus aber auch Persönliches zu lesen, so über die unterschiedlichen Studiengänge Philosophie und Medizin, die der Hinwendung zur Musik vorausgingen, die Verpflichtung nur gegenüber Inge Borkh und Michael Stumpf, die Bedeutung des Freundes und Pianisten Gerold Huber, dessen Foto die Rückseite des Buches ziert. Der Sänger scheut sich nicht, die Dirigenten zu nennen, die er besonders schätzt: Blomstedt, Nagano, Thielemann (trotz Operette!), Rattle und Harding.
Mit Lotosblume überschrieben ist das Kapitel, in dem es unter anderem um die sogenannte Hochkultur geht, ihre Gefährdung durch die Sucht nach Events, das Problem oft schlechter Texte für wunderbare Kompositionen. Rundfunk, Fernsehen und Kultusminister sieht der Sänger in der Pflicht, ein Publikum für die Zukunft heranzubilden. „Man muss Ansprüche stellen“, nicht durch Kultur light den Menschen die Klassik schmackhaft machen wollen. Wichtig erscheint Gerhaher, dass Kultur ein Geheimnis bewahrt, nicht vollständig erklärbar ist. Manch ein Leser wird den Kopf über die Meinung schütteln, bei der Sängerausbildung würde zu viel Wert auf die Praxis gelegt, komme die Literatur zu kurz. Sonst hört man das ganz anders.
In Liebesbotschaft kann der Leser erfahren, wie Gerhaher zur Musik und speziell zum Lied kam, welche Rollen er auf der Opernbühne verkörpert, wobei es nicht verwundert, dass es die eher introvertierten Charaktere sind, die er bevorzugt, Wolfram, den Prinzen von Homburg oder Pelléas. Don Giovanni passt eigentlich nicht in diesen Kanon, ist aber der Bewunderung für Mozart geschuldet. Fotos des Opern- und Liedsängers gibt es im zweiten Fotoblock, der erste zeigt eher den Privatmenschen von Kindesbeinen an.
Zwar kehrt der Bariton immer wieder zu Schumann zurück, doch kommen praktische Erörterungen wie die über das Passaggio, Vibrato, über Werktreue, die Gestaltung von Liedprogrammen nicht zu kurz. Interessant sind die Vergleiche zwischen Schumann und Schubert, bzw. deren Liedern.
Im Kapitel Die Löwenbraut geht es um „freundliche“ und „gute“ Dirigenten, um das Fremdeln gegenüber Puccini, um die Arbeit mit Christof Loy und mit Einschränkungen um ein Plädoyer für das Regietheater. Ausführlich wird das Verhältnis zwischen Tannhäuser und Wolfram, wie es sich für den Bariton darstellt, erörtert. Zum Nachdenken regen Sätze wie „Der vorgestellte Klang ist das heiligste Gut des Sängers“ an. Leichter wird es dem Leser gemacht, der Meinung zuzustimmen, eine gewisse Distanz des darstellenden Künstlers gegenüber dem Werk müsse bleiben.
Wieder Schumann widmet sich das Kapitel Der schwere Abend, in dem von der „Konzeptkunst“ des Komponisten die Rede ist, Fragen der Lied-Programm-Gestaltung erörtert werden und der Leser zum Nachdenken über den Satz „Das Defizit ist das Interessantere“ angeregt wird. Oft löckt der Sänger gegen den allgemein „gültigen“ Stachel“, so wenn er die „Verschwommenheit“ eines Liedtextes preist, wenn er Brahms‘ allgemein geschätzte Volksliedvertonungen als die Institutionalisierung der Sentimentalität bezeichnet, die das Volkslied volksliedhafter macht, als es eigentlich ist. Gerade durch die vielen Behauptungen, die den allgemeinen Vorstellungen widersprechen, wird das Buch besonders lesenswert und nachhaltig.
Dem von Gerhaher ansonsten geschätzten Gustav Mahler ist ein besonders Kapitel gewidmet, in dem, unter anderem – wieder bisher ungehört und vielleicht auch unerhört – In diesem Wetter aus den Kindertotenliedern als „indiskret“ kritisiert wird. In einem späteren Kapitel bekennt er sich zum Schönberg der Hängenden Gärten, schreibt über Hollinger und Rihm, die für ihn komponierten und es weiterhin tun.
Wieder um Praktisches aus dem Sängeralltag geht es in Freisinn, um Timbre, Außenwirkung, Karriereaufbau. Und auch hier kann sich Staunen regen, denn zwar war die Gefahr von Glottis allgemein bekannt, nicht aber, dass man auch zu sehr „in die Maske Singen“, zu sehr den Ton abdunkeln kann, Vokale nicht verfärben solle. Das spricht gegen manche von anerkannten Gesangslehrern verbreitete Glaubenssätze.
Nicht nur ungewöhnliche Meinungen, sondern auch die Offenheit, mit der der Bariton über Zweifel und Probleme spricht, machen sein Buch zu einer ganz besonderen Lektüre. Der hohe Anspruch an sich selbst setzt sich durchaus fort in der unausgesprochenen Forderung an den Leser, sich auf ein ungewöhnliches Buch mit ebensolchen Meinungen einzulassen (Henschel Bärenreiter Verlag ISBN 978 3 89487 942 6).
Ingrid Wanja