In der neuesten Staffel der Most-Wanted-Recitals der Decca geht es auf einigen CDs ausgesprochen beschaulich zu. Es gibt keine Leichen, niemand zückt den Dolch, der Giftbecher bleibt im Schrank. Alles, was in der Oper passieren kann, passiert diesmal nicht. In breitestem Stereo breitet sich das Panorama der Alpen aus. Eine akustische Postkarte, noch schöner als die Wirklichkeit. Ein Alphorn ruft. Wer das hört, packt schon mal die Koffer für die nächste Reise in die Schweiz. Musikalisch sind wir bereits mittendrin. Lisa della Casa und Vico Torriani singen Lieder aus unserer Heimat (480 8150).
 Und wie sie singen. Mal aus der Ferne, mal ganz nah, mal sind sie ihr eigenes Echo. Sie werfen sich die Bälle zu, sind melancholisch, verliebt oder einfach nur bestens gelaunt. Sie passen erstaunlich gut zusammen mit ihren sehr klaren, von der Technik herausgestellten Stimmen, die legendäre Operndiva und der Schlagersänger, der sich gelegentlich auch als Fernsehkoch und Showmaster betätigte. Zunächst liegt das an der gemeinsamen Herkunft. Ob Swiizerdütsch, Italienisch oder Französisch. Sie singen, wie es kommt. Die Schweiz ist vielsprachig. Vor allem aber passen sie deshalb so gut zusammen, weil man ihnen das Volkslied auf der Alm am Ende des Tages doch nicht so richtig abnimmt. Sie spielen eine Rolle, an der sie Spaß haben – und schlafen doch nachts lieber in ihren weichen Betten als auf den harten Pritschen einer Hütte in den Bergen. Was Torrianis Hauptgeschäft war (Schlager und Hotellerie), ist bei Lisa della Casa, der unvergleichlichen Arabella, immer eine Sehnsucht gewesen, der sie gelegentlich nachgab. Sie liebte, was gemeinhin als die heitere Muse gilt. Sie trat in Operetten auf und sogar im „Blauen Bock“, der beliebten Samstagabendshow des Hessischen Rundfunks für die ganze Familie, wo die unverwüstliche Lia Wöhr Äppelwoi ausschenkte. Die etwas Älteren unter uns erinnern sich. Ich sehe sie vor mir mit ihrer betonierten Hochfrisur mit Kameralächeln, charmant und reserviert zugleich. Diese Volkslieder geisterten als bescheidene Kopie seit Jahren durch private Sammlungen. Nun also klingen sie wie neu, wie sie vielleicht nicht einmal auf der alten Platte klangen. Wie habe ich mich danach verzehrt. Nun höre ich die CD, bin zufrieden und um eine Illusion ärmer. Einmal mehr bewahrheitet sich der alte Spruch, dass die Sehnsucht unsere Seele nährt, nicht die Erfüllung.
Und wie sie singen. Mal aus der Ferne, mal ganz nah, mal sind sie ihr eigenes Echo. Sie werfen sich die Bälle zu, sind melancholisch, verliebt oder einfach nur bestens gelaunt. Sie passen erstaunlich gut zusammen mit ihren sehr klaren, von der Technik herausgestellten Stimmen, die legendäre Operndiva und der Schlagersänger, der sich gelegentlich auch als Fernsehkoch und Showmaster betätigte. Zunächst liegt das an der gemeinsamen Herkunft. Ob Swiizerdütsch, Italienisch oder Französisch. Sie singen, wie es kommt. Die Schweiz ist vielsprachig. Vor allem aber passen sie deshalb so gut zusammen, weil man ihnen das Volkslied auf der Alm am Ende des Tages doch nicht so richtig abnimmt. Sie spielen eine Rolle, an der sie Spaß haben – und schlafen doch nachts lieber in ihren weichen Betten als auf den harten Pritschen einer Hütte in den Bergen. Was Torrianis Hauptgeschäft war (Schlager und Hotellerie), ist bei Lisa della Casa, der unvergleichlichen Arabella, immer eine Sehnsucht gewesen, der sie gelegentlich nachgab. Sie liebte, was gemeinhin als die heitere Muse gilt. Sie trat in Operetten auf und sogar im „Blauen Bock“, der beliebten Samstagabendshow des Hessischen Rundfunks für die ganze Familie, wo die unverwüstliche Lia Wöhr Äppelwoi ausschenkte. Die etwas Älteren unter uns erinnern sich. Ich sehe sie vor mir mit ihrer betonierten Hochfrisur mit Kameralächeln, charmant und reserviert zugleich. Diese Volkslieder geisterten als bescheidene Kopie seit Jahren durch private Sammlungen. Nun also klingen sie wie neu, wie sie vielleicht nicht einmal auf der alten Platte klangen. Wie habe ich mich danach verzehrt. Nun höre ich die CD, bin zufrieden und um eine Illusion ärmer. Einmal mehr bewahrheitet sich der alte Spruch, dass die Sehnsucht unsere Seele nährt, nicht die Erfüllung.
Was die della Casa und Torriani höchst professionell hinlegen, missglückt der Holländerin Cristina Deutekom, die den Bonus mit einem Promenade Concert bestreitet. Es wurde eine Platte von 1972 hervorgekramt, die getrost hätte im Archiv bleiben können. Mir fällt die Vorstellung schwer, dass sie zwei Jahre später die Saison der Met als Elena in Verdis I vespri sicilani an der Seite von Plácido Domingo würde eröffnen. Wie denn das? Liegt es nur am vergeblichen Versuch, sich mit Liedern von Robert Stolz oder Peter Kreuder radebrechend wienerisch zu geben? Oder klirrt und tremoliert da etwas in den Höhen? An meinen Lautsprechern kann es nicht liegen. Die sind gut. Ich will der Gemeinde, die diese Sängerin immer noch haben dürfe, nicht zu nahe treten. Die Einspielung trägt nach meinem Urteil nicht zu ihrem Nachruhm bei. Decca scheint aber wild entschlossen, in der Most-Wanted-Reihe auch die falschen Perlen zu präsentieren. Wenn schon, denn schon! Auf zur nächsten CD, die es auch in sich hat.
 Hilde Gueden bäckt nämlich Kuchen. Die Gueden, die auch anders kann, gibt diesmal das kleine Mädchen. Wie niedlich. Dabei war sie Mitte Fünfzig, als sie im Wiener Sophiensaal ins Studio ging, um Kinderlieder aufzunehmen (480 8158). Stimmlich geht das fabelhaft. Sie muss sich nicht verstellen. Eine Art Kinderton war dieser Stimme seit jeher eigen. Er war ihr Markenzeichen. Selbst als Daphne oder Violetta Valery, erst Recht aber als Micaela oder Sophie schimmerte er durch. Ihr nimmt man die Kinderlieder ab. Ich wusste bislang nicht, dass es so eine Platte gegeben hatte, die nun auf CD gelangt es. Wundern tut es mich nicht. Es kann ja nicht verkehrt sein, solche Lieder, die auch allerhand Brauchtum verinnerlichen, am Klingen zu halten. „Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen“. Warum eigentlich gerufen? Der Text, den man mitschreiben könnte, während sie singt, geht auf eine praktische Tradition zurück. Nachdem das Brot aus dem Ofen geholt war, signalisierten die Bäcker die Nachbarschaft mit einem Horn, dass sie den selbst gebackenen Kuchen brächten, um die restliche Wärme zu nutzen. Heute ließe sich das als ökologisch verkaufen. „Suse, liebe Suse“, „Es klappert die Mühle“, „Ein Männlein steht im Walde“, „Alle meine Entchen“ … Und so geht lustig fort. Bei der „Vogelhochzeit“, die im schlimmsten Fall kein Ende nimmt, begnügt sich die Sängerin mit fünf Versen. Das reicht auch.
Hilde Gueden bäckt nämlich Kuchen. Die Gueden, die auch anders kann, gibt diesmal das kleine Mädchen. Wie niedlich. Dabei war sie Mitte Fünfzig, als sie im Wiener Sophiensaal ins Studio ging, um Kinderlieder aufzunehmen (480 8158). Stimmlich geht das fabelhaft. Sie muss sich nicht verstellen. Eine Art Kinderton war dieser Stimme seit jeher eigen. Er war ihr Markenzeichen. Selbst als Daphne oder Violetta Valery, erst Recht aber als Micaela oder Sophie schimmerte er durch. Ihr nimmt man die Kinderlieder ab. Ich wusste bislang nicht, dass es so eine Platte gegeben hatte, die nun auf CD gelangt es. Wundern tut es mich nicht. Es kann ja nicht verkehrt sein, solche Lieder, die auch allerhand Brauchtum verinnerlichen, am Klingen zu halten. „Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen“. Warum eigentlich gerufen? Der Text, den man mitschreiben könnte, während sie singt, geht auf eine praktische Tradition zurück. Nachdem das Brot aus dem Ofen geholt war, signalisierten die Bäcker die Nachbarschaft mit einem Horn, dass sie den selbst gebackenen Kuchen brächten, um die restliche Wärme zu nutzen. Heute ließe sich das als ökologisch verkaufen. „Suse, liebe Suse“, „Es klappert die Mühle“, „Ein Männlein steht im Walde“, „Alle meine Entchen“ … Und so geht lustig fort. Bei der „Vogelhochzeit“, die im schlimmsten Fall kein Ende nimmt, begnügt sich die Sängerin mit fünf Versen. Das reicht auch.
 Als Bonus werden Christmas Songs draufgepackt, die ebenfalls eine CD-Premiere sind. Sie stammen aus den frühen Jahren der Sängerin, von 1953, was auch zu hören ist. Ich habe schon mal hineingehört und kam mir vor, als würde ich jetzt schon heimlich Süßigkeiten naschen, die doch unter den Tannenbaum gehören. Weihnachten kann kommen. Im selben Jahr entstanden auch die Aufnahmen einer weiteren Gueden-CD. Sie besteht im Hauptteil aus Mozart. Ganz leicht schwebt Exsultate, jubilate, wenn da nicht die Koloraturen wären, über die rasch hinweg gehuscht wird. Sie sind nicht Sache der Gueden, wie es sich auch in der Arie „L’amerò, sarò cinstante“ aus Il ré patore zeigt. Pamina und Susanna liegen ihr mehr. Was als Bonus ausgewiesen ist, war einst Bestandteil der LP, aus der auch die ersten vier Szenen mit den Wiener Philharmonikern unter Josef Krips stammen. Obwohl die Ordnung in der ganzen Decca-Serie streng und abgezirkelt ist, gilt hier offenbar das Prinzip, die Nummern nach Dirigenten einzuteilen. Auf Krips folgt Clemens Krauss, der noch einmal die Gueden mit Mozart begleitet. Susanne kommt nun mit der so genannten Rosenarie zum Zuge, die genau so klingt wie der sanfte Cherubino. Wüsste man es nicht besser, es würde nicht klar, wer nun wer ist.
Als Bonus werden Christmas Songs draufgepackt, die ebenfalls eine CD-Premiere sind. Sie stammen aus den frühen Jahren der Sängerin, von 1953, was auch zu hören ist. Ich habe schon mal hineingehört und kam mir vor, als würde ich jetzt schon heimlich Süßigkeiten naschen, die doch unter den Tannenbaum gehören. Weihnachten kann kommen. Im selben Jahr entstanden auch die Aufnahmen einer weiteren Gueden-CD. Sie besteht im Hauptteil aus Mozart. Ganz leicht schwebt Exsultate, jubilate, wenn da nicht die Koloraturen wären, über die rasch hinweg gehuscht wird. Sie sind nicht Sache der Gueden, wie es sich auch in der Arie „L’amerò, sarò cinstante“ aus Il ré patore zeigt. Pamina und Susanna liegen ihr mehr. Was als Bonus ausgewiesen ist, war einst Bestandteil der LP, aus der auch die ersten vier Szenen mit den Wiener Philharmonikern unter Josef Krips stammen. Obwohl die Ordnung in der ganzen Decca-Serie streng und abgezirkelt ist, gilt hier offenbar das Prinzip, die Nummern nach Dirigenten einzuteilen. Auf Krips folgt Clemens Krauss, der noch einmal die Gueden mit Mozart begleitet. Susanne kommt nun mit der so genannten Rosenarie zum Zuge, die genau so klingt wie der sanfte Cherubino. Wüsste man es nicht besser, es würde nicht klar, wer nun wer ist.
 Drei Namen auf drei weiteren CDs stehen für Ernst und Würde: Heinrich Schlusnus, Hans Hotter und Hermann Prey. Alle drei singen Lieder. Schlusnus (480 8175) widmet sich hauptsächlich Franz Schubert. Als er damit in Wien bzw. in Genf für Decca engagiert wurde, war er Sechzig. Seine Glanzzeiten, in denen seine besten Liedaufnahmen entstanden, lagen hinter ihm. Seine Stimme ist müde geworden. Mit Technik gleicht er aus, was unwiederbringlich verloren ging. Er wählt ein sehr langsames Tempo, das gewöhnungsbedürftig ist. Mit dieser Drosselung gewinnt sein Bariton mehr Kraft. Steigerungen können sich in aller Ruhe aufbauen. Nach drei Liedern empfand ich das als sehr anstrengend, also zu gewollt. Deshalb empfiehlt es sich, die CD in Raten zu hören. Dann stellt sich der starke Eindruck von diesem Vortrag immer wieder aufs Neue ein und verbraucht sich nicht. Trotz aller Defizite hat sich aus den besseren Tagen ein Maß an Ausdruck erhalten, der für Schubert unabdingbar ist. Schlusnus wird von Sebastian Peschko begleitet, der als einer der bedeutendsten Vertreter seines Fachs gilt und sich als Rundfunkpionier unermüdlich für die Verbreitung klassischer Musik einsetzte. Als etwas abrupt wirkt nach so viel Lyrik der überwiegend dramatische Anhang, bestehend aus vier Opernszenen aus Fidelio („Ha! Welch ein Augenblick!“), Tannhäuser („Gar viel und schön“), Falstaff („He, holla! Wirtschaft!“) und Barbier von Bagdad („Heil, diesem Hause . . . Salam aleikum“) mit Otto Edelmann unter Rudolf Moralt von 1953 – etwas dumpfes Mono wie auch die Lieder mit Schlusnus.
Drei Namen auf drei weiteren CDs stehen für Ernst und Würde: Heinrich Schlusnus, Hans Hotter und Hermann Prey. Alle drei singen Lieder. Schlusnus (480 8175) widmet sich hauptsächlich Franz Schubert. Als er damit in Wien bzw. in Genf für Decca engagiert wurde, war er Sechzig. Seine Glanzzeiten, in denen seine besten Liedaufnahmen entstanden, lagen hinter ihm. Seine Stimme ist müde geworden. Mit Technik gleicht er aus, was unwiederbringlich verloren ging. Er wählt ein sehr langsames Tempo, das gewöhnungsbedürftig ist. Mit dieser Drosselung gewinnt sein Bariton mehr Kraft. Steigerungen können sich in aller Ruhe aufbauen. Nach drei Liedern empfand ich das als sehr anstrengend, also zu gewollt. Deshalb empfiehlt es sich, die CD in Raten zu hören. Dann stellt sich der starke Eindruck von diesem Vortrag immer wieder aufs Neue ein und verbraucht sich nicht. Trotz aller Defizite hat sich aus den besseren Tagen ein Maß an Ausdruck erhalten, der für Schubert unabdingbar ist. Schlusnus wird von Sebastian Peschko begleitet, der als einer der bedeutendsten Vertreter seines Fachs gilt und sich als Rundfunkpionier unermüdlich für die Verbreitung klassischer Musik einsetzte. Als etwas abrupt wirkt nach so viel Lyrik der überwiegend dramatische Anhang, bestehend aus vier Opernszenen aus Fidelio („Ha! Welch ein Augenblick!“), Tannhäuser („Gar viel und schön“), Falstaff („He, holla! Wirtschaft!“) und Barbier von Bagdad („Heil, diesem Hause . . . Salam aleikum“) mit Otto Edelmann unter Rudolf Moralt von 1953 – etwas dumpfes Mono wie auch die Lieder mit Schlusnus.
 Für Hans Hotter (480 8160) kommen die Lieder, bei denen Geoffrey Parsons am Klavier sitzt, zu spät. Dafür klingen sie technisch um Längen besser. Sie wurden 1973 in Stereo aufgenommen. Mehr noch als Schlusnus rettet er sich in die Gestaltung. Was er dabei zustande bringt, grenzt an Wunder. Gelernt ist gelernt. Hotter verfügt über einen endlosen Vorrat an Farben. Er zwingt seinen von Haus aus schweren Heldenbariton gern ins feinste Piano, gibt jedem Wort seine Bedeutung, weil er weiß, was er singt. Dramatische Ausbrüche wie in Hugo Wolfs „Der verzweifelte Liebhaber“ gehen gar nicht mehr. Wenn er doch den feinsinnigen Wolf weggelassen hätte. „Wenn du zu den Blumen gehst“ und „Anakreons Grab“ sind doch nicht für diese Stimme, die ihren Kern verloren hatte. Balladen von Carl Loewe – darunter „Odins Meeresritt“ und „Hochzeitslied“ – gehen ihm viel von diesen Lippen, auch der oft dunkel versonnene Brahms gelingt noch hervorragend.
Für Hans Hotter (480 8160) kommen die Lieder, bei denen Geoffrey Parsons am Klavier sitzt, zu spät. Dafür klingen sie technisch um Längen besser. Sie wurden 1973 in Stereo aufgenommen. Mehr noch als Schlusnus rettet er sich in die Gestaltung. Was er dabei zustande bringt, grenzt an Wunder. Gelernt ist gelernt. Hotter verfügt über einen endlosen Vorrat an Farben. Er zwingt seinen von Haus aus schweren Heldenbariton gern ins feinste Piano, gibt jedem Wort seine Bedeutung, weil er weiß, was er singt. Dramatische Ausbrüche wie in Hugo Wolfs „Der verzweifelte Liebhaber“ gehen gar nicht mehr. Wenn er doch den feinsinnigen Wolf weggelassen hätte. „Wenn du zu den Blumen gehst“ und „Anakreons Grab“ sind doch nicht für diese Stimme, die ihren Kern verloren hatte. Balladen von Carl Loewe – darunter „Odins Meeresritt“ und „Hochzeitslied“ – gehen ihm viel von diesen Lippen, auch der oft dunkel versonnene Brahms gelingt noch hervorragend.
 Hermann Prey hat solche Probleme nicht. Er war Mitte Dreißig, als er gemeinsam mit Gerald Moore an seine Einspielungen ging. Er konnte aus dem Vollen seines gefälligen Baritons schöpfen. Das tut er auch. Auf der CD (480 8172) werden zwei Platten zusammengeworfen, die mit Abstand von einem knappen Jahr in London produziert wurden. Hugo Wolf und Richard Strauss halten sich mit je vierzehn Titeln die Waage. Der Rest stammt von Hans Pfitzner, den es gar nicht freuen würde, sich wieder einmal eingeklemmt zwischen die beiden zu sehen. Strauss gelingt famos. Prey legt in dessen Lieder jeden Überschwang, der sich denken lässt. Alles ist Gefühl. Nichts wird hinterfragt in diesen Texten, die meisten von Dahn und Bierbaum stammen. Also nicht von Goethe oder Heine. Prey gibt Strauss, was Strauss ist. Schönheit pur, angereichert mit einer Portion Schmalz. Selbst der weniger eingängige Wolf klingt bei Prey gefälliger als sonst.
Hermann Prey hat solche Probleme nicht. Er war Mitte Dreißig, als er gemeinsam mit Gerald Moore an seine Einspielungen ging. Er konnte aus dem Vollen seines gefälligen Baritons schöpfen. Das tut er auch. Auf der CD (480 8172) werden zwei Platten zusammengeworfen, die mit Abstand von einem knappen Jahr in London produziert wurden. Hugo Wolf und Richard Strauss halten sich mit je vierzehn Titeln die Waage. Der Rest stammt von Hans Pfitzner, den es gar nicht freuen würde, sich wieder einmal eingeklemmt zwischen die beiden zu sehen. Strauss gelingt famos. Prey legt in dessen Lieder jeden Überschwang, der sich denken lässt. Alles ist Gefühl. Nichts wird hinterfragt in diesen Texten, die meisten von Dahn und Bierbaum stammen. Also nicht von Goethe oder Heine. Prey gibt Strauss, was Strauss ist. Schönheit pur, angereichert mit einer Portion Schmalz. Selbst der weniger eingängige Wolf klingt bei Prey gefälliger als sonst.
Rüdiger Winter



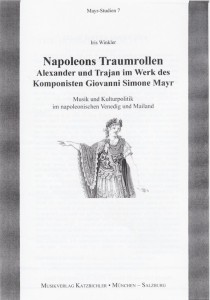 The opening chapters detail the groundwork: Einleitung introduces the young Napoleon’s musical tastes, including his liking for Paisiello (and an unfortunate but formative clash with Cherubini); Einführung in die Thematik covers the enthusiastic reception for this nascent imperial comet over an unwitting lagoon; the twin sections Napoleon und die Kunst der Reprasentation/Napoleon und die „Gewalt der Musik“: Chantons du nouvel Alexandre recount, among other significant items, his brush with revolutionary and other French composers and initial link with Mayr; Facetten des kulturellen Lehens in „napoleonischen“ Venedig
The opening chapters detail the groundwork: Einleitung introduces the young Napoleon’s musical tastes, including his liking for Paisiello (and an unfortunate but formative clash with Cherubini); Einführung in die Thematik covers the enthusiastic reception for this nascent imperial comet over an unwitting lagoon; the twin sections Napoleon und die Kunst der Reprasentation/Napoleon und die „Gewalt der Musik“: Chantons du nouvel Alexandre recount, among other significant items, his brush with revolutionary and other French composers and initial link with Mayr; Facetten des kulturellen Lehens in „napoleonischen“ Venedig
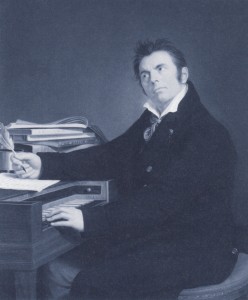


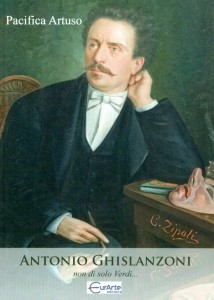 Weit weniger erforscht ist Ghislanzonis Leben über jenes als Librettist hinaus, nämlich als Sänger und als freier Schriftsteller. Indem Pacifica Artuso ihr Buch diesen beiden anderen Wirkungsgebieten Ghislanzonis widmet, füllt sie eine echte Lücke. Der erste Teil des Buches („Il baritono“, S. 13-76) verdient besondere Aufmerksamkeit. Darin wird die kurze Karriere Ghislanzonis als Bariton dargestellt. Sie begann 1847 in Lodi (40 km südlich von Mailand) mit dem Debut in der Luisa Strozzi des obskuren Komponisten Gualtiero Sanelli (1816-1861) und endete abrupt , als Ghislanzoni 1855 in Mailand (in Teatro Carcano, nicht an der Scala) in Nicolais Templario ausgebuht wurde. Er war ein zweitrangiger Sänger, der mit wenigen Ausnahmen dazu verdammt war, schlecht bezahlte Engagements bei provinziellen Bühnen zu ergattern. Aber die Darstellung dieser wenigen Jahre, die Artuso mit akribisch zusammengestellten Quellen rekonstruiert, ist deswegen besonders spannend geraten, weil dadurch dem Leser auch die Schattenseiten der Opernindustrie im Goldenen Zeitalter vor Augen geführt werden, einer bunten Welt, in der sich allerlei Menschenschlag tummelte (ganz anders als heutzutage, versteht sich): zahllose schlecht ausgebildete Sänger, die nach wenigen Jahren ihre Stimme verloren (Ghislanzoni gehört wohl auch zu dieser Kategorie), rücksichtslose impresari und skrupellose Agenten (in jener Zeit entstanden die Künstleragenturen modernen Zuschnittes, über die er schon damals Amüsantes zu berichten hat) und – so zumindest in Ghislanzonis Urteil – auch eine Horde von mäßig begabten Komponisten, deren Ehrgeiz in keinem Verhältnis zu ihrem Talent stand. Spätestens bei der Lektüre solcher Passagen schlägt der Puls des Raritätensammlers höher, der sich heutzutage über jede Ausgrabung aus dem Ottocento freut und nun einsehen muss, dass Ghislanzoni manche dieser Wiederauferstehungen (etwa der Opern Paolo Carrers) in höchstem Masse überrascht hätte. Der zweite Teil des Buches („Gli artisti da teatro“, S. 76-125) ist einem weiteren Leben Ghislanzonis gewidmet, jenem als freier und äußerst produktiver Schriftsteller. In seinen Veröffentlichungen kam Ghislanzoni selbstredend gerne auch auf musikalische Sujets zu sprechen. Die Autorin stellt hier einen umfangreichen Roman über die Oper vor, die „Artisti da teatro“, 1865 veröffentlicht , in denen Ghislanzoni Selbstbiographisches, Historisches (so wenn er sachkundig über berühmte Sänger der Zeit berichtet) und Fiktives vermischt. In Artusos Darstellung sieht es fast so aus, als ob die tragische Geschichte der unglücklichen Liebe eines Tenors und eines Soprans, welche dem Roman zugrundliegt (und, wie es scheint, selbstironisch melodramatisch angelegt ist), eigentlich nur ein Vorwand war, um zum Opernbetrieb der Zeit Stellung zu nehmen. Bei der Lektüre von Artusos Ausführungen bekommt man große Lust, den ganzen Rom zu lesen, der offenbar nie in seiner Gesamtheit nachgedruckt wurde (er ist als Digitalisat über Google jedoch verfügbar). Wäre eine Neuedition nicht eine schöne Aufgabe für einen jungen Musikwissenschaftler, der außerhalb ausgetretener Pfade forschen möchte? Weniger interessant fand schließlich der Rezensent Artusos Beobachtungen zu Ghislanzoni und Verdi im dritten Teil des Buches („Verdi visto da Ghislanzoni“, S. 126-158). Pacifica Artuso ist insgesamt kein großer Wurf gelungen. Einige Leser werden sich über den disparaten Charakter dieser Publikation aufregen, die eher einer Aufsatzsammlung als einem durchkonzipierten Buch ähnelt; andere werden schmerzlich ein Register vermissen, wodurch die Fülle von Informationen zu Komponisten und Künstlern der Zeit, die geboten werden, nicht leicht greifbar sind; und niemand muss schließlich die Begeisterung der Verfasserin für den logorrhöischen Schriftsteller Ghislanzoni teilen. Er gehörte zur damaligen literarischen Avantgarde (der lombardischen Scapigliatura), aber seine Erzählungen und Romane sind oft literarische Ergüsse eines ungepflegt schreibenden Schreiberlings, der zum Überleben unentwegt veröffentlichen musste. Trotzdem sei dieses Buch vor allem wegen der beiden ersten Kapitel allen Liebhabern der italienischen Oper in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts empfohlen.
Weit weniger erforscht ist Ghislanzonis Leben über jenes als Librettist hinaus, nämlich als Sänger und als freier Schriftsteller. Indem Pacifica Artuso ihr Buch diesen beiden anderen Wirkungsgebieten Ghislanzonis widmet, füllt sie eine echte Lücke. Der erste Teil des Buches („Il baritono“, S. 13-76) verdient besondere Aufmerksamkeit. Darin wird die kurze Karriere Ghislanzonis als Bariton dargestellt. Sie begann 1847 in Lodi (40 km südlich von Mailand) mit dem Debut in der Luisa Strozzi des obskuren Komponisten Gualtiero Sanelli (1816-1861) und endete abrupt , als Ghislanzoni 1855 in Mailand (in Teatro Carcano, nicht an der Scala) in Nicolais Templario ausgebuht wurde. Er war ein zweitrangiger Sänger, der mit wenigen Ausnahmen dazu verdammt war, schlecht bezahlte Engagements bei provinziellen Bühnen zu ergattern. Aber die Darstellung dieser wenigen Jahre, die Artuso mit akribisch zusammengestellten Quellen rekonstruiert, ist deswegen besonders spannend geraten, weil dadurch dem Leser auch die Schattenseiten der Opernindustrie im Goldenen Zeitalter vor Augen geführt werden, einer bunten Welt, in der sich allerlei Menschenschlag tummelte (ganz anders als heutzutage, versteht sich): zahllose schlecht ausgebildete Sänger, die nach wenigen Jahren ihre Stimme verloren (Ghislanzoni gehört wohl auch zu dieser Kategorie), rücksichtslose impresari und skrupellose Agenten (in jener Zeit entstanden die Künstleragenturen modernen Zuschnittes, über die er schon damals Amüsantes zu berichten hat) und – so zumindest in Ghislanzonis Urteil – auch eine Horde von mäßig begabten Komponisten, deren Ehrgeiz in keinem Verhältnis zu ihrem Talent stand. Spätestens bei der Lektüre solcher Passagen schlägt der Puls des Raritätensammlers höher, der sich heutzutage über jede Ausgrabung aus dem Ottocento freut und nun einsehen muss, dass Ghislanzoni manche dieser Wiederauferstehungen (etwa der Opern Paolo Carrers) in höchstem Masse überrascht hätte. Der zweite Teil des Buches („Gli artisti da teatro“, S. 76-125) ist einem weiteren Leben Ghislanzonis gewidmet, jenem als freier und äußerst produktiver Schriftsteller. In seinen Veröffentlichungen kam Ghislanzoni selbstredend gerne auch auf musikalische Sujets zu sprechen. Die Autorin stellt hier einen umfangreichen Roman über die Oper vor, die „Artisti da teatro“, 1865 veröffentlicht , in denen Ghislanzoni Selbstbiographisches, Historisches (so wenn er sachkundig über berühmte Sänger der Zeit berichtet) und Fiktives vermischt. In Artusos Darstellung sieht es fast so aus, als ob die tragische Geschichte der unglücklichen Liebe eines Tenors und eines Soprans, welche dem Roman zugrundliegt (und, wie es scheint, selbstironisch melodramatisch angelegt ist), eigentlich nur ein Vorwand war, um zum Opernbetrieb der Zeit Stellung zu nehmen. Bei der Lektüre von Artusos Ausführungen bekommt man große Lust, den ganzen Rom zu lesen, der offenbar nie in seiner Gesamtheit nachgedruckt wurde (er ist als Digitalisat über Google jedoch verfügbar). Wäre eine Neuedition nicht eine schöne Aufgabe für einen jungen Musikwissenschaftler, der außerhalb ausgetretener Pfade forschen möchte? Weniger interessant fand schließlich der Rezensent Artusos Beobachtungen zu Ghislanzoni und Verdi im dritten Teil des Buches („Verdi visto da Ghislanzoni“, S. 126-158). Pacifica Artuso ist insgesamt kein großer Wurf gelungen. Einige Leser werden sich über den disparaten Charakter dieser Publikation aufregen, die eher einer Aufsatzsammlung als einem durchkonzipierten Buch ähnelt; andere werden schmerzlich ein Register vermissen, wodurch die Fülle von Informationen zu Komponisten und Künstlern der Zeit, die geboten werden, nicht leicht greifbar sind; und niemand muss schließlich die Begeisterung der Verfasserin für den logorrhöischen Schriftsteller Ghislanzoni teilen. Er gehörte zur damaligen literarischen Avantgarde (der lombardischen Scapigliatura), aber seine Erzählungen und Romane sind oft literarische Ergüsse eines ungepflegt schreibenden Schreiberlings, der zum Überleben unentwegt veröffentlichen musste. Trotzdem sei dieses Buch vor allem wegen der beiden ersten Kapitel allen Liebhabern der italienischen Oper in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts empfohlen.






