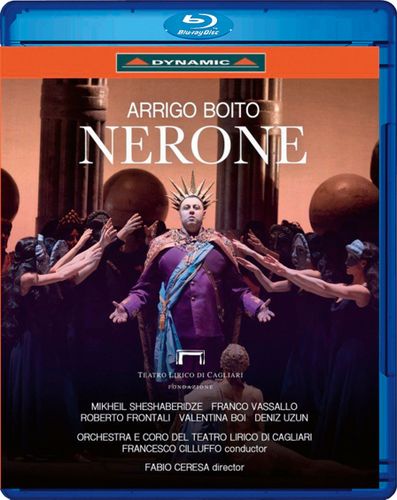.
Contemplation! Der Titel gibt sich grüblerisch. Gemeint ist die erste CD, die ausschließlich dem Bariton Huw Montague Rendall gewidmet ist – erschienen bei Erato, wo er neuerdings unter Vertrag steht (2173236378). Diesen Namen muss man sich nicht erst merken, Freundinnen und Freunde der Oper kennen ihn. Auch wenn mancher noch rätseln mag, wie man den Vornamen richtig ausspricht. Er ist walischer Herkunft. Seine englische Form lautet Hugh, die deutsche schlicht Hugo. Onomatologisch gesehen bedeutet Huw „der Geistvolle“, der „mit großem Verstand Ausgestattete“. Seine Eltern sind die Mezzosopranistin Diana Montague und der Tenor David Rendall. Sie singt u. a. die Tauridische Iphigénie in Gardiners Aufnahme der Gluck-Oper bei Philips, er den Ferrando in Cosi fan tutte unter Alain Lombard bei Erato. Damit wäre auch die Zusammensetzung des Sohnes Nachname geklärt. Neigung und Talent zur Oper scheinen also vererbt.
Verschiedenen Biographien im Netz zufolge studierte Montague Rendall am Royal College of Music London und absolvierte das Internationale Opernstudio Zürich. Auftritte gab es in Covent Garden London, an der Lyric Opera von Chicago, am Théâtre des Champs-Élysées in Paris und bei den Festspielen in Glyndebourne, Salzburg und Aix-en-Provence. Im Repertoire hat er Almaviva und Figaro, Papageno, Pelléas, Aeneas von Purcell. Als Konzertsänger tritt er mit Liedern und Sakralwerken von Brahms, Händel, Fauré und Vaughan Williams auf. In jüngster Zeit hatte er eine Reihe bemerkenswerter Debüts, so in Ambroise Thomas’ Hamlet in einer Neuinszenierung an der Komischen Oper Berlin, seinen Einstand an der Opéra National de Paris in den Partien des Papageno und des Mercutio (Roméo et Juliette), an der Opéra National du Rhin, an der Staatsoper Hamburg sowie an der Santa Fe Opera. Geboren wurde er 1993. Wer ihn auf Bühnen oder in Filmclips gesehen hat, wird kaum nach seinem Alter fragen. Der Sänger verströmt Jugend, Charme, Weltläufigkeit und gute Manieren. Ein Sympathieträger durch und durch. Er weiß sich zu bewegen und kann – wenn es denn sein muss – auch still stehen.
 Für das mehrsprachige Booklet hat er einen eigenen Text beigesteuert. Bei vielen Firmen hat sich das so eingebürgert, wenngleich es nicht immer nötig ist. Sein Text nun – kontemplativ wie es der Titel der Neuerscheinung selbst verlangt – hat es in sich. Ein junger Sänger will es nicht beim möglichst perfekten Gebrauch der menschlichen Stimme belassen. Und sich auf keinen Fall Szenen, Arien oder Lieder in einer x-beliebigen Sprache phonetisch einpauken. Er will verstehen, was er singt, ist durch vertiefte Betrachtung auf eigenen Erkenntnisgewinn aus, den er auch noch weitergeben möchte an sein Publikum. Ein Sänger mit philosophischen Ambitionen also, was mich an Fischer-Dieskau erinnert. Hört man es auch? Auf jeden Fall gefällt es. Und vielleicht gerade deshalb, weil sich Montague Rendall Gedanken macht. Der Text beginnt so: „Wer sind wir, was ist unser Zweck und was bleibt von uns nach unserem Tod? Wir sind nichts als Sternenstaub, Wesen kosmischen Ursprungs, schwebend in der Weite des Universums. Unsere flüchtige, vergängliche Existenz ist ein Rätsel, welches das kollektive menschliche Bewusstsein fesselt und unsere Geschichte formt wie die unablässigen Gezeiten die Küste formen.“ Künstler, die Visionäre unserer Welt, würden diesen existentiellen Konflikten auf den Grund gehen wollen, wobei sie ihre Kunst als Leuchtfeuer einsetzten, um diese Mysterien zu durchmessen und ständig zu erforschen, gibt sich Huw Montague Rendall, der allerdings nur für sich sprechen kann, überzeugt. Kontemplation habe ihm wie ein Spiegel Einblick in die vielfältige Art dieser Rätsel ermöglicht. Genau dieses Konzept sei der Kompass bei der Musikauswahl für dieses Programm gewesen. „Musik hat sich in meinem Leben immer wieder als beherrschende Kraft erwiesen, die mir in den heftigen Lebensstürmen Orientierung gibt.“ Sie sei eine unschätzbare Gefährtin und biete tiefe Einsichten in die labyrinthische Vielschichtigkeit der menschlichen Psyche. Die „sorgfältig ausgewählten Kompositionen wirken wie ein Spiegel, indem sie die Vielfalt der Lebenswirklichkeit wiedergeben und zu besinnlichen Reisen in mein Unterbewusstsein anregen. Ohne diesen harmonischen Leitfaden und die dadurch gebotenen nachdenklichen Offenbarungen wäre mein Leben völlig anders verlaufen“. Diese Offenheit dürfte sein Publikum für ihn einnehmen.
Für das mehrsprachige Booklet hat er einen eigenen Text beigesteuert. Bei vielen Firmen hat sich das so eingebürgert, wenngleich es nicht immer nötig ist. Sein Text nun – kontemplativ wie es der Titel der Neuerscheinung selbst verlangt – hat es in sich. Ein junger Sänger will es nicht beim möglichst perfekten Gebrauch der menschlichen Stimme belassen. Und sich auf keinen Fall Szenen, Arien oder Lieder in einer x-beliebigen Sprache phonetisch einpauken. Er will verstehen, was er singt, ist durch vertiefte Betrachtung auf eigenen Erkenntnisgewinn aus, den er auch noch weitergeben möchte an sein Publikum. Ein Sänger mit philosophischen Ambitionen also, was mich an Fischer-Dieskau erinnert. Hört man es auch? Auf jeden Fall gefällt es. Und vielleicht gerade deshalb, weil sich Montague Rendall Gedanken macht. Der Text beginnt so: „Wer sind wir, was ist unser Zweck und was bleibt von uns nach unserem Tod? Wir sind nichts als Sternenstaub, Wesen kosmischen Ursprungs, schwebend in der Weite des Universums. Unsere flüchtige, vergängliche Existenz ist ein Rätsel, welches das kollektive menschliche Bewusstsein fesselt und unsere Geschichte formt wie die unablässigen Gezeiten die Küste formen.“ Künstler, die Visionäre unserer Welt, würden diesen existentiellen Konflikten auf den Grund gehen wollen, wobei sie ihre Kunst als Leuchtfeuer einsetzten, um diese Mysterien zu durchmessen und ständig zu erforschen, gibt sich Huw Montague Rendall, der allerdings nur für sich sprechen kann, überzeugt. Kontemplation habe ihm wie ein Spiegel Einblick in die vielfältige Art dieser Rätsel ermöglicht. Genau dieses Konzept sei der Kompass bei der Musikauswahl für dieses Programm gewesen. „Musik hat sich in meinem Leben immer wieder als beherrschende Kraft erwiesen, die mir in den heftigen Lebensstürmen Orientierung gibt.“ Sie sei eine unschätzbare Gefährtin und biete tiefe Einsichten in die labyrinthische Vielschichtigkeit der menschlichen Psyche. Die „sorgfältig ausgewählten Kompositionen wirken wie ein Spiegel, indem sie die Vielfalt der Lebenswirklichkeit wiedergeben und zu besinnlichen Reisen in mein Unterbewusstsein anregen. Ohne diesen harmonischen Leitfaden und die dadurch gebotenen nachdenklichen Offenbarungen wäre mein Leben völlig anders verlaufen“. Diese Offenheit dürfte sein Publikum für ihn einnehmen.

Huw Montague Rendall (Papageno) und Elisabeth Boudreault (Papagena) bei der CD-Aufnahme im Studio / Warner Classics (YouTube Screenshot)
Die Auswahl will also mehr sein eine Auswahl an Vielseitigkeit und Können, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat. Sie folgt einem intellektuell ausgeklügelten Konzept. Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Auch die Abfolge der Nummern nicht. Wenn beispielsweise auf die Szene des Fritz „Mein Sehnen, mein Wähnen“ aus Korngolds Die Tote Stadt Mahlers Lieder eines Jahrenden Gesellen folgen, geschieht dies mit hintersinnigem Bedacht, der – wenn alles gut geht – auch dem Publikum an den Lausprechern oder unter Kopfhörern aufgehen soll. Ein prüfender Blick in die im Booklet abgedruckten Texte erübrigt sich, weil jedes Wort zu verstehen ist, womit eine der Stärken des Interpreten herausgestellt sei. Noch mehr gewinnen die Stücke, wenn sie aus dem schwerfälligen konzeptionellen Überbau gelöst werden. So jedenfalls meine eigene Hörerfahrung mit dieser CD. In Anbetracht ihres träumerischen Ansatzes, eingebettet in raffinierte Tempi, könnte man schwören, die Gesellen-Lieder selten melancholischer vernommen zu haben. Damit dieser Eindruck nicht zu rasch wieder verfliegt, hilft nur der entschlossene Gebrauch der Pausentaste. Denn die sich unmittelbar anschließende Szene des Billy Budd „Look Through the Port“ aus der Britten-Oper wäre nach Mahler wohl des Guten zu viel. Bis auf den Liederzyklus nehmen die Nummern keinen Schaden, wenn sie in loser Abfolge und auch einzeln konsumiert werden. So ein Fall ist der herzzerreißend vorgetragene Monolog des arbeitslosten leichtfüßigen Billy Bigelow aus Carousel von Richard Rodgers, dem Broadway-Musical vom Feinsten. Eine dramatische Story teilt sich in einer eingängigen musikalischen Form mit, wie sie nur amerikanische Komponisten zuwege bringen. Bigelow sinnt über seine prekäre Lebenslage und das ungeborene Kind, dessen Vater er ist, nach. Er wird ein schlimmes Ende mit ihm nehmen. Wer am Vortrag von Montague Rendall Gefallen findet, wird zuletzt danach fragen, warum dieser Monolog eine kontemplative Reaktion in Gang setzen soll. Und selbst die Szene Papagenos mit Papagena (Elisabeth Boudreault) und den drei Knaben (Oliver Barlow, Sam Jackman und Benjamin Gilbert) aus dem zweiten Akt der Zauberflöte – genügt sie sich nicht in ihrer singspielartigen Klarheit und betörenden musikalischen Eingebung? Der Interpret sieht es etwas anders, wenn er schreibt: „Diese musikalischen Meisterwerke führen gelegentlich zu Betrachtungen über so vielseitige Themen wie Sterblichkeit, einen berauschenden Liebestrank und die ungeheure Kraft einer persönlichen Entscheidung. Sie dienen als zeitlose Anleitung für das Überwinden von Zeiten aufgewühlten Leids und sich auftürmenden, bedrängenden Unglücks. Die Macht der Musik lässt sich mit den unvorhersehbaren Strömungen eines mächtigen Flusses vergleichen: manchmal muss man die Stärke aufbringen, um gegen den reißenden Strom anzuschwimmen, während man sich andererseits der Strömung überlässt und sich von ihr stromabwärts treiben lässt. Musik zeugt, wie dieser Fluss, von der ehrwürdigen Schönheit der Natur und der Widerstandskraft des menschlichen Geistes.“

Mercutio (Huw Montague Rendall) kommt Roméo (Benjamin Bernheim) nahe. Eine Szene aus Gounods „Roméo et Juliette“ 2023 in der Pariser Oper / YouTube Screenshot
Noch mehr Mozart gibt es mit der großen Conte-Arie aus dem dritten Figaro-Akt „Hai già vinta la causa! … Vedrò, mentr’io sospiro“ und Don Giovannis Canzonetta „Deh, vieni alla finestra“ aus dem zweiten Akt. Szenen, die im Vergleich mit dem übrigen Angebot, etwas abfallen. Was noch? Mercutios Mab-Ballade aus Gounods Roméo et Juliette sowie Rezitativ und Arie des Valentin „O sainte médaille – Avant de quitter ces lieux“ aus Faust vom selben Komponisten – ein Fach, mit dem er seine eigentliche Domäne gefunden zu haben scheint. Montague Rendall passt die Stimmfarbe den Figuren an, haucht Töne aus und unterdrückt die Ängste nicht, mit denen der Bruder Marguerites in den Krieg zieht. Von der existentiellen Introspektion Hamlets, verewigt in Ambroise Thomas’ monumentaler Oper nach Shakespeares Meisterwerk, bis zu den skurrilen romantischen Eskapaden von Monsieur Beaucaire in der Sicht von André Messager (beide Werke werden vom Sänger als einzige direkt genannt) sei diese aufreizende Vorstellung von „vielleicht“ immer gegenwärtig. Dieser einzelne Begriff, gleichbedeutend mit möglich und ungewiss, beschäftige ihn ständig. „Kann sein“, „was wär wenn“. Derartige Betrachtungen führten zu einer geheimen Türschwelle; ein kurzer Blick durch das Schlüsselloch sei eine entmutigende Aussicht. „Wie steuert man durch das vertrackte Labyrinth grenzenloser Möglichkeiten?“ Diese Musikzusammenstellung zeuge von der unbeugsamen Natur der menschlichen Seele und ergründe „unsere angeborene Fähigkeit“ zu gesunden und durch Introspektion zu wachsen.
Montague Rendall, der vom Opéra Orchestre Rouen unter Ben Glassberg begleitet wird, lässt nicht locker: „Wir haben das außerordentliche Glück, in einer Zeit zu leben, in der der Diskurs über mentale Gesundheit stark zugenommen hat und die Hilfsmöglichkeiten sich vermehrt haben. Dieses günstige Umfeld hat zahllose Einzelpersonen dazu angeregt, mit ihren persönlichen Geschichten ins Rampenlicht zu treten, um Beziehungen zu Menschen mit gleicher Erfahrung aufzubauen. Dieses Album will Selbstbetrachtung fördern und bietet denjenigen Trost, die sich auf den Weg zur Selbstfindung machen.“ Und weiter: „Kontemplation hat mich zu einer beeindruckenden Introspektion befähigt, die mir den Weg zu meinem tiefsten Selbst bereitet hat. Voller Erwartung zeige ich nun diesen Weg auf und hoffe, mit Ihnen eine tiefempfundene Verbindung herzustellen. Voller aufrichtiger Gefühle biete ich Ihnen dieses Album an und lade Sie ein, mich auf diesem Weg zu begleiten.“ (Foto oben: Huw Montague Rendall in einem Ausschnitt aus dem Booklet seiner neuen CD / © Simon Fowler). Rüdiger Winter