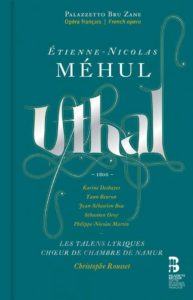.
Étienne-Nicolas Méhuls mehr oder weniger einziger Ruhm in unserer Zeit ruht fast ausschließlich auf seinem Joseph, dem einzigen unter seinen 35 dramatischen Werken, dessen Aufführungen sich seit seiner Premiere 1807 bis heute finden, und vielleicht noch auf der prachtvollen Ouvertüre zu La Chasse du jeune Henri (von vielen berühmten Dirigenten aufgenommen).
.

Étienne-Nicolas Méhul, Gemälde von Antoine-Jean Gros/Wiki
Das Ausmaß einer solchen Vernachlässigung ist jedoch nichts Neues, wie sie schon Berlioz 1852 beklagte. 1763 in Givet in den Ardennen geboren und in Paris zur Vervollständigung seiner Studien ausgebildet, hatte Méhul das große Glück, Gluck vorgestellt zu werden. Der erkannte sein Talent und riet ihm, sich der Oper zuzuwenden. 1797 erzielte Méhul einen brillanten Erfolg an der Opéra-Comique mit Euphrosine. Während er zur selben Zeit das Seine zu den prunkvollen Revolutions-Feierlichkeiten beitrug (dessen typischer Stil sich in den Morceau d´ensemble no. 4 in Uthal findet: „Abreuvez-vous du sang des traîtres“), komponierte er mit wechselndem Erfolg weiter für die Comique. Zudem war er auch eines der Gründungsmitglieder des Conservatoire de Paris. Seine Karriere, die während der Zeit Napoleons unbeschadet weiter gelaufen war, erreichte ihren Höhepunkt 1805 mit Joseph, bis die Errungenschaften Spontinis und eine fortschreitende Tuberkulose Méhuls Energien erschöpft hatten. Sein Tod 1817 fiel mit der ersten Vorstellung von Rossinis Italiana in Algeri zusammen – der Beginn einer Revolution du gout, die sich tödlich auf eben die Ästhetik auswirkte, die Méhul so sehr verfochten hatte.
.
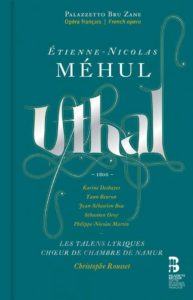 Und heute? Ein paar Wiederbelebungen ohne große Wirkung (darunter der Horatius aus den Radio-Sechzigern, verschiedene Josephs und Iratos), die Einspielungen seiner Klaviersonaten, seiner vier Sinfonien und einiger Opern (darunter L´irato, Stratonice und Adrien, s. jpc oder Amazon) erlauben es uns glücklicherweise, die Einschätzung seines Genies zu erweitern. Aus Paris gibt es vom 30. Mai 2015 – nach einem verdienstvollen ersten Anlauf der BBC 1972 (Sarti, Wakefield/ Robinson auf UORC-LP) – Méhuls Opéra comique in einem Akt, Uthal, von 1806, konzertant unter Christophe Rousset mit einer illustren Besetzung durch Karine Deshayes, Yann Beurron (in der Titelrolle), Jean-Sébastien Bou, Sébastien Droy, den Talens Lyriques und dem Kammerchor aus Namur – dies alles wieder einmal im Zuge der Bemühungen des hier vielfach gelobten und erwähnten Palazetto Bru Zane in der prachtvollen Opéra Royale de Versailles, am Radio bei Radio France und natürlich nun auf einer CD bei Ediciones Singulares im unpraktischen, aber eleganten Buchformat mit vielen Aufsätzen in Französisch und Englisch sowie dem zweisprachigen Libretto – Qualität wie meist.. Gesungen wird, wie oft bei Rousset und dem Palazetto, ebenfalls hervorragend: Karine Deshayes, Yves Beurron, Jean-Sebastien Bou, Sebastien Droy und andere machen dem französischen Gesang der mittleren Größe Ehre; dazu kommt Christophe Rousset mit seinen Mannen ganz wunderbar. Alles in allem eine Ossian-Story zum Füße Wippen.
Und heute? Ein paar Wiederbelebungen ohne große Wirkung (darunter der Horatius aus den Radio-Sechzigern, verschiedene Josephs und Iratos), die Einspielungen seiner Klaviersonaten, seiner vier Sinfonien und einiger Opern (darunter L´irato, Stratonice und Adrien, s. jpc oder Amazon) erlauben es uns glücklicherweise, die Einschätzung seines Genies zu erweitern. Aus Paris gibt es vom 30. Mai 2015 – nach einem verdienstvollen ersten Anlauf der BBC 1972 (Sarti, Wakefield/ Robinson auf UORC-LP) – Méhuls Opéra comique in einem Akt, Uthal, von 1806, konzertant unter Christophe Rousset mit einer illustren Besetzung durch Karine Deshayes, Yann Beurron (in der Titelrolle), Jean-Sébastien Bou, Sébastien Droy, den Talens Lyriques und dem Kammerchor aus Namur – dies alles wieder einmal im Zuge der Bemühungen des hier vielfach gelobten und erwähnten Palazetto Bru Zane in der prachtvollen Opéra Royale de Versailles, am Radio bei Radio France und natürlich nun auf einer CD bei Ediciones Singulares im unpraktischen, aber eleganten Buchformat mit vielen Aufsätzen in Französisch und Englisch sowie dem zweisprachigen Libretto – Qualität wie meist.. Gesungen wird, wie oft bei Rousset und dem Palazetto, ebenfalls hervorragend: Karine Deshayes, Yves Beurron, Jean-Sebastien Bou, Sebastien Droy und andere machen dem französischen Gesang der mittleren Größe Ehre; dazu kommt Christophe Rousset mit seinen Mannen ganz wunderbar. Alles in allem eine Ossian-Story zum Füße Wippen.
.

Méhul: Christophe Rousset leitet die Wiederbelebung des „Uthal“ in Versailles/Spectacles de Versailles/Ceric La Rayadieu/chateauversailles-spectacles.fr
Kommentare zur Oper Uthal sind knapp, weil kaum jemand sie bislang gehört hat. 1925 schrieb der Musikwissenschaftler Lionel de la Laurencie: „Am 17. Mai 1806 gab es an der Opéra-Comique eine merkwürdige Oper, Méhuls Uthal, auf ein von Ossian inspiriertes Libretto, die besonders romantisch wegen ihrer Orchesterfarben wirkte. Die Geigen wurden durch Violas ersetzt.“ Und er hatte recht, darauf hinzuweisen, dass sich einige Opern der Napoleonischen Periode durch besondere Originalität auszeichnen und nicht wie oft angenommen nur durch überflüssigen Pomp. Als Reaktion auf den Erfolg von Les Bardes, eine Oper von Lesueur 1804 an der Académie Impériale de Musique, beauftragte die Opéra-Comique Méhul, ein kurzes, beeindruckendes Werk zu schreiben, das von den Ossianischen Gesängen des James Macpherson inspiriert sein sollte (s. Wikipedia), die kurz zuvor ihren Weg nach Frankreich gefunden hatten (und die Goethe bereits 1774 zu seinem Werther angeregten).
.

Méhul: Die Wirkung der Gesänge Ossians – Illustration zu Goethes „Werter“ von Nicolai Abraham Abildgaard/ Staatsbibliothek Berlin
Der Komponist hatte die brillante – und wagemutige – Idee, die Nebel durchzogene Landschaft Schottlands (so, wie er sie sich vorstellte) von einem Orchester ohne Violinen evozieren zu lassen. Die „Gotische“ Farbe der Holzinstrumente und die poetische Melancholie einer Harfe, die ab und zu aus dem Ensemble herauszuhören ist, kontrastieren auffällig mit den martialischen Chören und den kriegslustigen Charakteren Larmors und Uthals. Bereits in der Ouvertüre überrascht Méhul mit dem Kunstgriff, Malvina in der Kulisse verzweifelt nach ihrem Vater rufen zu lassen. Der Chor selbst besteht aus dreigeteilten Männerstimmen. Die Hymne au soleil ist ein ausgesprochen romantisches Stück und wird von den Barden gesungen – einer der besten Einfälle unter Méhuls Kompositionen . Die Studenten des Pariser Conservatoires (unter dessen Gründern Méhul selbst gewesen war), sangen dieses Hymne an die Sonne bei seinem Begräbnis 1817.
.
.

„Ossian“ von Francois-Pascal Simon Gérard/OBA
Im Folgenden bringen wir zur Ergänzung einen Text des eminenten französischen Musikwissenschaftlers und Musikkritikers Gérard Condé zum Uthal von Méhul (…) Einige Wiederaufnahmen ohne große Bedeutung, die Einspielung seiner Klaviersonaten, seiner vier Sinfonien und einiger Opern (darunter L’irato, Stratonice und zuletzt Adrien) haben es glücklicherweise ermöglicht, den Blick auf sein Genie zu erweitern. In den Köpfen der wenigen, die sich seiner Existenz bewusst sind, ruft Uthal jedoch immer noch nur den harschen Ausruf von Grétry am Ende der Uraufführung am 17. Mai 1806 hervor: „Ich würde einen Louis geben, um eine E-Saite zu hören“. Diese ironische Bemerkung rührt von Méhuls Entscheidung her, die Geiger zu bitten, ihre Instrumente gegen Bratschen zu tauschen, um dem Orchester einen verschleierten und melancholischen Klang zu verleihen, der mit der Atmosphäre der ossianischen Welt übereinstimmt. Dies wird besonders in der Ouvertüre deutlich, wo die Holzbläser, die die Rolle der Violinen übernehmen, mit einer intensiven Schneide über den rastlos wogenden Wellen der tiefen Streicher ausbrechen, wie sie es auch im Morceau d’ensemble („Nous le jurons, ce jour qui nous éclaire“) wieder tun werden. Dies ist auch in der Romance d’Uthal (Nr. 5, „Pour prix d’un bien si pleine de charme“) und im Chant des bardes („Près de Balva“) zu beobachten, wo die Bratschenstimmen, die auf den unteren Teil ihres mittleren Registers beschränkt sind, die ständige Bewegung der Harfe überdecken. In seinen Soir
Gretrys Witz war zwar treffend, ging aber im Vergleich zu den Argumenten, die Cherubini (in einem von Arthur Pougin notierten Artikel) vorbrachte, um die geringe Sympathie zu rechtfertigen, die Uthal bei ihm weckte, nicht weiter: Diejenigen, die auf den Ruf und die Erfolge von Méhul eifersüchtig waren, warfen ihm lange Zeit vor, er habe sich nicht genug mit seinen kompositorischen Studien beschäftigt. Méhul hatte die Schwäche, auf diese Vorwürfe empfindlich zu reagieren, und etwa seit der Zeit, in der er Joanna [1802] komponiert hatte, hielt er es für notwendig, zu beweisen, dass er solche Studien durchgeführt hatte, indem er in seine Kompositionen vorschnell Formen einführte, die sowohl zu scholastisch als auch zu pedantisch für die Oper waren, und mit denen er die nachfolgenden Stücke zu überfrachten pflegte. Diese prätentiöse und schädliche Methode hat er seither in allen Opern, die er komponiert hat, egal ob es sich um ernste oder komische handelt, beibehalten. Cherubini hatte die – etwas zu sehr ausgeprägte – Tendenz zur Nachahmung im Sinn, wie sie in Malvinas Arioso „Pour soulager tes maux“ zu beobachten ist. Dabei ließ sich Méhul vom stilistischen religiösen Archaismus inspirieren, um die Frömmigkeit der Figur zu unterstreichen.

Méhul: „Ossian“ – Gemälde von Jean-Auguste Dominic Ingres/OBA
Das umstrittene oder in Vergessenheit geratene Uthal hat dennoch seine Anhänger gefunden. Im Jahr 1904 führte das Dessauer Opernhaus eine Aufführung durch, die laut „Le Monde artiste“ ein großer Erfolg war. Im Jahr 1908 enthielt die Beilage der Revue musicale nicht weniger als 150 Seiten eines Klavierauszugs des Werks. Man kann jedoch auf das Jahr 1856 zurückgehen, als Castil-Blaze in seiner Histoire de l’opéra einen der denkwürdigsten Abschnitte hervorhob: Die Hymne au sommeil, in der vier Barden singen, die nur von zwei Harfen, zwei Flöten und zwei Hörnern begleitet werden, ist sehr schön; ihr melodiöses Ensemble wird durch die harmonische Gestaltung und die Merkwürdigkeit einer Folge gemeinsamer Akkorde, die geschickt miteinander verbunden sind, angenehm variiert. Wie in Les musiciens célèbres von François Desplantes nachzulesen ist, versammelten sich einige Zeit nach Méhuls Tod Gesangsstudenten des Conservatoire um sein Grab auf dem Friedhof Père Lachaise, um dieses Stück aufzuführen; der einzige Abschnitt aus dem Gesamtwerk, der sich am längsten gegen diese Vernachlässigung wehrte. Die auffällige Kombination von Hörnern, Flöten und Harfe, die die fließende Vokalpolyphonie mit dezenten Chromatisierungen untermauert, vermeidet akademische Vorbilder völlig, während die Klagen von Malvina, die in der zweiten Strophe an die Spitze gestellt werden, den natürlichen Eindruck, der dieses Stück so reizvoll macht, nicht beeinträchtigen.
.

Méhul: Malvina beweint den Tod Oscars, Gemälde von Elizabeth Harvey/Grand Palais de Paris
Trotz seiner offensichtlichen musikalischen Schönheiten gelang es Uthal nicht, über seine ersten 15 Aufführungen hinaus im Repertoire zu bleiben. Arthur Pougin vermutete Méhuls „großen Fehler, dass er sich nicht ausreichend um das inhärente oder dramatische Potenzial der Gedichte kümmerte, die ihm angeboten wurden und die er zu leicht akzeptierte“. Das Thema bezieht sich auf den Guerre d’Inistona [Krieg von Inis-thona], in dem Ossian die Autorität Oskars feiert, indem er den alten Anio, der von seinem Verwandten Cormalo vom Thron vertrieben worden war, wieder auf den Thron bringt. Jacques Bins de Saint-Victor hat sein Libretto mit einigen Episoden aus anderen Kompositionen von James Macpherson (1736-1796) ausgeschmückt.
Die gälischen Gedichte, die dieser dem legendären Barden Ossian aus dem dritten Jahrhundert zuschreibt, dessen Veröffentlichung 1760/63 eine ganze Generation begeisterte, wurden zu einem beliebten Lesestoff für Napoléon Bonaparte. Saint-Victor widmete sein Gedicht Girodet, der für einen Mort de Malvina verantwortlich zeichnete: Die Leute sind jedoch nicht auf den Betrug des Autors hereingefallen, der aus fast dem gesamten Stück eine schottische Mythologie konstruiert hat. Außerdem wies der Chronist des Journal de l’Empire vom 21. Mai 1806 mit charmantem Schalk darauf hin, dass es sich bei der Handlung um eine Umgestaltung von Plutarchs Leben von Agis und Kleomenes handelt, wo Kleombrotus (Uthal), der Ehemann von Chelonis (Malvina), den Thron seines Schwiegervaters Leonidas (Larmor) besteigt. „Vielleicht wollte der Autor von Uthal eine Art flüchtige Mode ausnutzen, die die schottischen Barden in Paris genossen:

Méhul: Der Autor des Fake-„Ossian“ – James Macpherson, Gemälde von George Romney/Wiki
Er dachte vielleicht, dass Ossian mehr à la mode wäre als Plutarch, und ich denke, dass er nicht weit daneben lag. Das Thema wäre allerlei Glanz und Ansehen beraubt worden, wenn M. de Saint-Victor es nach griechischen Gepflogenheiten behandelt hätte. Es gab eine Zeit, in der die Lakedämonier für einen besseren Ton gesorgt hätten als die Barden […] Ich habe eher das Gefühl, dass die Leiern der lakedämonischen Musiker sich als harmonischer erwiesen hätten als die so genannten goldenen Harfen dieser vergangenen schottischen Priester, die zu einer Zeit und in einem Land lebten, in dem es nicht viel Gold zu sehen gab und in dem man überhaupt keine Musik kannte.“ Auch die Gazette de France vom 19. Mai 1806 zeigte sich streng mit Saint-Victors Libretto, das in seiner Gestaltung nichts Neues und nichts wirklich Interessantes bietet. Die einzelnen Szenen sind unzureichend miteinander verbunden. Der Autor begreift auch nicht, welchen Weg er einschlagen will.
.

Méhul: James Macphersons Fake-„Ossian“/OBA
Es ist bekannt, dass die ossianischen Helden – wie ihre homerischen Vorbilder – oft zu Fuß unterwegs waren, weder mit Gefolge noch mit Prunk. Die Schönheiten aus Morven und Erin machen es sogar noch besser; sie greifen gelegentlich im Kampf zur Lanze und trotzen dem Tod an der Seite ihrer Liebsten. Doch in unserem Theater erwecken all dieses Herumgehetze und die nächtlichen Monologe nicht dieselbe Illusion; uns erscheint es sehr eigenartig, dass der wilde Uthal ganz allein auf der Jagd nach seiner Frau steht und ein ganzes feindliches Heer herausfordert. Der Inhalt des Themas hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem von König Lear: Malvinas großmütige Art, zu erklären, dass sie die Unglücklichste ist, ist schon tausendmal verwendet worden; im Übrigen aber sind die Charaktere recht gut definiert, das Lokalkolorit wird erfolgreich beibehalten. Oft sind die Verse gelungene Nachahmungen des schottischen Barden; die Stille des Abends, das Murmeln der Gebirgsbäche, die Sturmwinde, die Wolkenpaläste, die Gespenster der Helden kehren immer wieder dorthin zurück; mit beiden Händen streut der Autor die Wildblumen der ossianischen Zunge aus, und das alles erzeugt eine recht merkwürdige Wirkung im Land der Opéra Commique.
.
Was die Musik betrifft, so hat sich die Meinung des Kritikers völlig geändert: Der Komponist hat das Thema viel besser erfasst: Seine Musik wird an der Stelle des trône de la fête merklich erregt. Seine Ouvertüre, von breitem Stil und dunklem Kolorit, kündet gekonnt von den nächtlichen Gespenstern und den Sturmwinden. Das Duett zwischen Larmor und Malvina ist äußerst süß und zärtlich eingefangen. Die Ankunft von Morvens streitlustigen Kindern [Nr. 2, „Le grand Fingal, pour punir les rebelles“] ist ein originelles Stück; der Klang der Harfen, vermischt mit den fernen Worten der Barden, erzeugt einen herrlich weltfremden Effekt. Die Ankunft der Barden aus Ossian ist schon oft gepriesen worden; ich bezweifle, dass dies auf eine bezauberndere Weise geschehen kann als hier.
Der Verweis auf Jean-François Le Sueurs Oper Ossian oder Les Bardes (nach dem Gedicht von Calthon und Colmal), die am 10. Juli 1804 an der Opéra uraufgeführt wurde, war unvermeidlich; ebenso vorausschauend warf das Ausmaß ihres Erfolgs einen Schatten auf Méhuls kleines Werk. Unter diesem Gesichtspunkt sind die einleitenden Bemerkungen im Journal du soir, de politique et de littérature des frères Chaigneau vom 18. Mai 1806 zu verstehen: Gestern hat die Uraufführung der einaktigen Oper Uthal, die die Gedichte nach dem Vorbild der Ossian-Gedichte nachahmt, im Théâtre Feydeau einen vollen Erfolg erzielt. Dieses Werk hätte auch an der Académie Impériale de Musique Erfolg gehabt, wo es weder besser aufgeführt noch sorgfältiger inszeniert worden wäre. Der Stil ist großartiger und gehobener, als man es von den Opern des Théâtre Feydeau gewohnt ist; aber was diese Oper noch interessanter macht, ist die Tatsache, dass ihre Musik von dem berühmten Méhul stammt.
.

Méhul: Und noch einmal die folgenschwere Ausgabe des „Ossian“/ibrary.loyno._.edu
Das Journal général de France vom 19. Mai 1806 geht sogar noch weiter und präzisiert: „Es handelt sich keineswegs um eine Opéra comique, sondern um eine Tragödie im wahrsten Sinne des Wortes. Das Stück ist fast gänzlich in alexandrinischen Versen geschrieben und mit der ganzen Feierlichkeit des tragischen Stils geschmückt. Die ausgedrückten Gefühle, die Figuren und die Situationen entsprechen den Anforderungen dieses Stils. Dieses neue Stück hat die Schauspieler gezwungen, den Tonfall, den Akzent, die Gestik und die ganze der französischen Bühne angemessene Formalität zu erfassen, und für einen ersten Versuch muss man sagen, dass sie sich sehr erfolgreich verhalten haben. Bei mehreren Gelegenheiten wurde die Abschaffung des Rezitativs in der Oper und das Sprechen desselben vorgeschlagen. Hier gab es wirklich eine große Oper mit einem gesprochenen Rezitativ, und das Publikum schien damit zufrieden zu sein“. Der Chronist scheint vergessen zu haben, dass es an alexandrinischen Dialogen auf den französischen Opernbühnen von Méhuls Euphrosine bis zu Cherubinis Médée keinen Mangel gab.Die Gazette de France vom 19. Mai 1806 griff dieses Thema auf und nutzte die Gelegenheit, um die Interpreten zu würdigen: Der Übergang von der Übertragung von Prosa zum Gesang hat immer etwas Merkwürdiges und Unstimmiges; aber die Verbindung von Poesie und Musik ist wirklich trügerisch; viele Schauspieler wären besser, wenn sie dieses Genre unterstützen würden: zum Beispiel Madame Scio, die, ausgestattet mit einer tiefen Intelligenz und Sensibilität, fast so gut rezitiert wie sie singt. Sie hätte es verdient, am Ende des Werks zusammen mit den Autoren zurückgerufen zu werden. Gavaudan ist in diesem Genre, in dem er seine Ambitionen begrenzen sollte, bereits hinreichend bekannt. Möge es ihm eine Freude sein, uns an der Opéra-Comique zum Weinen zu bringen. Andernorts könnten sowohl er als auch das Publikum verloren gehen: Er ist in der Rolle des Uthal so grimmig wie Madame Scio in der der Malvina rührend ist. Solie hat die Rolle des Larmor übernommen; seine Stimme ist zwar im Niedergang begriffen, hat aber immer noch etwas Ehrwürdiges und Väterliches an sich. Baptiste, dem die Rolle des ersten Barden anvertraut wurde, hat ihren Chant Consolateur perfekt vorgetragen. Er ließ die Unwahrscheinlichkeit der Szene vergessen, und dieses Lob sollte für ihn ausreichen.

Méhul: Der Naturkult in der Folge des „Ossian“/Stich von Mallet/OBA
Wenn man sich diese Berichte zwei Jahrhunderte später ansieht, ist es interessant zu sehen, wie diese provokativen Bemerkungen immer noch ihren Sinn erfüllen; so fällt der Chant des bardes, der nahe am Schluss der Oper steht (für dessen emotionale Haltung er den Weg ebnet), weniger durch seine Unwahrscheinlichkeit als durch die Expressivität der Baritonstimme auf, die sich um das tonale Zentrum in seinem oberen Register und durch seine schroffe Unterbrechung entwickelt. Castil-Blaze informiert uns, dass „das Thema dieser Romanze oder Ballade aus der rührenden Episode von D’Ailly stammt, die in La Henriade mit dieser Zeile endet: ‚Il le voit, il l’embrasse, hélas! C’était son fils‘„. Voltaire zu Gast bei Ossian, in der Tat; das gibt zu denken…
.

Méhul: Der Autor, Komponist und Musikwissenschaftler Gérard Condé/paris.mg
Unser Verhältnis zur aufkommenden Romantik mit ihren Trends, Wurzeln und Moden hat sich verändert. Bei der Entdeckung von Uthal suchen wir nicht mehr nach der Neuheit, die die Zeitgenossen mit Recht erwarten durften, sondern nach jenem Gefühl der Verbesserung, das uns ein retrospektiver Ansatz bieten kann, denn Werke aus der Vergangenheit können uns interessieren, wenn sie sich ausreichend in ihre eigene Zeit einschreiben, um uns dorthin zurückversetzen zu können, und gleichzeitig reich genug an Substanz sind, um sich mit unserer Zeit zu befassen und ein Licht auf sie zu werfen. Auf diese Weise können wir eine gültige Verbindung zu dem herstellen, was unsere Vorgänger vielleicht aus Gründen abgelehnt haben. Man kann die Geschichte nicht ändern; es ist die Geschichte, die uns auffordert, sie neu zu schreiben. Gerard Condé/ Übersetzt mit DeepL
.
.
Den Text entnahmen wir dem Booklet zur Einspielung beim Palazetto Bru Zane mit Dank; Bild oben: Ossian Receiving the Ghosts of Fallen French Heroes, 1805; Ölgemälde von Anne Louis Girodet-Trioson/Wikipedia.
.
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.