Wer des Russischen nicht sehr gut mächtig ist, hat es schwer, Zugang zu den Musikdramen von Nikolai Rimsky-Korsakov zu finden. Die Barrieren sind hoch, zweisprachige Libretti höchst selten. Es gibt zwar Richtlinien für die Umschrift. Sie werden aber nicht immer konsequent angewendet und landen oft bei der Übernahme der englischen Schreibweise. In der DDR, wo Russisch in der Schule ein Pflichtfach war, galten andere Regeln als im Westen. Unterschiede in der Transliteration wirken auch dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung fort. Die neuen Edition bei Profil Günter Hänssler mit sämtlichen Opern und Fragmenten offenbart diese Schwierigkeiten (PH19010). Als salomonische Löschung wurde deshalb weitgehend Englisch für das Booklet gewählt, eine Praxis, die sich allgemein eingebürgert hat. Alle Titel, Personenzuordnungen und kurzen Szenenbeschreibungen für die vielen Tracks wurden entsprechend übersetzt. Alternativ gibt es Inhaltangaben nach Art eines Opernführer und Erklärungen zu den einzelnen Titeln von Lothar Brandt auch in Deutsch. Der Textbeginn der einzelnen Szenen wurde phonetisch erfasst, so dass man beim Hören nicht ganz die Orientierung verliert. Für Rimsky-Korsakov ist das natürlich nicht genug. Da hätte man sich mehr gewünscht, zum Beispiel deutsch-englische Libretti online. Das machen ja auch andere Firmen wie Naxos oder Bongiovanni.
 Nach wie vor hilfreich in seiner Ausführlichkeit ist das Handbuch der russischen und sowjetischen Oper von Sigrid Neef, das 1985 im Henschelverlag der DDR erschien und antiquarisch noch zu haben ist. Obwohl der 1844 geborene und 1908 gestorbene Komponist auch mit neuen Produktionen auf aktuellen Musikmarkt stark vertreten ist, rückt die umfangreiche historische Sammlung die einzelnen Werke in die Nähe der Quellen und der ursprünglichen Intentionen. Sie umfasst Aufnahmen, die ausnahmslos unter sowjetischen und demnach unter sozialistischen Bedingungen entstanden sind. Sie wurden zwischen 1927 und 1963 produziert und waren vornehmlich für das inländische Publikum bestimmt. In diesen Jahren hatten Stalin und Chruschtschow das Sagen. Das Land war streng abgeschottet. Gemeinsam mit seinem Kollegen Alexander Borodin, Mili Balakirew, César Cui und Modest Mussorgski gehörte Rimsky-Korsakov zur so genannten Gruppe der Fünf – auch als „Das mächtige Häuflein“ bekannt. Sie hatten sich 1862 in Sankt Petersburg zusammengetan und wollten die nationalrussische Musik in der Nachfolge von Michail Glinka fördern. Im Gegensatz etwa zu Tschaikowski strebten sie keine Orientierung an westliche Vorbilder an. Diese doppelte Abschottung – die geopolitische und die künstlerische – wirkt auch in den Einspielungen als unverwechselbares Klangbild fort. Sie sind durch und durch historisch. Ich fühle mich an alte Ikonen erinnert, die geheimnisvoll glänzen wie ganz altes Gold. Modernen Lesarten wie sie in westlichen Ländern und nun auch in Russland gepflegt werden, ist davon nicht mehr viel anzuhören. Rimsky-Korsakov ist also dort angekommen, wo er eigentlich nicht hin wollte.
Nach wie vor hilfreich in seiner Ausführlichkeit ist das Handbuch der russischen und sowjetischen Oper von Sigrid Neef, das 1985 im Henschelverlag der DDR erschien und antiquarisch noch zu haben ist. Obwohl der 1844 geborene und 1908 gestorbene Komponist auch mit neuen Produktionen auf aktuellen Musikmarkt stark vertreten ist, rückt die umfangreiche historische Sammlung die einzelnen Werke in die Nähe der Quellen und der ursprünglichen Intentionen. Sie umfasst Aufnahmen, die ausnahmslos unter sowjetischen und demnach unter sozialistischen Bedingungen entstanden sind. Sie wurden zwischen 1927 und 1963 produziert und waren vornehmlich für das inländische Publikum bestimmt. In diesen Jahren hatten Stalin und Chruschtschow das Sagen. Das Land war streng abgeschottet. Gemeinsam mit seinem Kollegen Alexander Borodin, Mili Balakirew, César Cui und Modest Mussorgski gehörte Rimsky-Korsakov zur so genannten Gruppe der Fünf – auch als „Das mächtige Häuflein“ bekannt. Sie hatten sich 1862 in Sankt Petersburg zusammengetan und wollten die nationalrussische Musik in der Nachfolge von Michail Glinka fördern. Im Gegensatz etwa zu Tschaikowski strebten sie keine Orientierung an westliche Vorbilder an. Diese doppelte Abschottung – die geopolitische und die künstlerische – wirkt auch in den Einspielungen als unverwechselbares Klangbild fort. Sie sind durch und durch historisch. Ich fühle mich an alte Ikonen erinnert, die geheimnisvoll glänzen wie ganz altes Gold. Modernen Lesarten wie sie in westlichen Ländern und nun auch in Russland gepflegt werden, ist davon nicht mehr viel anzuhören. Rimsky-Korsakov ist also dort angekommen, wo er eigentlich nicht hin wollte.

Ein typisches russisches Bühnenbild: Der bunt und üppig ausgestattete Palast in der Zarenbraut von Ivan Bilibin. Foto: Wikipedia
Der Zeitraum, dem die Aufnahmen entstammen, ist auf dem Cover der Box mit 1927 bis 1963 sehr großzügig angegeben. Aus dem erstgenannten Jahr stammen nämlich lediglich zwei Szenen mit Fedor Chaljapin aus Sadko sowie Mozart und Salieri. Sie sind als Bonus ausgewiesen und wurden zudem auch noch in London mitgeschnitten. Hingegen geht die älteste Operngesamtaufnahme der Edition auf das Jahr 1946 zurück. Unter den Tisch gefallen sind also fast zwei Jahrzehnte. Wer die Box im guten Glauben erwirbt, auch die Bekanntschaft mit Dokumenten aus den dreißiger Jahren zu machen, wird enttäuscht sein. Sie finden sich nicht. Ein Jahr nach Kriegsende also wurde die auf einer Erzählung von Gogol beruhende Mainacht (May Night) mit Chor und Orchester des Rundfunks der UdSSR unter der Leitung von Nikolai Golovanov eingespielt. Mit Elisaveta Shumskaya (Sopran) und Maria Maksakova (Mezzo) drücken zwei Stars des Bolschoi-Theaters der Aufnahme ihren Stempel auf. Ganz am Beginn ihrer überaus erfolgreichen Karriere, die sie bis nach New York führte, steht Zara Dolukhanova, die als eine von drei Rusalken einen episodischen Auftritt im letzten Akt hat. 1946 wurde auch mit der Produktion von Sadko begonnen, die erst 1947 zum Abschluss kam. Diesmal leitet Vasily Nebolsin das Bolschoi-Orchester. Wie immer bei dieser Oper lohnt es sich, auf das Erscheinen des Waräger Kaufmanns zu warten. Der stimmgewaltige Mark Reizen lässt kleinen Zweifel daran, dass Sadko (Nikandr Khanayev) die beste Wahl träfe, würde er ihm mit seiner Flotte in nordische Gefilde folgen. In der andere berühmte Szene, dem Lied des indischen Gastet, braucht es etwas Mühe, um sich an das betont nasale Timbre von Pavel Chekin zu gewöhnen, einem Tenor wie er typischer nicht sein kann für diese Stimmlage in der Sowjetunion zu damaliger Zeit.

Veronika Borisenko war in der Sowjetunion ein Opernstar. Sie singt die Frühlingsfee in Schneeflöckchen. Foto: Wikipedia
1947 ist ein ergiebiges Produktionsjahr. Es folgen Einspielungen von Die Bojarin Wera Scheloga (The Noblewoman Vera Sheloga), gedacht als musikalisch-dramaturgischer Prolog zur Oper Das Mädchen von Pskow (The Maid of Pskov). Nach eigenem Bekunden legte Rimsky-Korsakov diesen Prolog so an, dass er auch als selbständiger Einakter aufgeführt werden kann. So wurde er 1898 auch uraufgeführt. Erst eine Inszenierung 1901 am Bolschoi-Theater stelle das fünfzigminütige Werk dem Mädchen von Pskow voran. Wera (Sofia Panova) erzählt darin ihrer jüngeren Schwester Nadeshda (Elena Gribova), dass sie dem Bojaren gegen ihren Willen angetraut wurde. Der kämpft derweil gemeinsam mit dem Mann der Schwester im Livländischen Krieg für Zar Iwan IV. In der seit langem währenden Abwesenheit trat sie selbst auf den noch jungen Zaren, von dem sie das Olga genannte Kind empfing. Von ihren heimkehrenden Männern plötzlich überrascht, gibt Nadeshda die kleine Olga als ihr Kind aus, um es vor der Rache des Bojaren angesichts der Untreue seiner Gemahlin zu retten. Solcher Art sind Geschichten bei Rimsky-Korsakov. Oft schieben sich – Kulissen gleich – märchenhafte und mythische Elemente vor historische Hintergründe. Die Ausführung ist wortreich, die eigentliche Handlungsdramaturgie nicht immer der Übersichtlichkeit verpflichtet. Seine Musikdramen verlangen Zuhören einiges ab. Nicht selten muss nachgeblättert werden, um genau im Bilde zu sein, wer nun eigentlich gerade um die Ecke biegt. Im Werkverzeichnis des Komponisten belegt Die Nacht vor Weihnachten (Christmas Eve) einen der vordersten Plätze. Wie für etliche seiner Opern verfasste Rimsky-Korsakov das Libretto selbst. Er bezeichnet dieses Werk nach einer Erzählung von Nikolai Gogol als „eine wahre Geschichte“. Des Stoffes hat sich auch Tschaikowski für seine Pantöffelchen bedient. In der turbulenten Handlung spielt der Teufel eine nicht unwichtige Rolle. Vergeblich versucht er, den gottesfürchtigen Schmied Vakula (Dmitri Tarkhov) mit einem Schneesturm herauszufordern. Der lässt sich nicht beeindrucken, weil er andere Sorgen hat. Er ist in die kokette Oksana (Natalya Shpiller, die auch im Westen sehr bekannt wurde) verliebt. Die will in seine Werbungen aber nur dann einwilligen, wenn er ihr ein paar Schuhe der Zarin bringt. Weil er keine Macht über Vakula gewinnen konnte, muss der Teufel gezwungenermaßen dabei behilflich sein, diese Pantoffeln zu beschaffen.
Die Zarenbraut (The Tsar´s Bride) fand mit einem relativ modernen Mitschnitt vom 20. Juni 1958 aus dem Bolschoi-Theater Eingang in die Edition. Bühnengeräusche und die deutlich vernehmbare Stimme eines Souffleurs verleihen der packenden Produktion hohe Authentizität. Während am Pult der mit dreißig Jahren aufstrebende Yevgeny Svetlanov steht, agiert auf der Bühne mit der Shumskaya als schöne Kaufmannstochter Marfa, die sich Zar Iwan IV. (der Schreckliche) zur Braut erwählt, obwohl sie anderweitig gebunden und versprochen ist, eine gestandene Kraft. Der Klang ist transparent und frisch. Zwei Jahre früher, nämlich 1956, wurde im Mariinsky-Theater Leningrad Das Märchen vom Zaren Saltan (Tale of Tsar Saltan) mitgeschnitten. Die literarische Vorlage stammt von Alexander Puschkin. Sein gleichnamiges Märchen ist in Versform geschrieben und beginnt genauso wie der Prolog der Oper, in dem drei Schwestern – ein beliebter Topos in der russischen Literatur – zusammensitzen und von einem Zaren träumen, der sie freien möge. Als Saltan tritt mit dem Bassisten Lavrenty Yaroshenko ein zeitgenössischer Star des Mariinsky in Erscheinung.

Rimsky-Korsakov griff mehrfach auf literarische Vorlagen von Alexander Puschkin – hier auf einem Gemälde von Orest Kiprensk – zurück. Foto: Wikipedia
Für Mlada, die magische Ballettoper, ist 1962 als Produktionsjahr genannt. Diesmal leitet Svetlanov Chor und Orchester des sowjetischen Rundfunks. Es handelt sich um die erste Studioproduktion des Werkes, die sich Sammler seinerzeit aus der Sowjetunion zu besorgen wussten. Vier Platten stecken in den berüchtigten Pappkartons, die streng nach Knochenleim rochen. Wer solche Platte je in Händen hielt, wurde diese derbe Duftnote nie wieder los. Die Handlung lässt nichts aus. Sie erstreckt sich über einen langen Zeitraum längs der baltischen Küste. Die Liste der Mitwirkenden ist endlos. Sogar Kleopatra wird pantomimisch bemüht. Und die titelgebende Königin Mlada geistert nur als ihr eigener Schatten umher. Nicht immer ist die Zahl der Mitwirkenden so überschaubar wie in Mozart und Salieri (Konstantin Ognevoj und Boris Gmyrja), 1963 hörbar als Livemitschnitt aus dem einstigen Leningrad unter der musikalischen Obhut von Eduard Grikorov in die Sammlung übernommen. Der Einakter erweckte besonderes Interesse auch über Russland hinaus, was wohl auch an den Figuren und der abenteuerlichen Story liegt, die auf eine Tragödie von Puschkin zurückgeht, die dieser nach spekulativen Zeitungsmeldungen verfasste. Am Schluss wird Mozart, die Noten seines unvollendeten Requiems vor sich, in einem Gasthof von Salieri vergiftet. Es gibt Fassungen in Englisch, Französisch und Ungarisch und auch eine Aufnahme in deutscher Sprache mit Peter Schreier und Theo Adam, die zuerst in der DDR bei Eterna herauskam.

In Stein gemeißelt ist der Tenor Georgi Nelepp auf seinem Grab in Moskau. Er singt den Valery in der Oper Servilla. Foto: Wikipedia
Nur eine Studioproduktion ist von Pan Wojewode (Pan Wojewoda) überliefert. In der Edition gelangt sie erstmals auf CD. Entstanden ist die Aufnahme 1951 in Moskau unter der Leitung von Samuil Samosud. Der 1884 geborene und 1964 gestorbene Dirigent war eine der prägenden Gestalten des Musiklebens in der Sowjetunion unmittelbar nach der Oktoberrevolution. Ursprünglich Cellist, wirkte er als Dirigent, Orchestergründer und Theaterleiter in Leningrad und Moskau. Er besorgte die Uraufführungen von Schostakowitschs Leningrader Sinfonie und seiner Opern Die Nase und Lady Macbeth von Mzensk. Seine Autorität reichte aber nicht aus, um dieses Werk in die Zukunft zu retten. Musikalisch ist es von hohem Niveau. Unter den Händen von Samosud entfaltet sich üppige spätromantische Pracht. Zu Recht spricht Booklet-Autor Brandt, von einem „wenig zusammenhängenden, melodramatischen Plot“. Dabei war die Oper für den Komponisten eine Herzensangelegenheit. Rimsky-Korsakov kam damit auf Kindheitserinnerungen zurück. Seine Mutter hatte ihn mit polnischen Melodien bekanntgemacht, die ihn lebenslang prägten. Dadurch wurde er zu einem Verehrer von Frederik Chopin, zu dessen Gedenke er die Oper komponierte. „Es sollte ein dramatisches Stück aus dem polnischen Volksleben des 16. und 17. Jahrhunderts ohne politischen Hintergrund werden, mit sparsam eingestreuten phantastischen Elementen, wie etwa Wahrsage- oder Zauber-Szenen; außerdem sollte es Gelegenheiten für polnische Tänze bieten“, hatte der Komponisten seinem Textdichter Ilja Tumenew mit auf den Weg gegeben. Der war opernerfahren. Er hatte bedeutende westeuropäische Werke, darunter Wagners Ring und die Meistersinger ins Russische übersetzt. Für Pan Wojewode griff er auf die gleichnamige Ballade des polnischen Dichters Adam Mickiewicz zurück. Waren die Erwartungen zu groß? Die mit Verstrickungen überladene Geschichte um einen mächtigen polnischen Provinzfürsten aus dem 16. Jahrhundert, einem Wojewoden, die auch im Booklet nur angerissen wird, erschließt sich im Jahr 2020 noch viel weniger als zum Zeitpunkt der Uraufführung 1904, der kein bleibender Erfolg beschieden war. Es singen mit großer Geste Alexei Korolev den Pan Wojewoden, Kapitalina Rachevskaya seine Nichte Maria, die ihrer Ermordung entgeht und schließlich mit dem geliebten Czaplinski (Anatoly Orfionov) zusammenfindet, der seinerseits den Wojewoden ins Jenseits befördert, während die giftmischende Witwe (Natalya Rozhdestvenskaya) leer ausgeht.

Antikes Flair bei der Uraufführung 1902 in Petersburg: Die Oper Servilia spielt im alten Rom zur Zeit von Kaiser Nero. Eine Gesamtausnahme existiert nicht. Nur vier Szenen konnten in die Edition übernommen werden. Foto: Wikipedia
Schneeflöckchen (Snow Maiden) gehört zu den Opern, die frühzeitig auch im Deutschland bekannt wurden. Beim damaligen NWDR hat sich eine Aufnahme des vierten Aktes von 1950 mit Margot Guilleaume in der Titelrolle und Martha Mödl als Frühlingsfee erhalten. Rimsky-Korsakov selbst hielt die Oper für seine beste. Vorlage ist das gleichnamige Märchen von Alexander Ostrowski. In der märchenhaften Versöhnung zwischen Menschen und Natur steckt sogar ein ziemlich moderner Ansatz. Wieder garantiert Swetlanow am Pult des Orchesters des Bolschoi-Theaters einen frischen und zupackenden Sound. Mit Vera Firsova (Schneeflöcken), Galina Vishnewskaya (Kupava), Veronika Borisenko (Frühlingsfee) und Ivan Kozlovsky (Zar Beendy) ist die Aufnahme von 1957 ausgesprochen prominent besetzt. Für Die Zarenbraut (The Tsar´s Bride) – einen Mitschnitt aus dem Bolschoi von 1958 – hatte Svetlanov die Shumskaya als Marfa, die Borisenko als Lyubasha, Andrey Ivanov als Lykov und Vedernikov als Sobakin zur Verfügung. Das Werk, welches wie oft bei Rimsky-Korsakov wieder mit historischen Elementen durchsetzt ist, führt ins Moskau des Jahres 1572. Im Staatsrundfunk wurde 1949 unter Samosud Der unsterbliche Kaschtschej (Kashchey the Immortal) eingespielt. In der märchenhaften Geschichte kann das Böse in Gestalt des Kaschtschej, nicht länger triumphieren und fällt dem Tode anheim. Die Aufnahme des auch im Westen verbreiteten Stückes Der goldene Hahn (The Golden Cockerl) von 1951 betreut Alexander Gauk während Vassily Nebolssin die Oper mit dem wohl buchstabenreichsten Namen dirigiert: Die Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesh und der Jungfrau Fewronija (The Legend of the invisible City Kitezh and the Maiden Fevronia). Angeführt wird die Besetzungsliste von dem Mittdreißiger Ivan Petrov in der Basspartie des Fürsten Jury. Von Servilia, der Oper, die im alten Rom des Kaisers Nero spielt, lässt sich keine Gesamtaufnahme nachweisen. Überliefert sind nur vier hochkarätig besetzte Szenen aus dem dritten und dem vierten Akt, die Anfang der 1950er Jahre im Rundfunk unter Onisim Bron eingespielt wurden. Es ist ein Spiel um Macht, Intrigen und Leidenschaft. Olga Piotrovskaya singt die Titelrolle, die Tochter eines Senators, in die Volkstribun Valery (Georgi Nelepp) verliebt ist. Ihre Zuneigung will sich auch der freigelassene Sklave Egnaty (Pavel Lisitsian) durch List ihre Liebe gewinnen. Sie entzieht sich diesen Werbungen, indem sie sich in eine von Nero verfolgte christliche Gemeinschaft flüchtet, wo ihr Leben verlischt (Abbildung oben: Die Mainacht, Illustration zu Pushkins Erzählung von Ivan Bilibin/ Wikipedia). Rüdiger Winter


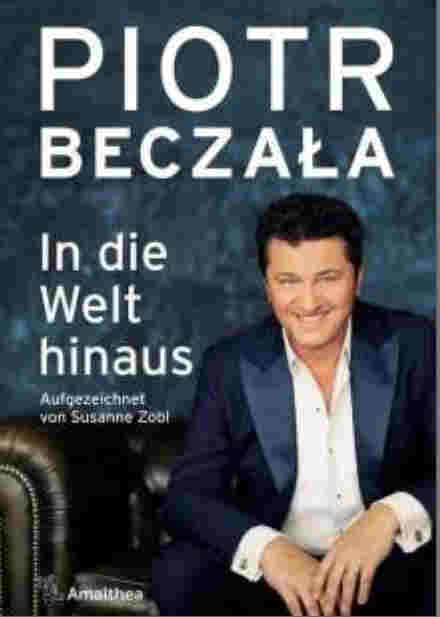












 Solide Sängergarde. Viele Passagen von Leonore und Florestan sind in dieser Urfassung noch teuflischer als im späten Fidelio.
Solide Sängergarde. Viele Passagen von Leonore und Florestan sind in dieser Urfassung noch teuflischer als im späten Fidelio.