Endlich. Vor nicht allzu langer Zeit konnte man noch zurecht die heutzutage schon auffällige Missachtung des französischen Komponisten François-Adrien Boieldieu (1775-1834) durch die Schallplattenfirmen beklagen. Von André Grétry (1741-1813) kurz vor seinem Tode zu seinem würdigen Nachfolger auf dem Musiktheater erklärt, prägte der in Rouen geborene Boieldieu das Genre der opéra comique zur Zeit des Empire, der Restauration und der beginnenden Julimonarchie wie kaum ein anderer. Eine Art Wunderkind, wurde er von seinen Zeitgenossen gar respektvoll „der französische Mozart“ genannt. Seine erste abendfüllende Oper schrieb er 1793 mit kaum achtzehn Jahren und drückte dem Musikleben Frankreichs und zeitweilig auch Russlands von da an bis in die frühen 1830er Jahre seinen Stempel auf.
Dass das Interesse an Boieldieu derart nachlassen würde, war noch vor einem halben Jahrhundert völlig undenkbar erschienen. In den 1960er und frühen 1970er Jahren legte die französische Rundfunkanstalt ORTF ein paar Gesamteinspielungen seiner Opern vor, darunter Le Calife de Bagdad unter Louis Fourestier, Jean de Paris unter Jean-Paul Kréder und Les Voitures versées unter Jean Brébion. Besonders La Dame blanche, sein größter Erfolg, war lange Zeit ein Dauerbrenner, wurde in Deutschland in Übersetzung gespielt und wurde häufig aufgenommen, so etwa 1962 in Paris mit Michel Sénéchal unter Pierre Stoll, 1964 mit Nicolai Gedda in Hilversum unter Jean Fournet und zuletzt 1996 wiederum in Paris mit durchaus namhafter Besetzung in einer EMI-Produktion unter Marc Minkowski.
Viel mehr ist in Sachen Boieldieu seither tatsächlich nicht erschienen, so dass diese neue cpo-Produktion (cpo 555 244-2), welche nicht nur sechs Opernouvertüren, sondern auch das Klavierkonzert beinhaltet, mit Freude begrüßt werden darf. Es brauchte wohl wirklich ein deutsches Label, einen englischen Dirigenten sowie ein italo-schweizerisches Orchester, um diesem französischen Compositeur Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, der heute selbst auf Frankreichs Opernbühnen ein unverständliches Schattendasein führt.

Die ältere EMI-Aufnahme, wieder bei Warner erschienen: Boieldieus „Dame Blanche“ unter Minkowski
Inkludiert wurden auf der knapp 70-minütigen CD die Ouvertüren zu den Opern Le Calife de Bagdad, Emma ou La Prisonnière, La Dame Blanche, Jean de Paris, Les Voitures versées sowie Ma Tante Aurore, was einen Zeitraum von 1800 bis 1825 und damit den Höhepunkt des Wirkens Boieldieus abdeckt. Mit dem Calife de Bagdad widmete sich der Komponist der an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert besonders beliebten sogenannten „Türkenoper“. Während der gesamten napoleonischen Ära konnte ihr keine andere opéra comique den Rang als meistgespielte streitig machen, was Boieldieu mit einem Schlage zu einem der erfolgreichsten Komponisten in Paris machte. Bei der bereits im Vorjahr 1799 fertiggestellten Oper Emma ou La Prisonnière handelte es sich um die erste Kooperation zwischen Boieldieu und dem deutlich älteren Luigi Cherubini, von dem auch die Ouvertüre stammt. (Noch Boieldieus letzte Oper La Marquise de Brinvilliers von 1831 war übrigens eine Gemeinschaftsproduktion mit Cherubini und Auber.) In gewissen Details wie den nach der Durchführung wiederkehrenden Einleitungstakten ist ein deutlicher Unterschied zu Boieldieus eigenen Ouvertüren feststellbar. Dass diese aus Cherubinis Feder stammende Introduktion gleichwohl hier aufgenommen wurde, ermöglicht den nicht uninteressanten Direktvergleich. Mit der besonders spritzigen und an Mozart erinnernden Ouvertüre zu Les Voitures versées ist auch Boieldieus Sankt Petersburger Zeit (1803-1810) am Hofe des Zaren Alexander I. berücksichtigt worden. Die ursprüngliche Komposition von 1808 wurde 1820 für Paris freilich noch einmal überarbeitet und hielt sich bis 1868 ununterbrochen im Repertoire. Der ungewöhnliche und zunächst unverständliche Titel Die umgeworfenen Kutschen referiert auf die zum Schmunzeln anregende Handlung, in der ein gelangweilter Schlossherr in Anjou durch den bewusst beibehaltenen schlechten Zustand der angrenzenden Straße dafür sorgt, dass Reisende dort regelmäßig unfreiwillig liegenbleiben und ihm gezwungenermaßen Gesellschaft leisten. Jean de Paris von 1812 mit seiner ins Spätmittelalter gelegten Handlung markiert Boieldieus Wiederkehr in die französische Hauptstadt und erwies sich ebenfalls als sensationeller Erfolg. Dies gilt schließlich noch mehr für die landläufig noch heute bekannte Oper La Dame blanche mit ihrer, dem damaligen Publikumsgeschmack entgegenkommenden Spukgeschichte auf einem schottischen Schloss. Mit diesem Werk konnte Boieldieu auf dem Höhepunkt der Restauration im Jahre 1825 den größten Triumph seines Lebens feiern; es wurde geradezu zum Musterbeispiel für eine opéra comique. Kein anderes Werk dieser Gattung konnte auch international solche Begeisterungsstürme hervorrufen, wovon die überaus positive Aufnahme durch Carl Maria von Weber, Franz Liszt und selbst Richard Wagner zeugt. All diesen Ouvertüren ist das Melodiöse und Kantable gemein, was wiederum den Mozart’schen Einfluss offenbart, ohne dass Boieldieu Gefahr liefe, als bloßer Epigone zu gelten.
Repräsentiert La Dame blanche den gereiften Boieldieu auf der Höhe des Lebens, vermittelt das ebenfalls enthaltene knapp halbstündige Klavierkonzert in F-Dur einen guten Eindruck von den Anfängen dieses Komponisten in seiner Heimatstadt Rouen. Bereits die Uraufführung 1792 vermittelte einen Eindruck vom Können des gerade Siebzehnjährigen. Obwohl nur zweisätzig – und damit von seinem bekannteren Harfenkonzert in drei Sätzen von 1800 verschieden –, erweist sich dieses Konzert als schönes Beispiel für die von den Wirren der Französischen Revolution musikalisch offenbar noch nicht beeinflussten Musik der frühen 1790er Jahre. Der gewichtige, nicht weniger als 17 Minuten lange erste Satz nimmt fast zwei Drittel des Konzertes ein. Mittels einer flotten Coda am Ende des neunminütigen zweiten Satzes wird gleichsam der fehlende Rondo-Satz ausgeglichen.

Lange Jahre die einzige Aufnahme: Boieldieus „Dame blanche“ von Vega, später bei Accord/Universal
Für Vergleichsaufnahmen muss man weit zurückgehen. So liegen Le Calife de Bagdad, Jean de Paris und Les Voitures versées wie auch das Klavierkonzert lediglich in mittlerweile doch betagten Einspielungen vor, die ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel haben. So verwundert es mitnichten, dass diesen die Frische fehlt, welche das bestens disponierte Orchestra della Svizzera italiana unter Howard Griffiths herüberbringt, der für cpo bereits u. a. einen kompletten Zyklus der Sinfonien von Ferdinand Ries, die sämtlichen Ouvertüren von Weber sowie die Sinfonien von Louis Spohr vorlegte. Das dort gezeigte hohe künstlerische Niveau wird ohne Einschränkungen auch bei den hier vorliegenden Boieldieu-Aufnahmen erreicht. Bei den Ouvertüren zu Emma ou Prisonnière und Ma
Tante Aurore dürfte es sich sogar um Weltersteinspielungen handeln, auch wenn dies nicht gesondert gekennzeichnet wurde. Erstaunlicherweise haben die Musiker aus der italienischsprachigen Schweiz unter Griffiths aber auch die diskographisch vergleichsweise gut dokumentierte Ouvertüre zu La Dame blanche derart mustergültig zustande gebracht, dass diese vollblutige und paukenstarke Interpretation alle mir bekannten Vergleichsaufnahmen überflügelt. Tatsächlich nimmt sich Griffiths Zeit, hat bei eigentlich jedem der vergleichbaren Werke langsamere Spielzeiten als bis dato üblich. Mit neun Minuten benötigt er bei La Dame blanche etwa fast zwei Minuten mehr als anderswo, doch weiß er die gewonnene Zeit zu nutzen und überzeugend auszugestalten.
Die in Wien als Professorin wirkende und diskographisch bereits breit aufgestellte serbische Pianistin Nataša Veljković zeigt sich als profund agierende Solistin im stiefmütterlich behandelten Klavierkonzert Boieldieus. Das Orchester aus Lugano, obwohl auf modernem Instrumentarium spielend, hat sich doch merklich einer historisch informierten Spielweise angenähert, was sich als weiterer großer Pluspunkt dieser Produktion erweist, die mit einem lehrreichen deutsch-englischen Beiheft ausgestattet wurde (Einleitung: Markus Schneider). Verbunden mit dem formidablen Klangerlebnis kann man hier nur von referenzträchtigen Einspielungen sprechen, die wohl auf lange Zeit die neue Messlatte gesetzt haben. Unbedingt empfehlenswert (Boieldieu: Klavierkonzert; Opernouvertüren/ Nataša Veljković, Klavier/ Orchestra della Svizzera italiana/Howard Griffiths/ cpo 555 244-2/Aufnahmedatum: 2015/Erscheinungsdatum: 2018).

Sogar eine deutschsprachige Aufnahme gibt es von der „Weißen Dame“ Boieildieus, vom Jugendtreffen in Schloss Rheuinsberg 2010 (Genuin GEN 10534)
Da passt eine Erinnerung an die bislang einzige „offiziell“ herausgegebene deutschsprachige Aufnahme der Weißen Dame vom Jugendtreffen in Schloss Rheinsberg 2008 bei der Firma Genuin (2 CD GEN 10534) sehr gut, die Daniel Hauser noch einmal vorstellt: Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat es mit dem einstmaligen Vorzeigestück der französischen opéra comique des 19. Jahrhunderts, La Dame blanche von François-Adrien Boieldieu, nicht allzu gut gemeint. Aufführungen dieses Werkes muss man heutzutage gleichsam mit der Lupe suchen, von Einspielungen gar nicht zu reden. Die meisten derselben datieren in die 1940er bis 60er Jahre. Bereits die EMI-Aufnahme unter Marc Minkowski von 1996 war ein später Nachzügler. So betrachtet, ist es wirklich begrüßenswert, dass das Label Genuin 2010 eine deutschsprachige Einspielung der Kammeroper Schloss Rheinsberg vorlegte (GEN 10534). Tatsächlich stellt diese die einzige greifbare Gesamtaufnahme der Weißen Dame auf Deutsch dar (sieht man von einer Verfilmung von 1960 ab, der eine gekürzte deutschsprachige Fassung unter dem Dirigat von Siegfried Köhler zugrunde liegt). Dies erschwert die direkte Vergleichbarkeit mit Aufnahmen in Originalsprache, zumal es sich bei der vorliegenden Produktion noch dazu um eine mit Amateuren handelt. Dies muss kein grundsätzlicher Makel sein, handelt es sich doch um ein durchaus renommiertes Festival für Nachwuchsstimmen. Da man sich zu einer Veröffentlichung entschieden hat, muss man sich allerdings auch der Konkurrenz stellen. Die vorliegende Aufnahme ist eine Koproduktion mit dem Deutschlandradio und wurde zwischen dem 23. und dem 26. Juli 2008 im Schlosstheater Rheinsberg mitgeschnitten. Man hat also eine Live-Montage mit allen Vor- und Nachteilen vor sich: Studiosterilität kann ausgeschlossen werden, doch wird man mit Bühnengeräuschen leben müssen. Insgesamt ist das Klangbild aber ohne Fehl und Tadel.
Deutlich problematischer und wirklicher Schwachpunkt dieser Einspielung ist die hier gewählte Lösung hinsichtlich der gesprochenen Texte, die weggelassen wurden (vielleicht auch wegen der vielen nicht-deutschsprachigen Mitwirkenden, was für eine in Deutsch gesungene Oper doch sicher problematisch ist/ G. H.). Dies wäre noch verkraftbar, hätte man sich nicht einer fragwürdigen Alternative mittels eines Schauspielers in der Rolle des Librettisten Eugène Scribe bedient, der durch den Handlungsablauf führt. Matthias Hinz, der auch den Erzähler, die Statue und den Friedensrichter gleich mit übernimmt, neigt nämlich zu einem auf die Dauer nervtötenden Overacting, welches sich schnell abnutzt und weitere Steigerungen gar nicht erst ermöglicht. Ob es sich hier um einen sonderbaren Regieeinfall (Inszenierung vom ehemaligen Counter Axel Köhler, der auch für die deutsche Übersetzung verantwortlich zeichnet) handelt, kann nicht abschließend geklärt werden. Dass sogar die hübsche Ouvertüre – Boieldieus vermutlich beste – dafür unterbrochen wird, ist eigentlich indiskutabel. Zumindest für die reine Tonaufnahme hätte man besser ganz darauf verzichtet und es allein bei den Gesangsnummern belassen.
Die Besetzung mit jungen Stimmen ist soweit sehr ordentlich, wenn auch in keinem Falle maßstabsetzend, was man bei einer solchen Produktion ehrlicherweise aber auch nicht voraussetzen darf. Amar Muchhala als George Brown steigert sich nach Startschwierigkeiten im Verlaufe der Oper doch glücklicherweise noch. Direktvergleiche in der Cavatine Komm, o holde Dame mit so berühmten Vorgängern wie Nicolai Gedda, Michel Sénéchal oder gar David Devriès sollte man indes gar nicht erst bemühen, was nicht nur an der deutschen Übersetzung liegt, wie man bei Fritz Wunderlich oder Josef Traxel nachhören kann. Alles in allem bewältigt Muchhala die Partie aber zufriedenstellend.
Die übrige Besetzung ist durchaus solide, wobei Mara Mastalir in der Rolle der Jenny vielleicht am meisten überzeugen kann. Paola Leggeri als Anna versucht ihrer eigentlich lyrischen Stimme gelegentlich etwas forciert Dramatik aufzuerlegen. Rollendeckend Anne Catherina Wagner als Margarethe, Christopher O’Connor als Dikson und Dionisos Tsantinis als Gaveston.
Der Chor und das RIAS Jugendorchester unter Gernot Schulz liefern zwar keine neue Referenz ab, beweisen aber doch das überwiegend hohe künstlerische Niveau der Nachwuchskräfte. Im direkten Vergleich wäre indes der alten Live-Aufnahme unter Jean Fournet von 1964 (Melodram; bereits in Stereo) der Vorzug zu geben, die summa summarum bis heute die überzeugendste Gesamtaufnahme dieser mittlerweile etwas verkannten Oper bleibt. Freunde deutschsprachiger Aufnahmen französischer Opern kommen trotz der benannten Einschränkungen nicht an dieser Produktion vorbei. Daniel Hauser
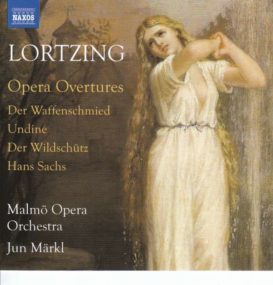 Auf den ersten Blick wundert man sich womöglich, dass diese – so viel vorweg – wichtigen Einspielungen gerade jetzt erscheinen, ist doch gar kein Jubiläumsjahr für Albert Lortzing (1801-1851), berühmt geworden als Hauptrepräsentant der deutschen Spieloper, in Sicht. Einmal mehr steht Naxos (8.573824) hinter dem Vorhaben, einmal mehr wurde ein eher untypischer Klangkörper, das Opernorchester von Malmö in Schweden, dafür ausgewählt. Mit Jun Märkl hat man indes einen mittlerweile altbekannten Dirigenten für das Projekt gewinnen können, der für Naxos u. a. bereits einige seltene Wagner-Ouvertüren einspielte.
Auf den ersten Blick wundert man sich womöglich, dass diese – so viel vorweg – wichtigen Einspielungen gerade jetzt erscheinen, ist doch gar kein Jubiläumsjahr für Albert Lortzing (1801-1851), berühmt geworden als Hauptrepräsentant der deutschen Spieloper, in Sicht. Einmal mehr steht Naxos (8.573824) hinter dem Vorhaben, einmal mehr wurde ein eher untypischer Klangkörper, das Opernorchester von Malmö in Schweden, dafür ausgewählt. Mit Jun Märkl hat man indes einen mittlerweile altbekannten Dirigenten für das Projekt gewinnen können, der für Naxos u. a. bereits einige seltene Wagner-Ouvertüren einspielte.
Geht man vorbehaltlos an das vorliegende Projekt heran, so kann man es nur würdigen, wurden doch nicht weniger als neun Ouvertüren zu Lortzings Opern vorgelegt, davon einige selten oder gar bis dato überhaupt nicht eingespielt. Tatsächlich schrieb der Komponist sogar noch weitere Bühnenwerke, so dass man sich gewünscht hätte, Naxos hätte lieber ein paar derselben berücksichtigt (darunter Ali Pascha von Janina, Casanova oder Rolands Knappen), anstatt die vergleichsweise gut dokumentierten Opern Der Wildschütz und Zar und Zimmermann mit aufzunehmen. Geschenkt. Jedenfalls gäbe es noch Potential für eine zweite CD.
Die deutschsprachige Spieloper leidet heute unter einer ähnlichen Problematik wie die französische opéra comique, ihr eigentliches Vorbild, da sie mit ihrem kleinbürgerlich-biedermeierlichen Ambiente und den gesprochenen Dialogen international einen schweren Stand hat und sich zudem für das zeitgenössische Regietheater nur sehr bedingt anbietet. Rein diskographisch sieht die Situation bei genauerem Hinsehen gar nicht einmal so trostlos auch, wenngleich nahezu alle vorliegenden Gesamtaufnahmen in etwa ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel haben.
Losgelöst von den jeweiligen Bühnenwerken, gleichsam als reine Instrumentalmusik und dergestalt vom Komponisten gar nicht vorgesehen, üben diese Ouvertüren gleichwohl einen ganz eigenen Reiz aus, wie man dies unlängst bei der Naxos-Produktion mit Opernouvertüren von Daniel-François-Esprit Auber, einem französischen Zeitgenossen Lortzings und dem neben François-Adrien Boieldieu wohl bedeutendsten Vertreter der opéra comique in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nachvollziehen konnte (auch wenn dort ausgerechnet der Esprit fehlte – nomen est omen).
Zumindest vom Wildschütz und Waffenschmied, von Zar und Zimmermann, Hans Sachs und Undine, ja selbst von Regina und der Opernprobe gibt es Gesamteinspielungen in Stereo. Märkls Neueinspielungen können sich durchaus gut behaupten, selbst wenn Lortzing-erfahrene Dirigenten wie Robert Heger, Heinz Wallberg und Fritz Lehan womöglich noch einen Hauch idiomatischere Ergebnisse erzielt haben mögen. Gar keine Konkurrenz gibt es beim hier erst kürzlich besprochenen Weihnachtsabend, wo nun mit der beinahe kammermusikalisch anmutenden Ouvertüre (ohne Posaunen, Hörner und Schlagwerk) endlich ein erster musikalischer Auszug vorliegt. Allein dies ist die CD schon wert. Und auch die Ouvertüre zu Andreas Hofer wurde zumindest im Stereozeitalter augenscheinlich noch nicht vorgelegt.
Was fällt interpretatorisch auf? Vergleich man die Spielzeiten mit den älteren Aufnahmen, dann lässt es Märkl (durchaus nicht zum Nachteil) gemessener und dadurch auch gewichtiger angehen. So dirigiert etwa Fritz Lehan die Waffenschmied-Ouvertüre anderthalb Minuten flotter, ist Otmar Suitner bei der (sehr kurzen) Ouvertüre zur Opernprobe eine halbe Minute schneller, Heinz Wallberg in jener zum Wildschütz gar fast zwei Minuten und Max Loy bei derjenigen zu Hans Sachs eine Minute. Wie gesagt, ist das per se kein Qualitätsmerkmal, doch ist es erfreulich, dass weithin verkannten Werke nun in einer deutlich anderen Lesart zu hören sind. Unter den inkludierten Werken sticht Regina, die zu Lortzings Lebzeiten nie aufgeführte „Freiheitsoper“, einigermaßen hervor, handelt es sich doch um sein ungewöhnlichstes Bühnenwerk mit deutlicher politischer Aussage in der Gemengelage der Revolution von 1848 – und hübschem Cellosolo in der Ouvertüre. Dies zeigt auch, dass der häufig unterschätzte Komponist durchaus zu dramatischen Werken imstande war, was bereits insbesondere in der wuchtigen und bedeutungsschweren Undine-Ouvertüre anklang.
Auch aufgrund der tadellosen Darbietung durch das Malmöer Opernorchester (wunderbar strahlende Blechbläser und sehr knallige Pauken) und der überzeugenden Klangqualität dieser im Juni 2017 im Opernhaus von Malmö entstandenen Einspielungen darf diese diskographische Erweiterung des Lortzing‘schen Œuvre als geglückt bezeichnet werden (Lortzing: Opernouvertüren/ Malmö Opera Orchestra/Jun Märkl/ Naxos 8.573824/ Aufnahme: 2017/ Erscheinungsdatum: 2019) Daniel Hauser
 In Erinnerungen schwelgen kann wer die mittlere der drei CDs (Opera Ouvertures, Choruses and Duets) mit Chören aus der Berliner Staatsoper vor allem der Siebziger des vergangenen Jahrhunderts stammenden Aufnahmen hört. Damals konnte man sich für 15 der 25 im Zwangsumtausch erworbenen Ostmark an der Kasse unter den Linden bei Tante Ernestine eine Karte auf dem besten Platz des Hauses kaufen, für die restlichen zehn Ostmark im Kronprinzessinnenpalais ein Menu mit der immer gleich bleibenden Wahl zwischen Weißkraut- und Rotkrautsalat als Sättigungsbeilage verzehren oder Noten, und die sogar von in der DDR nie gespielten Werken wie Adriana Lecouvreur, kaufen. Einheitsmenu und billige Klavierauszüge gehören der unwiederbringlichen Vergangenheit an, die Aufnahmen mit dem Chor der Staatsoper unter Ernst Stoy und der Staatskapelle unter Otmar Suitner erfreuen auch 2019 durch ihre Frische, ihren Elan, weniger durch die Bereitschaft, den Hörer erkennen zu lassen, in welcher Sprache gesungen wird, denn was wohl Italienisch oder Französisch sein soll, ist unverständliches Kauderwelsch, während die Tracks mit Wagner- oder Mozart (Zauberflöte), von Flotow und Nicolai gerade auch durch die Textverständlichkeit ein Genuss sind. In den Lustigen Weibern von Windsor, die in der nächsten Spielzeit aufgeführt werden sollen, was nach Jahren der Vernachlässigung der deutschen Spieloper nur zu begrüßen ist, wird viel nächtlicher Zauber entfaltet, im Brautchor aus Lohengrin wird jedes Abgeleiertsein vermieden, die Spinnerinnen aus dem Fliegenden Holländer drehen nicht nur ihre Rädchen munter, sondern gehen genauso beschwingt mit ihrem Mundwerk zu Werke, so wie die Herren des Jägerchor unbekümmert und dabei doch diszipliniert schmettern. Das deutsche Fach könnte nicht besser aufgehoben sein, auch der Einzug der Gäste aus Tannhäuser ist purer Ohrenschmaus.
In Erinnerungen schwelgen kann wer die mittlere der drei CDs (Opera Ouvertures, Choruses and Duets) mit Chören aus der Berliner Staatsoper vor allem der Siebziger des vergangenen Jahrhunderts stammenden Aufnahmen hört. Damals konnte man sich für 15 der 25 im Zwangsumtausch erworbenen Ostmark an der Kasse unter den Linden bei Tante Ernestine eine Karte auf dem besten Platz des Hauses kaufen, für die restlichen zehn Ostmark im Kronprinzessinnenpalais ein Menu mit der immer gleich bleibenden Wahl zwischen Weißkraut- und Rotkrautsalat als Sättigungsbeilage verzehren oder Noten, und die sogar von in der DDR nie gespielten Werken wie Adriana Lecouvreur, kaufen. Einheitsmenu und billige Klavierauszüge gehören der unwiederbringlichen Vergangenheit an, die Aufnahmen mit dem Chor der Staatsoper unter Ernst Stoy und der Staatskapelle unter Otmar Suitner erfreuen auch 2019 durch ihre Frische, ihren Elan, weniger durch die Bereitschaft, den Hörer erkennen zu lassen, in welcher Sprache gesungen wird, denn was wohl Italienisch oder Französisch sein soll, ist unverständliches Kauderwelsch, während die Tracks mit Wagner- oder Mozart (Zauberflöte), von Flotow und Nicolai gerade auch durch die Textverständlichkeit ein Genuss sind. In den Lustigen Weibern von Windsor, die in der nächsten Spielzeit aufgeführt werden sollen, was nach Jahren der Vernachlässigung der deutschen Spieloper nur zu begrüßen ist, wird viel nächtlicher Zauber entfaltet, im Brautchor aus Lohengrin wird jedes Abgeleiertsein vermieden, die Spinnerinnen aus dem Fliegenden Holländer drehen nicht nur ihre Rädchen munter, sondern gehen genauso beschwingt mit ihrem Mundwerk zu Werke, so wie die Herren des Jägerchor unbekümmert und dabei doch diszipliniert schmettern. Das deutsche Fach könnte nicht besser aufgehoben sein, auch der Einzug der Gäste aus Tannhäuser ist purer Ohrenschmaus.
Das gilt auch für die CD mit Ouvertüren, die vorwiegend von der Staatskapelle Dresden, ebenfalls unter Otmar Suitner, gespielt werden. Auf beider Konto gehen Die verkaufte Braut, Hänsel und Gretel und zwei Ouvertüren von Franz von Suppé, letztere gern als Konzertstücke gespielt. Da wird einmal zauberhafte Märchenstimmung erzeugt, mal ein Feuerwerk guter Laune entzündet. Giuseppe Patané spielt mit der Staatskapelle ein Vorspiel zum 3. Akt von Traviata von schmerzlicher Eindringlichkeit, Franz Konwitschny eine Holländer-Ouvertüre mit edlem Bläserklang und leuchtendem Schluss, Herbert Kegel und die Dresdner Philharmonie eine rasante Donna-Diana-Ouvertüre. Die Staatskapelle Berlin unter Bernhard Klee ist mit zauberhaftem wenn nicht Wald- ,so doch Parkweben der Lustigen Weiber vertreten. Schließlich gibt es noch die Bamberger Symphoniker unter Manfred Honeck mit einer flotten Fledermaus.
Kritisch wird es mit der dritten der CDs mit von den beiden Stars der DDR, Peter Schreier und Theo Adam, bestrittenen Duetten, die für bei Berlin Classics 1974 aufgenommen wurde. Natürlich gönnt man den beiden hochverdienten Herren den Spaß, im völlig falschen Fach zu singen, aber Peter Schreier hat für den Hans nicht die Zwischenfachqualitäten, für Nadir und Faust nicht die Süße des Timbres, für den Alvaro nicht die Verdi-Glut in der Stimme und gefällt so nur als Pedrillo, bei Lortzing und mit Abstrichen als Tamino. Viel besser schlägt sich da Theo Adam, auch wenn dem Kezal das Schlitzohrige abgeht, für die Baritonpartien die Stimme künstlich aufgehellt wird oder wie für Papageno, den er neben dem Sprecher und dem 2. Priester singt, einfach zu ausladend ist. Belustigend sind diese Ausflüge in ungewohnte Opernlandschaften allemal, die zu ungewohnten Hörerlebnissen führen und einmal mehr zusätzlich die Meinung bestätigen, dass einzig das Singen in der Originalsprache wünschenswert ist (Brilliant Classics 95414). Ingrid Wanja








 Als Vertreter der Moderne werden Gräfin
Als Vertreter der Moderne werden Gräfin  Neben fünf Liedern Clara Schumanns heißt das für die polnische Mezzosopranistin
Neben fünf Liedern Clara Schumanns heißt das für die polnische Mezzosopranistin 



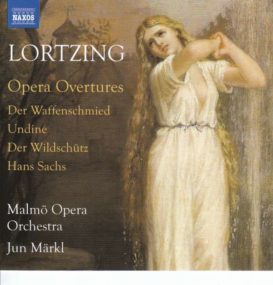 Auf den ersten Blick wundert man sich womöglich, dass diese – so viel vorweg – wichtigen Einspielungen gerade jetzt erscheinen, ist doch gar kein Jubiläumsjahr für
Auf den ersten Blick wundert man sich womöglich, dass diese – so viel vorweg – wichtigen Einspielungen gerade jetzt erscheinen, ist doch gar kein Jubiläumsjahr für  In Erinnerungen schwelgen kann wer die mittlere der
In Erinnerungen schwelgen kann wer die mittlere der