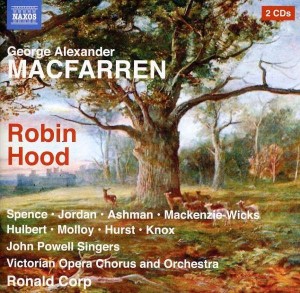In einem langen Journalistenleben lohnt es sich, ab und zu über die vielen Eindrücke nachzudenken, die auf dem Gebiet der italienischen Oper den eigenen Geschmack und die vielen Lernerfahrungen bestimmt haben, namentlich durch die Begegnung mit vielen Sängern/Sängerinnen und deren stimmlichen Impakt auf das eigene Hören und Lernen. Das heißt, dass nach meinem Eindrücken und vielleicht auch nur für mich geltend die Ausführung der italienischen Oper – soweit es die Soprane betraf – beinahe prototypisch auf vier Säulen ruht: erzitalienisch auf Renata Tebaldi (* 1. Februar 1922 in Pesaro; † 19. Dezember 2004 in San Marino) und auf Anita Cerquetti (* 13. April 1931 in Montecosaro, Provinz Macerata; † 11. Oktober 2014 in Perugia) und sowie auf den zwei beiden „Zugereisten“, der Graeco-Amerikanerin Maria Callas (Dezember 1923 in New York City; † 16. September 1977 in Paris) und der Australierin Joan Sutherland (* 7. November 1926 in Sydney, New South Wales; † 10. Oktober 2010 in Montreux-Les Avants, Schweiz).

Renata Tebaldi: eines meiner Lieblingsfotos als Wagners Elisabeth 1953/ Foto Wiki
Jede von ihnen verkörpert für mich par excellence sowohl geschmacklich wie auch technisch-künstlerisch (und vor allem idiomatisch!) eine ganz entscheidende, spezifische Richtung oder Auffassung des Gesangs. Die Tebaldi und die Cerquetti sind die beiden Pole absolut italienischen Gesangs zwischen sprachlich-veristisch orientierter, hoch kontrollierter Kunst (Tebaldi) und absolut genuiner, nur aus der Musik selbst heraus bestimmter, hochpersönlicher Darstellung der unglaublichen stimmlichen Üppigkeit (Cerquetti). Dazwischen stehen für mich Maria Callas und Joan Sutherland mit ihrer stimmlich schmalen, hochartifiziellen, fast intellektuellen (Callas) und hochvirtuosen, aber klanglich/idiomatisch eher anonymen (Sutherland) Kunst-Fertigkeit. Natürlich gibt es viele andere, die zwischen diesen Spektren angesiedelt sind und jeweils zum einen oder anderen Lager neigen: Clara Petrella, Leyla Gencer (im Schatten der Callas), absolut Renata Scotto (Callas-nah), Mafalda Favero oder auch die entzückende Alleskönnerin Margherita Rinaldi, Maria Caniglia und sogar die Italo-Amerikanerin Aprile Millo (mit ihrer frappierenden Nähe zu der Tebaldi und Zinka Milanov), Rosanna Carteri, Orianna Santunione, natürlich Carla Gavazzi, Maria Pedrini ganz sicher (auch sie wie die Cerquetti ganz aus der Musik selbst heraus schöpfend), dto. Maria Vitale, die tapfere Caterina Mancini, selbst Adriana Guerrini, Maria Caniglia (als Verkörperung des Übergangsstils nach dem Krieg) und viele, viele mehr (die von mir geschätzte Maria Dragoni nicht vergessend, und Magda Olivero ist ein Sonderfall, die nehme ich mal aus). Wenige Sängerinnen der heutigen Zeit, muss ich leider sagen, gehören für mich zu diesen Nachrücklichen: Der unverdiente Hype um solche wie Sonia Yoncheva oder Sondra Radvanovsky, Marina Rebeka oder Anna Netrebko (und wer noch?) kann die Gesichtslosigkeit und Anonymität dieser Stimmen im Gegensatz zur Unverkennbarkeit jener Genannten nicht verbergen.
Um auf Renata Tebaldi zurückzukommen: Sie ist (nicht nur für mich) eine dieser prototypischen Säulen der italienischen Oper unserer Zeit. Für manche ein wenig herb im Ton, für mich und viele andere die Erfüllung ihrer Rollen-Figuren namentlich im veristischen Repertoire. Kaum eine andere hat die Adriana Lecouvreur oder Puccinis Minnie so erfüllt gesungen, und sogar ihre Gioconda kann neben der von Maria Callas mit Glanz bestehen. Die Erwähnung dieser Kollegin bestimmt auch einen großen Teil ihrer Karriere und ihres Repertoires, denn das kluge Ausweichen der Tebaldi nach erfolgreichen Jahren in Italien dann an die New Yorker Met ließ sie zum unangefochtenen Star in Amerika aufsteigen. Und ich gestehe, dass sogar ihre Aida (bei Karajan/Decca) oder auch Elisabetta/Don Carlo (Solti/Decca) zu meinen Lieblingsaufnahmen gehören.
Als Person war sie bezaubernd, wie nicht nur ich bei meiner Begegnung mit ihr erleben durfte. Auch mein Kollege Kevin Clarke schwärmt zu recht noch heute von seinem „Rendevous“ mit der Sängerin in ihrer legendären Mailänder Wohnung, wo das nachfolgende Gespräch 1997 stattfand, das wir zum 100. Geburtstag (am 01. Februar 2022) der Sängerin als eine Hommage an diese unvergessliche und vor allem höchste Maßstäbe setzende Künstlerin wiederholen. G. H.

Renata Tebaldi 1974/ Wikipedia
Nun also Kevin Clarke bei Renata Tebaldi zu Hause in Mailand: Ich gestehe es gleich: Seit dieser Begegnung mit Renata Tebaldi in ihrer Mailänder Wohnung liebe ich diese Diva. Mit allen ihren Schwächen – und Stärken!. Das Gespräch in ihrem luxuriös ausgestatteten Salon mit den kostbaren Möbeln und den vielen Memorabilien ihrer langen Karriere veränderte meine Einstellung zur Tebaldi total. Damals stand der 75. Geburtstag der Künstlerin kurz bevor. Inzwischen ist sie leider verstorben. Aber die Erinnerung an sie lebt weiter. Und was sie zu sagen hatte – bei Kaffee und Gebäck – ist nach wie vor bemerkenswert. Deshalb erscheint das Interview hier nochmals exklusiv bei operalounge. Etliche der im Gespräch erwähnten Aufführungen und Konzerte sind inzwischen auf DVD erschienen, u.a. der Otello aus der Deutschen Oper Berlin.
Am Anfang haben Sie viel Wagner gesungen… Naja, soviel war es nicht, aber ich habe die drei lyrischen Rollen im Repertoire: Elsa, Elisabeth und Eva. Die passten am besten zu meiner Stimme, denn es sind sehr weiche, liebliche Charaktere. Ich habe sie immer auf Italienisch gesungen, da ich Angst hatte, mir in der Originalsprache die Stimme zu ruinieren.
Was sagen sie zur Wagner-Tradition in Italien? Es gab durchaus eine Tradition des Wagnergesangs in Italien. In diese Tradtion habe ich mich eingeordnet. Aber es war dann irgendwann einfacher, für solche Opern deutsche Truppen als Gäste zu engagieren, als es mit italienischen Sängern zu besetzen. Die haben das dann natürlich auf Deutsch gemacht.
 Es gibt eine Aufnahme vom Tannhäuser aus Neapel, wo Sie und alle anderen Italienisch singen, Hans Beier in der Titelrolle aber Deutsch… Wie war das? (lacht) Ich musste immer seinen Text in Gedanken auf Italienisch mitsingen, um meinen Einsatz nicht zu verpassen. Das war ziemlich anstrengend. Das Resultat ist auch deshalb nicht so gelungen, weil er einen ganz anderen Gesangsstil hat als ich. Er platziert seine Stimme völlig anders, gutturaler. Wahrscheinlich muss man das machen, um richtig Deutsch singen zu können, aber es klingt nicht gut.
Es gibt eine Aufnahme vom Tannhäuser aus Neapel, wo Sie und alle anderen Italienisch singen, Hans Beier in der Titelrolle aber Deutsch… Wie war das? (lacht) Ich musste immer seinen Text in Gedanken auf Italienisch mitsingen, um meinen Einsatz nicht zu verpassen. Das war ziemlich anstrengend. Das Resultat ist auch deshalb nicht so gelungen, weil er einen ganz anderen Gesangsstil hat als ich. Er platziert seine Stimme völlig anders, gutturaler. Wahrscheinlich muss man das machen, um richtig Deutsch singen zu können, aber es klingt nicht gut.
Singt sich Wagner gut? Auf Italienisch auf alle Fälle, mir fiel das sehr leicht. Und die Charaktere sind so weich und warm. Besonders die Eva. Ich habe sie an der Scala in einem rein italienischen Ensemble gesungen, im Oktober 1946 oder 1947. Das war damals selten, denn eigentlich ging die Saison von Dezember bis Mai/Juni.
Wie sind ihre Erinnerungen an Auftritte in Deutschland? Ich habe ein Konzert in Stuttgart gegeben, das auch im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Es wirkt auf dem Bildschirm nicht so, weil es in Schwarz/Weiß ist. Aber trotzdem bekommt man eine Ahnung vom Erfolg des Abends. Dann habe ich noch diverse andere Recitals geben, in verschiedenen Städten. Und natürlich sang ich die Desdemona in Berlin an der Deutschen Oper 1962 mit Patané. Da sang der Tenor auch auf Deutsch! Das weiß kaum jemand, dass das fürs Fernsehen aufgezeichnet wurde. Sie haben es in Italien einmal gesendet. In meiner Biografie steht das drin.

Geburtstagsparty: mit Rock Hudson/ youtube.
Die habe ich gesucht, aber sie war vergriffen… Es gab inzwischen drei oder vier Neuauflagen, weil da eine große Nachfrage ist. Aber Sie sehen: Tebaldi verkauft sich gut. Obwohl ich schon so viele Jahre nicht mehr singe, weiß man noch, wer ich bin.
Auch Ihre Aufnahmen kommen ständig neu heraus. Geben Sie einen richtigen Eindruck Ihrer Stimme? Ohne Zweifel. Damals wurden die Stimmen noch nicht künstlich lauter gemacht oder hohe Töne künstlich höher gedreht. Heute gehe ich manchmal ins Theater, und eine Sängerin, die auf Schallplatte eine Riesenstimme hat, kann man live kaum hören.
Ich fand Ihre Stimme in den Decca-Studioaufnahmen immer etwas trocken. Umso überraschter war ich, als ich Ihre Leonore aus der Forza in einer Live-Aufnahme aus Florenz hörte. Keine Studio-Aufnahme kann den Effekt meiner Stimme im Theater wiedergeben. Sie ‚rannte’ durch den Raum, bis zu den letzten Plätzen im höchsten Rang. Ich habe eine theatralische Stimme, die man überall hören konnte, egal ob ich laut oder leise sang. Die Stimme blühte auf. Man hat im Studio versucht, diesen Effekt zu rekonstruieren. Wir hatten nie – so wie heute oft üblich – das Mikro direkt vorm Mund, sondern immer weiter weg.
Zum Gebrauch des Portamento – ist das gelernt oder angeboren? Ich habe das ganz spontan gemacht. Dank der Portamenti konnte ich die Qualität des Klangs über eine ganze Phrase bewahren.

Renata Tebaldi: : „Andrea Chénier“ mit Mario Del Monaco und Renata Tebaldi, hier in der Cetra-Ausgabe
Ist das altmodisch? Das hat nichts mit old fashioned zu tun. Heute gibt es ja auch noch Sänger, die solche Portamenti machen.
Aber kaum welche… und nicht so natürlich. Ja, es wirkt bei den meisten einstudiert, künstlich. Das war es bei mir nie. Es war einfach mein Stil zu singen – der Tebaldi-Stil!
Sie haben in einem Interview gesagt, dass Konkurrenz das Geschäft belebt. An der Met, wo Sie lange sangen, waren zu der Zeit auch die Milanov…. Hat diese Sie inspiriert? Genau wie die Price hat Milanov mein Repertoire gesungen… Auch die Nilsson hat später Aida und Ballo gemacht. Aber ich hatte kaum Gelegenheit, sie zu hören, denn damals an der Metropolitan arbeitete man viel. Jeden Tag.
Sie haben eine Lieder-Platte mit Richard Bonynge gemacht. War das nicht merkwürdig, mit dem Mann einer Konkurrentin zu arbeiten? Überhaupt nicht. Ich habe mich mit Joan und Richard immer blendend verstanden. Und Maestro Bonynge ist für das Belcanto-Repertoire fantastico, weil er so voller Elan und Begeisterung ist. Er hat mir viele Stücke für mein Repertoire vorgeschlagen, denn er lebt in den Archiven und Bibliotheken. Er sucht und sucht ständig! Ich habe mit ihm auch eine zweite Schallplatte aufgenommen. Viele Sachen kannte ich gar nicht, oder es waren Dinge, die eigentlich für Klavier sind, und die er für Orchester arrangieren ließ. Später habe ich diese „Lieders“ mit Maestro Favaretto gemacht. Sie sind unser italienisches Äquivalent zu euren Liedern.
Da sind viele Juwelen bei, von Bellini, Donizetti, Verdi… bis zu Tosti, der etwas ‚romantischer’ ist. Als ich anfing, mehr Recitals zu geben – weil ich diese Atmosphäre des direkten Kontakts mit dem Publikum sehr liebte –, habe ich dieses Repertoire für mich entdeckt und ständig erweitert. Solche Liederabende sind so, als würde man im Wohnzimmer singen oder in einem Salon, es gibt nicht diese enorme Distanz zwischen Sänger und Publikum, wie im Theater. Der „mystische Graben“ (golfo mistico) des Orchesters fehlt!

Renata Tebaldi mit Luciano Pavarotti/ Decca
Aber diese Lieder sind sehr gefährlich. Sie sind fast alle in der gleichen Tonart geschrieben und sie liegen immer im Passaggio della voce, dem Übergang der Stimme. Jeder Singer muss diese Lieder für seine eigene Stimme erhöhen oder herabsetzen. Sonst macht man sich kaputt. Außerdem würde es sonst monoton werden, alles in der gleichen Höhe zu singen. Jedes Lied muss seinen eigenen Klang bekommen.
Gibt es neapolitanische Volkslieder auch für Soprane? Die einzige Aufnahme von „O sole mio“ mit Sopran, die ich kenne, ist von Rosa Ponselle. Ich selbst habe es nie gesungen, nur “ Catarin, Catarin“… (lacht)
1963 haben Sie ein Jahr pausiert, warum? Ich habe einen „break“ gemacht und alle Verträge gelöst. Ich war aus persönlichen Gründen völlig erschöpft, hatte keine Kraft und musste mich ausruhen. Ich war physisch nicht in der Lage, die Strapazen einer Opernaufführung durchzustehen. Und so wie man sein Auto manchmal für eine Weile in der Garage stellt, habe ich meine Stimme für ein Jahr weggestellt. In der Zeit habe ich jeden Tag mit einem Lehrer gearbeitet, mit einem neuen Lehrer aus Amerika. Damals lebte ich fast das ganze Jahr in Amerika und kam nur zu großen Familien-Festen zurück nach Italien. Ich habe fast jeden Tag Vokalisen gemacht und meine Rollen durchgenommen. 1964 kam ich dann mit neuer Kraft in Philadelphia zurück und habe alle meine alten Rollen wieder aufgenommen.
Haben Sie ihr Repertoire verändert? Durch das tägliche Studium und auch durch die Reife, die mit den Jahren automatisch kommt, habe ich auch schwerere Rollen wie die Gioconda und Minnie aus der Fanciulla.wieder machen können. Das hätte ich mir am Anfang meiner Laufbahn nie träumen lassen, dass ich einmal da ankommen würde. Aber meine Bruststimme war inzwischen so gestärkt, dass ich mich an diese beiden Opern heranwagen konnte. Und sie sind so wunderbar…!

„Bohème“ mit Renata Tebaldi und Renato Cioni an der Met/OBA
Haben Sie auch sonst Unterricht genommen in all den Jahren? Ich hatte in Amerika einen Lehrer, aber nur einen einzigen. Je weniger man wechselt, umso besser ist es. Sonst wird man verrückt, weil einem jeder eine andere Technik beibringen will. Und der ständige Wechsel ist nicht gut für die Stimme. Man verliert den Weg.
Hatten Sie eine Lieblingsrolle? Alle Rollen, die ich gesungen habe, habe ich auch geliebt. Man sollte niemals eine Partie übernehmen, mit der man eigentlich nichts anfangen kann. Das ist Quatsch! Besonders stolz war ich auf meine Gestaltung des 1. Akts der Traviata, denn der ist für einen Sopran wie mich schwierig. Ich habe das in Mailand gesungen, aber nur ein Mal. Die Generalprobe lief wunderbar, ich sang wie ein Engel. Aber nebenher sang ich mit de Sabata auch noch das Verdi-Requiem. Wegen des großen Erfolgs mussten wir eine zusätzliche Aufführung einschieben. Und die war kurz vor meiner Violetta-Premiere. Ich war erkältet, müde, geschwächt und wurde immer nervöser. Und wenn die Nerven einen verlassen – was mir Gott sei Dank selten passierte! – dann ist sowieso alles aus. Darum war die Premiere eine Katastrophe. Leider wurde die Genralprobe nicht aufgezeichnet.
Mussten Sie sich schonen während Ihrer Karriere? Schon drei, vier Tage vor einer Aufführung ging ich nicht mehr aus dem Haus. Ich war da sehr strikt mit mir selbst, denn es kann so viel passieren, worauf man keinen Einfluss hat. Es reicht ein Augenblick der Unaufmerksamkeit und schon hat man eine Erkältung.

Brescia Teatro Grande: Poster „Tosca“ mit Renata Tebaldi/ Foto Knaebel
Wird man da nicht verrückt, wenn man immer an die Stimme denken muss? Ich dachte eigentluch mehr an die Inszenierungen, wie ich mich bewegen musste und wie der Ablauf der Regie war. Um das alles zu behalten, muss man ausgeruht und geistesgegenwärtig im Theater erscheinen. Ansonsten ist die größte Angst die Angst vor Erkältungen. Aber natürlich sind wir alle Sklaven unserer Stimme. Als ich 1976 aufhörte zu singen, fühlte ich mich von einer großen Verantwortung befreit. Damals gab ich ein Konzert für die Erdbebenopfer von Friuli an der Scala.
Wussten Sie, dass es Ihre letzte Aufführung sein würde…? Meine Bühnenkarriere hörte 1973 an der Met auf, mit zwei Vorstellungen von Otello und zwei von Falstaff. Danach habe ich keine Engagements mehr angenommen für Opern. Das wird auch irgendwann langweilig, immer wieder Tosca, Desdemona, Violetta usw. zu singen. Man kommt von ganz allein an einem Punkt an, wo man keine Lust mehr hat, das immer wieder zu wiederholen.
Sie haben aber keine Abschiedstournee gemacht? (lacht) Nein. Ich fing im Theater an, als niemand wusste, wer ich war. Und ich hörte auf, ohne das jemand wusste, dass es die letzte Vorstellung sein würde. Es gibt ja Sänger, die ewig Abschieds-Vorstellungen in der ganzen Welt geben und heute immer noch singen!
Nach dem Konzert für die Erdbebenopfer ergab sich das irgendwie von selbst. Ich hatte viele Städte öfter besucht, um da zu singen. Und jedes Mal, wenn ich wieder hinkam, musste ich ein neues Programm zusammen stellen. Irgendwann wollte ich keine neuen Stücke mehr einstudieren mit Maestro Müller, meinem Pianisten. Also nahm ich keine neuen Engagements an. Und ich entdeckte ein traumhaftes Leben… eine Befreiung. Keine Sorgen mehr um die Stimme, das Publikum. Und nun wohne ich in Mailand, eigentlich immer schon. Ansonsten hatte ich ein Apartment in New York. Denn ich hasse es, im Hotel zu wohnen, egal wie gut die Hotels gerade in New York sind. Ich brauche mein eigenes Zuhause.
 Ich stamme aus Pesaro, wo mein Vater herkommt. Meine Mamma ist jedoch aus Parma. Als ich fünf oder sechs Monate alt war, sind wir dorthin zurück gezogen, weil sich meine Eltern getrennt hatten. In Parma besuchte ich das Arrigo Boito Konservatorium und studierte Klavier – das war der Wunsch meiner Mutter. Erst von dort wechselte ich später ans Konservatorium von Pesaro und zum Gesang.
Ich stamme aus Pesaro, wo mein Vater herkommt. Meine Mamma ist jedoch aus Parma. Als ich fünf oder sechs Monate alt war, sind wir dorthin zurück gezogen, weil sich meine Eltern getrennt hatten. In Parma besuchte ich das Arrigo Boito Konservatorium und studierte Klavier – das war der Wunsch meiner Mutter. Erst von dort wechselte ich später ans Konservatorium von Pesaro und zum Gesang.
Warum wollten Sie eigentlich Sängerin werden? Es machte mir einfach Spaß. Ich habe als Kind immer in der Kirche die Soli gesungen – Weihnachten, Ostern, an Festtagen. Ich sang auch zuhause beim Bügeln immer mit, wenn ich Musik im Radio hörte – zur Stimme von Toti dal Monte zum Beispiel, die ja überhaupt nichts mit meinem eigenen späteren Stimmfach zu tun hat. Aber ich sang auf diese Weise auch mit Gigli oder Tito Schipa. Sie waren eigentlich meine Vorbilder, damals. Und die Leute auf der Straße, die meine Stimme durchs offene Fenster hörten, sagten: „Was für eine Stimme! Die müssen Sie ausbilden lassen.“ Sogar meine Klavierlehrerin sagte das. Sie sorgte auch dafür, dass ich heimlich zu jemandem gehen konnte, der meine Stimme beurteilen sollte. Nach einer Kalvierstunde sind wir also zu einem Gesangslehrer gegangen, der hörte sich meine Stimme an und sagte: „Das ist ein außergewöhnliches Stimmmaterial. Damit muss man etwas machen.“ Aber ich wusste nicht, wie ich das meiner Mutter beibringen sollte. „Mach dir keine Sorgen, darum kümmere ich mich“, sagte daraufhin meine Klavierlehrerin.
Meine Mutter wollte mich nicht singen lassen. Sie fürchtete, eine Bühnenlaufbahn wäre mein moralischer Untergang, denn ihrer Meinung wären alle Mädchen verloren, sobald sie einen Fuß auf die Bühne setzten. Alle! „Renata ist ein Mädchen so einfach wie Wasser und Seife“, sagte sie immer wieder. „Wer soll sie im Bühnenbetrieb beschützen – wo sie doch keinen Vater hat?“
 Meine Klavierlehrerin brachte mich nach Pesaro zu Carmen Melis, der Sängerin. Eine stupende Frau. Der habe ich vorgesungen und sie sagte: „Also, wenn du keine Karriere machst, weiß ich nicht, wer es sonst schaffen sollte.“ Um auch meine Mutter davon zu überzeugen, organisierte sie ein Vorsingen bei Maestro Zandonai, dem Komponisten der Francesca da Rimini. Er war damals Direktor des Konservatoriums. Ich ging mit meiner Mutter zu ihm, er setzte sich selbst ans Klavier und spielte, ich sang La Wally und Butterfly, die ich schon mit der Melis studiert hatte. Irgendwann, mitten in der Musik, hörte er auf zu spielen, drehte sich zu meiner Mutter und sagte: „Hören Sie, Signora. Wenn Sie Ihre Tochter nicht Sängerin werden lassen, begehen Sie ein großes Sakrileg gegen die Kunst! Solch eine Stimme gibt es nur alle 50 Jahre, wenn überhaupt.“ Diese Worte aus dem Mund eines so großen Komponisten haben meine Mutter schließlich umgestimmt. Und das war der Beginn meiner Sängerlaufbahn. Damals war ich 18 oder 19.
Meine Klavierlehrerin brachte mich nach Pesaro zu Carmen Melis, der Sängerin. Eine stupende Frau. Der habe ich vorgesungen und sie sagte: „Also, wenn du keine Karriere machst, weiß ich nicht, wer es sonst schaffen sollte.“ Um auch meine Mutter davon zu überzeugen, organisierte sie ein Vorsingen bei Maestro Zandonai, dem Komponisten der Francesca da Rimini. Er war damals Direktor des Konservatoriums. Ich ging mit meiner Mutter zu ihm, er setzte sich selbst ans Klavier und spielte, ich sang La Wally und Butterfly, die ich schon mit der Melis studiert hatte. Irgendwann, mitten in der Musik, hörte er auf zu spielen, drehte sich zu meiner Mutter und sagte: „Hören Sie, Signora. Wenn Sie Ihre Tochter nicht Sängerin werden lassen, begehen Sie ein großes Sakrileg gegen die Kunst! Solch eine Stimme gibt es nur alle 50 Jahre, wenn überhaupt.“ Diese Worte aus dem Mund eines so großen Komponisten haben meine Mutter schließlich umgestimmt. Und das war der Beginn meiner Sängerlaufbahn. Damals war ich 18 oder 19.
Ihr Debüt? Als Elena in Mefistofele. Das ist für eine Anfängerin besser, denn man muss sich nicht so viel bewegen, es ist auch ein kurzer Part. Es kann nicht soviel schief gehen und man kann sich ganz auf die Stimme konzentrieren. In Rovigo 1944. Das war damals eine schwere Zeit, so mitten im Krieg. Ich musste mit dem Zug dorthin fahren, alle Stationen waren ausgebrannt, dauernd ging der Bombenalarm los und wir mussten die Proben unterbrechen. Aber wir haben irgendwie doch vier Vorstellungen hinbekommen und man schrieb sofort sehr positiv über mich. Danach war erst einmal totaler Stillstand im ganzen Land. Denn alles was sich bewegte, wurde sofort bombardiert. Es gab also auch keine Opernaufführungen – nirgendwo. Ich habe also in Parma im Teatro Regio, was nicht so weit weg war von Pesaro, eine Mimi gesungen. Und auch L’amico Fritz. Alles noch im Krieg. Das war sehr gefährlich, denn es hätte jede Sekunde eine Bombe fallen können. Aber wir hatten Glück, es passierte nichts. Wir waren damals alle sehr jung und kannten keine Furcht – auch nicht stimmlich.

ARTE-Sendung „Die großen Musikrivalen Callas vs. Tebaldi“, Archivfoto Maria Callas (li.) und Renata Tebaldi (Mi.) mit Rudolf Bing (re.) © Christoph Valentien. Foto: ZDF, „Bild: Sendeanstalt/Copyright“.
Hatten Sie schon ein Repertoire? Natürlich. Ich hatte mit Carmen Melis die Desdemona einstudiert, Margerita aus Mefistofele und Andrea Chénier. Sie hat mich auch die Aida lernen lassen, hat aber mit dem letzten Akt angefangen und sich dann langsam vorgearbeitet. Denn der letzte Akt war für meine Stimme damals viel leichter zu singen als der dramatische erste mit „Ritorna vincitor“. So bin ich da ganz natürlich hinein gewachsen.
Wie fühlt man sich, wenn man das singt? Wie im Himmel, man vergisst wirklich alles drum herum. Verdi-Heroinen sterben ja fast alle auf diese musikalisch überirdische Weise (denken Sie an La forza del destino), während bei Puccini die Charaktere doch mehr mit den Füßen auf dem Boden stehen.
Haben Spitzentöne eine erotische Komponente? Im acuto ist nichts Sinnliches! Nein, nein. Spitzentöne sind eine mysteriöse Sache. Man steuert die Stimme dorthin, wo sie hin muss. Aber man weiß nie genau, was dann eigentlich passiert. Der acuto ist wie ein Sprung ins Nichts… man weiß nie, wo man landet. Man kann schlecht springen und manchmal gut. Als Tosca muss man dauernd diese hohen Cs raus schleudern, ohne Vorbereitung, einfach so. Verdi macht das eleganter. Er baut die Spitzentöne immer in Phrasen ein, isoliert sie nicht. Aber Puccini…
Hatten Sie manchmal Angst vor diesen Tönen? Wenn dieser Sprung nach oben schief geht, ist es ein Schock. Keine Frage. Aber nichts Sinnliches. Das ergibt sich aus dem Legato, aus dem Verströmen in der Mittellage, wo der ganze Unterleib vibriert – besonders bei Puccini. Wenn jemand Puccini nicht mit Sinnlichkeit singen kann, sollte er sowieso die Finger davon lassen.
 Wie ist Ihr Verhältnis zu Tenören? Ich finde, dass sie die wahren Primadonnen sind. Wir stehen in der zweiten Reihe. Sie machen mehr Capricen als Frauen. Aber ich hatte nie ein Problem mit einem Tenor.
Wie ist Ihr Verhältnis zu Tenören? Ich finde, dass sie die wahren Primadonnen sind. Wir stehen in der zweiten Reihe. Sie machen mehr Capricen als Frauen. Aber ich hatte nie ein Problem mit einem Tenor.
Kann Oper heute noch diese Faszination von früher auf junge Leute ausüben? Also, jetzt muss ich ganz ehrlich sein: Die Menschen gingen früher in die Oper, um die großen Stars zu hören, die großen Persönlichkeiten, von denen es damals viele gab. Heute existieren die großen Namen nicht mehr. Und die Theater müssen dieses Vakuum ersetzen mit aufwendigen Inszenierungen, visuellen Effekten. Schauen Sie sich die Inszenierungen an der Scala an, die Riccardo Muti leitet – das sind visuelle Superschlachten. Aber die Sänger… bemerkt sie jemand? Ich war nie besonders ehrgeizig, und den Applaus der Bühne brauchte ich auch nicht unbedingt. Deshalb fiel es mir auch nicht so schwer, mich von der Bühne zu verabschieden. Aber noch heute sprechen mich Menschen auf der Straße an und bedanken sich bei mir für die schönen Stunden, die ich ihnen bereite habe. Und das freut mich schon. Man hat mich nicht vergessen.
Jeder muss sich seine eigene Technik zurecht legen, einen Stimmklang entwickeln, der mit niemand anderem verwechselt werden kann. Man muss nach den ersten Tönen sagen können: „Ah, das ist die Tebaldi! Oder das ist die Sutherland! Die Nilsson.“ Das hört man schon an der Art, wie man singt.
Wie unterscheidet sich eine Diva von einer guten Sängerin? Mir hat man immer gesagt, ich wäre eine Diva. Dabei habe ich mich nie so gefühlt. Diven machen Probleme, wollen immer eine Extrawurst, sind schwierig. Das war ich nie. Und doch haben mir viele Freunde gesagt: „Renata, du bist eine geborene Diva!“ Ich wollte das nicht hören, aber scheinbar war es doch so… Ich hatte das in meiner Persönlichkeit, wie ich mich bewegte, wie ich ins Theater kam. Man sagte: „La Diva!“ Die Sänger von heute haben doch großes Glück. Sie haben das Fernsehen und ihre Plattenfirmen, die für sie Publicity machen. Als ich anfing, hatte ich nichts. Ich musste mir alles selbst erarbeiten.
Würde Sie denn gern heute Ihre Karriere noch einmal anfangen wollen? Auf keinen Fall. Es ist alles so anders geworden, alles muss so schnell gehen, sofort. Wir haben uns damals viel mehr Zeit gelassen, um eine Karriere aufzubauen. Heute ist eine Karriere fast eine politische Sache – ausgehandelt von Agenten, Besetzungschefs, Kontakten. Das würde mich anekeln.

Renata Terbaldi: Foto Session für Decca im Kostüm der Tosca/Decca
Die drei Tenöre Domingo, Pavarotti und Carreras haben mnit ihren Konzerten neue Maßstäbe gesetzt. Hätten Sie gern bei den drei Sopranen mitgemacht – Milanov, Tebaldi und Callas? Daran hat damals niemand gedacht. Ich habe in Stadien gesungen, in den USA, vor 10.000 Menschen. Aber alleine. Heute werden diese Konzerte bis zum Abwinken wiederholt, es gibt die Tassen und T-Shirts dazu. Das ist doch nur noch Business… keine Kunst.
Aber viele Menschen lieben es. Ich habe das erste Konzert auch gesehen und ich muss sagen, ich fand es sehr schön. Es hat viele Menschen erreicht und für diese Musik begeistert. Aber was später daraus wurde, finde ich nicht gut. Sie haben es jedoch sehr clever ausgemolken.
Unterrichten Sie? Nein, ich habe das mal in Busseto probiert, als mich Carlo Bergonzi einlud amerikanische Mädchen der Chicago Foundation zu unterrichten. Ein paar Semiare habe ich auch gegeben, z.B. am Mozarteum in Salzburg, wo ich mit einer Japanerin die Desdemona arbeitete. Aber das hat mich sehr ermüdet, und darum mache ich es nicht mehr. Viele der Soprane hatten wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und damit will ich nicht meine Zeit verschwenden.

Schwärmt für Renata Tebaldi: Autor und Operettenchampion Kevin Clarke/Foto ORCA
Haben Sie Opfer für die Karriere bringen müssen? Mein ganze Karriere war ein Opfer – dass ich mein Zuhause verlassen musste, von einem Hotel zum nächsten zog, wie eine Zigeunerin. Aber das wird kompensiert durch die vielen aufregenden Eindrücke, die man macht an den verschiedenen Orten. Zum Beispiel in Amerika.
Gefiel Ihnen das Leben in den USA? Ich habe mich da sehr schnell eingelebt. Man arbeitete an der Met mit Mr. Bing wie in einem Soldaten Camp. Aber es war wunderbar. Alle Großen der Zeit waren damals da. Und alle wurden gleich behandelt.
Für mich waren die USA auch eine Befreiung. Ich bin sehr groß, und in Italien hatte ich deswegen einen Komplex. Ich zog mich immer dunkel an, damit man das nicht so merkte. Aber als ich in Amerika sah, wie sich die Frauen da kleiden, habe ich mich völlig verändert. In Italien ist man in puncto Kleidung sehr klassisch, sehr seriös. In Amerika ist alles freier. Als ich ankam, habe ich sofort meine Haarfarbe geändert. Vorher war ich braun, danach rot. Und ich schminkte mich, wie die amerikanischen Frauen. Man lebte dort in New York auch wunderbar. Meine Mutter ging mit mir Downtown shoppen… und in Little Italy Kaffee trinken. Es war eine tolle Zeit! (Foto oben Decca)


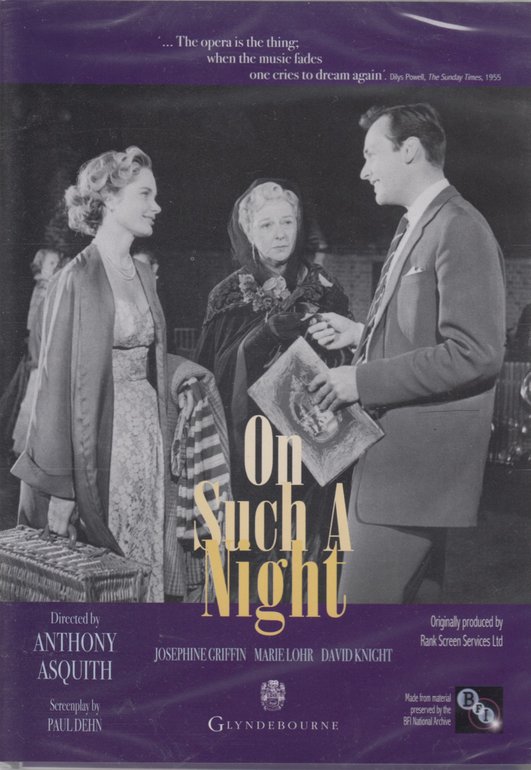








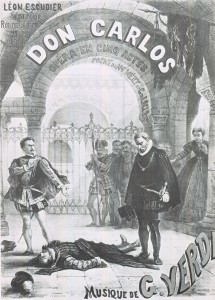



















 Nach dem mit Vorzug beendeten Studien in Pesaro im Jahre 1902, fuhr Hatze nach Wie um die deutsche Musik kennen zu lernen. Er schlug das Angebot dort zu bleiben ab und kam zurück nach Split, wo er komponierte und die jungen Generationen bildete, und nahm die Leitung des damals grössten Sängerchors in Dalmatien, Zvonimir, das eine sehr wichtige Rolle in der Entwicklung des Kulturlebens in der Stadt spielte, an. Ferner war er Dirigent der Musikalischen Gesellschaft Guslar, Lehrer an der Musikschule, wo er einige Sänger, die das Opernleben der Stadt Splir trugen, erzog. Er publizierte auch eine Reihe von Handschriften über die Theorie der Musik. Das Klima aus dem er kam, das Studium im Lande des Belcanto, bei dem Komponist der ersten veristischen Oper, haben Hatze zu einem ausgesprochen vokalen Komponisten geformt.
Nach dem mit Vorzug beendeten Studien in Pesaro im Jahre 1902, fuhr Hatze nach Wie um die deutsche Musik kennen zu lernen. Er schlug das Angebot dort zu bleiben ab und kam zurück nach Split, wo er komponierte und die jungen Generationen bildete, und nahm die Leitung des damals grössten Sängerchors in Dalmatien, Zvonimir, das eine sehr wichtige Rolle in der Entwicklung des Kulturlebens in der Stadt spielte, an. Ferner war er Dirigent der Musikalischen Gesellschaft Guslar, Lehrer an der Musikschule, wo er einige Sänger, die das Opernleben der Stadt Splir trugen, erzog. Er publizierte auch eine Reihe von Handschriften über die Theorie der Musik. Das Klima aus dem er kam, das Studium im Lande des Belcanto, bei dem Komponist der ersten veristischen Oper, haben Hatze zu einem ausgesprochen vokalen Komponisten geformt.