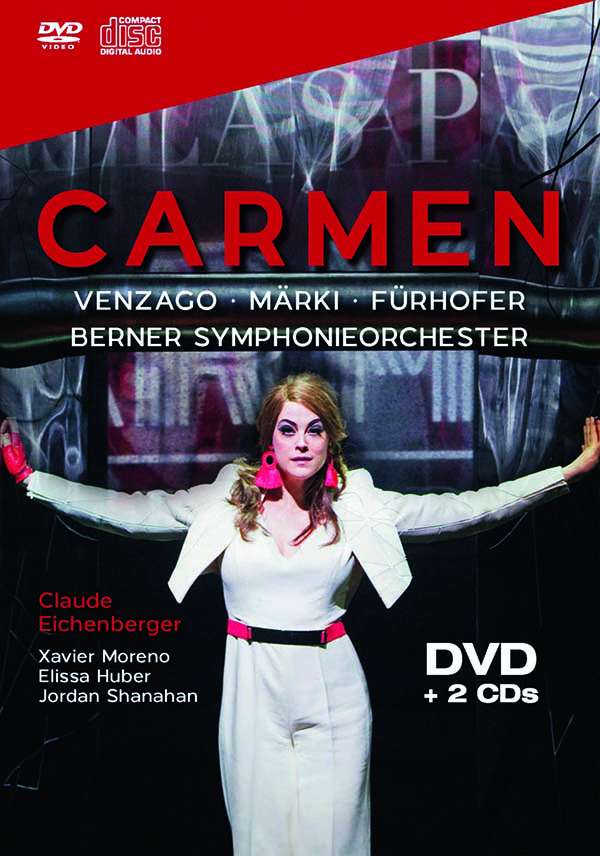Mehr noch als im vergangenen Berlioz-Gedenkjahr wirft 2020 der Klassik-Gigant Ludwig von Beethoven (getauft 17. Dezember 1770 in Bonn, Kurköln, gestorben am 26. März 1827 in Wien, Kaisertum Österreich) seinen gewaltigen Schatten über uns. Und wir werden uns nun der Neuaufnahmen und Wiederauflagen oder Gesamtausgaben nicht erwehren können. Wir richten also ähnlich wie für den Kollegen Berlioz eine Sammelseite für Beethoven ein, auf der wir nach Eingang die von operalounge.de besprochenen Einspielungen vorstellen (die Sinfonien und die Gesamtausgaben-Boxen behandeln wir gesondert): Die Auswahl ist eklektisch, je nach Vorliebe der Redaktion und der Rezensenten. Und gar nicht vollständig, aber das kennen unsere Leser ja. Auf also zum Kampf durch die Fülle.
 Dass 2020 das große Beethoven-Jahr hätte werden sollen, trat selbst bei eingefleischten Klassik-Hörern einigermaßen in den Hintergrund. Die Tonträgerindustrie hatte freilich vorgesorgt, so dass der Markt erwartbar mit weiteren Aufnahmen überschwemmt werden konnte, darunter komplette Neueinspielungen, ob einzelne Sinfonien oder gesamte Zyklen. Das Königliche Concertgebouw-Orchester Amsterdam, welches in einem Ranking der weltbesten Orchester auf den ersten Platz gewählt wurde, hat sich anlässlich des Beethoven-Jubiläums zu keiner weiteren Neuaufnahme entschlossen, sondern einen Blick in sein umfangreiches Tonarchiv geworfen. Das Ergebnis ist ein „Patchwork-Zyklus“ der neun Sinfonien, allesamt live im Amsterdamer Concertgebouw im Konzert mitgeschnitten, welcher nun in einer 5-CD-Box im typischen Concertgebouw-Design erscheint (RCO 19005). Es wird ein Zeitraum von über vier Jahrzehnten abgedeckt, nämlich die Jahre zwischen 1978 und 2010. Überraschend ist, dass nur ein einziger Chefdirigent des Concertgebouw-Orchesters, nämlich der im letzten Jahr verstorbene Mariss Jansons, vertreten ist. Ansonsten handelt es sich also ausschließlich um Gastdirigenten, was die Sache im Grunde genommen sogar spannender macht.
Dass 2020 das große Beethoven-Jahr hätte werden sollen, trat selbst bei eingefleischten Klassik-Hörern einigermaßen in den Hintergrund. Die Tonträgerindustrie hatte freilich vorgesorgt, so dass der Markt erwartbar mit weiteren Aufnahmen überschwemmt werden konnte, darunter komplette Neueinspielungen, ob einzelne Sinfonien oder gesamte Zyklen. Das Königliche Concertgebouw-Orchester Amsterdam, welches in einem Ranking der weltbesten Orchester auf den ersten Platz gewählt wurde, hat sich anlässlich des Beethoven-Jubiläums zu keiner weiteren Neuaufnahme entschlossen, sondern einen Blick in sein umfangreiches Tonarchiv geworfen. Das Ergebnis ist ein „Patchwork-Zyklus“ der neun Sinfonien, allesamt live im Amsterdamer Concertgebouw im Konzert mitgeschnitten, welcher nun in einer 5-CD-Box im typischen Concertgebouw-Design erscheint (RCO 19005). Es wird ein Zeitraum von über vier Jahrzehnten abgedeckt, nämlich die Jahre zwischen 1978 und 2010. Überraschend ist, dass nur ein einziger Chefdirigent des Concertgebouw-Orchesters, nämlich der im letzten Jahr verstorbene Mariss Jansons, vertreten ist. Ansonsten handelt es sich also ausschließlich um Gastdirigenten, was die Sache im Grunde genommen sogar spannender macht.
Den Anfang macht die aktuellste der enthaltenen Aufnahmen: Ein Konzertmitschnitt der ersten Sinfonie unter dem amerikanischen Dirigenten David Zinman vom 9. Juni 2010. Voranstellen sollte man, dass Zinmans Zyklus für Arte Nova Ende der 1990er Jahre für einiges Aufsehen sorgte, sehr gute Bewertungen einheimste und als vielleicht sogar die Aufnahme fürs nächste Jahrtausend galt. Wenig ist von der Euphorie von vor zwanzig Jahren geblieben. Der Zyklus wurde später zwar bei Sony neu aufgelegt, ist aber auch dort bereits wieder vergriffen. Fast hat es den Eindruck, als spräche heute niemand mehr von Zinman, wenn es um Beethoven geht. Dass dennoch mehr dran war als ein kurzfristiger Milleniums-Hype, beweist diese Live-Aufnahme eindrücklich. Mit einer überzeugenden Mischung aus Frische und Ernsthaftigkeit geht Zinman die Sache an und überzeugt im Ergebnis über die Maßen. Vielleicht sind es gerade diese Interpretationen der frühen Beethoven-Sinfonien, die eben nicht im Zuge einer Gesamtaufnahme gleichsam zwingend entstehen, sondern ganz bewusst aufs Konzertprogramm gesetzt werden.
Es schließt sich auf derselben ersten CD, gleichsam als Kontrast, die älteste inkludierte Einspielung an, Sinfonie Nr. 2 unter dem ebenfalls aus den USA stammenden Leonard Bernstein vom 8. März 1978. Interessehalber sei erwähnt, dass an diesem Tage auch die Eroica gespielt wurde, die hier leider nicht berücksichtigt werden konnte, wohl auch, um keinen der berücksichtigten Dirigenten herauszuheben. Dass Bernstein die Zweite von Beethoven auch außerhalb eines Zyklus aufführte, beweist seine Wertschätzung dieses Werkes, das die konsequente Weiterentwicklung nach dem sinfonischen Erstling darstellt und mittlerweile bereits als großer Schritt in Richtung Eroica aufgefasst wird. So unterstreicht Bernsteins hochromantische Lesart gleichsam diese Einordnung und stellt fraglos eines der absoluten Highlights dieser Kassette dar. Groß angelegt und ohne falsche Zurückhaltung lässt er die zweite Sinfonie erstrahlen und übertrifft womöglich sogar noch seine ungleich berühmtere Einspielung mit den Wiener Philharmonikern (DG).

Hollands Glorie: das ehrwürdige Concertgebouw Orkest/ pressphoto Concertgebouw
Die zweite CD startet sodann mit der tatsächlich enthaltenen Eroica unter Nikolaus Harnoncourt vom 16. Oktober 1988. Man sollte hinzufügen, dass Harnoncourt zu dieser Zeit einer der bevorzugten Gastdirigenten des Concertgebouw-Orchesters war und zahlreiche Einspielungen mit demselben vorgelegt hat, die allesamt ein hohes künstlerisches Niveau auszeichnet. So nimmt es nicht wunder, dass auch die dritte Sinfonie von Beethoven eine eindringliche Wiedergabe erfährt. Freilich ist der Zugang ein völlig anderer als bei Bernstein, nüchterner und klassizistischer, ohne ins allzu Akademische abzugleiten. Es ist erstaunlich, wie problemlos sich das tadellos aufspielende Concertgebouw-Orchester den jeweiligen, häufig sehr unterschiedlichen Vorstellungen der Dirigenten anzupassen in der Lage ist. Andererseits darf man genau dies vom angeblich weltbesten Orchester auch erwarten.
Das Gros der Aufnahmen in der Box entstammt dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. So auch der sich ebenfalls auf der zweiten Compact Disc befindliche Mitschnitt der vierten Sinfonie vom 19. September 2003 unter der musikalischen Leitung von Herbert Blomstedt. Dieser legte zwei komplette Zyklen der Beethoven-Sinfonien vor, den ersten in den 1970er Jahren mit der Staatskapelle Dresden (Eterna), den zweiten hochbetagt vor wenigen Jahren mit dem Gewandhausorchester Leipzig (Accentus). Die vorliegende Live-Aufnahme datiert zeitlich also dazwischen, ist interpretatorisch aber schon näher an seiner heutigen Beethoven-Auffassung, die in ihrer Ausprägung etwas Norddeutsches hat, das an Günter Wand seligen Angedenkens erinnert. Stringent und ohne Mätzchen, aber auch nicht in puritanischer Askese verkommend, erzeugt sie Hörspaß.
Bei der fünften Sinfonie schließlich, die sich auf der nächsten Disc befindet, tritt der damalige Chefdirigent Mariss Jansons ins Zentrum. In diesem Mitschnitt vom 29. Mai 2008 bezeugt er abermals , weswegen er seinerzeit zurecht gleich zwei Spitzenorchestern vorstand: neben den Amsterdamern ja auch noch dem Bayerischen RSO in München. Es ist ein Beethoven der Mitte, die Extreme vermeidend und doch nicht zur 08/15-Aufführung degradiert, so dass die Inklusion nachvollziehbar erscheint und diese Aufnahme sicher nicht aus Verlegenheit, sondern mit Überzeugung zum Zuge kam. Gleichwohl, ein Blick ins Konzertarchiv des Orchesters zeigt, dass sich etwa auch ein Mitschnitt unter dem greisen Carlo Maria Giulini vom März 1996 angeboten hätte.

Über Geschmack kann man sich streiten – aber das Concertgebouw zählt zu den besten Tonhallen der Welt/ Wikipedia
Hinsichtlich der Pastorale, die sich die dritte CD mit der Fünften teilt, kommt ein Dirigent zum Zuge, der umstritten ist wie wenige andere: Roger Norrington. Am 7. Oktober 2004 mitgeschnitten, erkennt man die ihm ureigene vibratoarme Interpretation, die starke Einflüsse der historisch informierten Aufführungspraxis zeigt. Trotz aller Einwände hat diese Beethoven’sche Sechste unter Norringtons Dirigat gewiss ihre Momente. Das eindrückliche Schlagwerk kommt im Gewitter-und-Sturm-Satz voll zur Geltung. Es ist immer wieder spannend zu hören, wie sich ein solcher Klangkörper der Weltklasse wie das Königliche Concertgebouw-Orchester wirklich jedem Dirigentenstil anzupassen vermag.
Für manch einen der heimliche Kaufgrund dürfte die siebte Sinfonie unter Carlos Kleiber vom 20. Oktober 1983 darstellen, welche CD Nr. 4 einleitet. Eine wirkliche Ersterscheinung ist es allerdings nicht, handelt es sich doch um die Tonspur eines Unitel-Films, der (zusammen mit der Vierten) bereits auf einer Philips-DVD zu haben war. Nun ist die Erwartungshaltung im Falle des jüngeren Kleiber ungemein hoch. Es handelt sich gewiss um eine tänzerisch-beschwingte Wiedergabe, wie man sie bei diesem Dirigenten erwartet. Sie übertrifft die in gewissen Kreisen zum Maß aller Dinge erklärte, etwas sterile DG-Studioeinspielung, die nicht an die fast zeitgleich entstandene, ganz späte Decca-Produktion unter Leopold Stokowski heranreicht – noch immer ein verkannter Geheimtipp. Kleiber junior baut einen solchen Hochdruck auf, so dass seine Siebente durchgehend rastlos erscheint. Eine mögliche, keinesfalls die allein seligmachende Lesart.
Bei der Achten, die die vierte Disc beschließt, steht mit Philippe Herreweghe ein anerkannter Spezialist für Alte Musik am Dirigentenpult, der indes auch schon bis ins 19. Jahrhundert vorgedrungen ist und sogar eine vollständige Beethoven-Sinfonien-Einspielung vorgelegt hat, die von der Kritik gefeiert wurde (Pentatone). Ein wenig ist man bei diesem Live-Mitschnitte der achten Sinfonie vom 5. Oktober 2003 allerdings enttäuscht, stellt sich der große Aha-Effekt doch nicht unmittelbar ein. Was dieses noch immer unterschätzte Meisterwerk angeht, darf auf die klassische Einspielung des greisen Bruno Walter hingewiesen werden (Columbia), die in gewisser Hinsicht noch immer das A und O darstellt.
Den Abschluss muss die neunte Sinfonie bilden, bei welcher auf einen Mitschnitt unter dem ungarisch-amerikanischen Dirigenten Antal Doráti vom 28. April 1985 zurückgegriffen werden konnte. Wer die Vita Dorátis kennt, wird die Aufnahme als unter die letzten dieses Orchesterleiters einordnen können, der damals bereits im achtzigsten Lebensjahre stand. Von einer Altersmilde ist indes keine Spur, ist sein Zugriff doch beherzt und zeigt keine Ermüdungserscheinungen. Das Solistenquartett ist nicht übermäßig prominent und mehr gediegen als wirklich herausragend: Roberta Alexander (Sopran), Jard von Nes (Mezzosopran), Horst Laubenthal (Tenor) sowie – etwas pauschal – Leonard Mróz (Bass). Unterstützt wird die vokale Seite durch den sehr gut aufgelegten Chor des Concertgebouw-Orchesters. Klanglich handelt es sich allerdings um die vergleichsweise schwächste Aufnahme, die nicht durch übermäßige Brillanz punkten kann, jedoch freilich bereits (wie der Rest) in Stereophonie vorliegt. Insgesamt war es wohl ein Anliegen dieser Veröffentlichung, ausschließlich Stereoaufnahmen zu berücksichtigen.
In der Summe lässt sich also eine starke Empfehlung mit einigen wenigen Einschränkungen aussprechen. Die Box lohnt sich bereits allein aufgrund der enthaltenen Bernstein-Aufnahme, die jede Sammlung bereichert. Unterstrichen wird der positive Eindruck durch die kundigen, gar viersprachig (Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch) vorliegenden Einführungstexte von Bas von Putten. Daniel Hauser
Obwohl das große Jubiläumsjahr anlässlich des 250. Geburtstages – am Ende 2020 gesehen – anderweitig schmerzlich überlagert wurde, herrschte kein Mangel an Neuerscheinungen in Sachen Beethoven-Aufnahmen. Harmonia Mundi denkt in seiner sogenannten 2020/2027 Harmonia Mundi Edition bereits weiter, plant man doch offenbar eine Serie, die sich bis zum 200. Todestag Beethovens, den wir erst 2027 Jahren begehen werden, erstrecken soll. Weitere Neuveröffentlichungen stehen jedenfalls bereit, vom geneigten Hörer in Betracht gezogen zu werden.
 Aus Malmö: Beethovens Sinfonien mit Robert Trevino und dem Malmö Symphony Orchestra bei Ondine. Großartiger kann man nicht einsteigen. Nicht auf dem CD-Markt, nicht auf dem Konzertpodium. Nicht einfach nur ein oder zwei Beethoven-Sinfonien, sondern gleich alle neun bildeten den Auftakt der Zusammenarbeit des Malmö Symphony Orchestra und seines im Oktober 2019 neugekürten Chief Conductor Robert Trevino. Die Tinte unter dem Vertrag war kaum getrocknet, als Orchester und Dirigent ihre Partnerschaft im gleichen Monat im Rahmen eines Beethoven-Festivals mit allen neun Sinfonien an vier Abenden besiegelten und im Konserthus live aufnahmen. Für Trevino ist es zwar nicht das CD-Debüt aber immerhin der Einstand bei Ondine, die die fünf CDs in aparter Klappbox und englischem Beiheft samt Interview mit dem Dirigenten herausbrachten (ODE 1348-5Q). Nach Ádám Fischers Aufnahme aus Kopenhagen ist diese von der schwedischen Seite des Öresund stammende Aufnahme der zweite skandinavische Beethoven-Zyklus im Jubiläumsjahr. „The spirit of Beethoven“, den Trevino verspürte, als er erstmals die Fünfte dirigierte, vermittelt sich dem Hörer, der unwillkürlich nach dem Sinn dieser Aufnahme fragen wird, bei den beiden ersten Sinfonien noch nicht. Die erste birgt noch die Welt von Haydn und Mozart, die zweite ist, laut Trevino, „a statement of intent“, doch auf mich wirken die Aufnahmen trotz schöner Momente mit den Holzbläsern und fein empfundenen romantischen Stimmungen, uninteressant, werden im Verlauf immer langweiliger, und das hat nichts mit dem – gegenüber Fischer – durchgehend etwas längeren Spieldauern zu tun (die dritte und vierte auf einer CD mit 85 Minuten Spieldauer). Hier tasten sich Dirigent und Orchester mehr aneinander als an die Welt der Wiener Klassik heran. Der 36jährige Amerikaner mexikanischer Abstammung – eigentlich Treviño – der neben dem schwedischen Chefposten auch den beim Baskischen Nationalorchester in San Sebastián innehat, Opern am Bolshoi und in Washington dirigierte, kürzlich in Zürich die Carmen machen sollte und bei mehreren bedeutenden Orchestern bereits seine Visitenkarte abgegeben hat, hat im Hinblick auf diesen Zyklus David Zinman, der neben Leif Segerstam und Michael Tilson Thomas einer seiner Lehrer war und stets eine historische informierte Aufführungspraxis vertrat, und Daniel Barenboim konsultiert und wählte den nicht unüblichen Weg „historically informed in the way we attack some thing but acknowledging that we’re playing modern instruments with a long tradition“. Attacke und Gestaltungswille und der Elan, unbedingt etwas beweisen zu müssen, teilen sich im Scherzo und vor allem im Finale der Dritten mit. Trotz der Stürme, die Trevino gerne entfacht, ist seine Darstellung ungemein klar und lyrisch grundiert. Er gibt den Instrumenten ausgiebig Gelegenheit, sich vorzustellen, den Streicher in Finale der Dritten, Klarinette und Fagott in der vierten, Oboe im ersten Satz der Fünften. Trevino versucht alle Gruppen durchsichtig und dennoch voll klingen zu lassen. Die Technik hat den Konzerthausklang gut eingefangen. Die ihn live hörten, beschreiben Trevino als vor Energie berstenden Dirigenten mit präziser Vorstellungskraft. Das ist im Trauermarsch der Eroica zu spüren, im Adagio der vierten, mehr im ersten Satz als im Finale der Fünften, in der Sturmszene der Pastorale, doch manchmal übertreibt er Tempo und Effekte, wie in der Siebten und Achten, der neunten fehlt es, wie auch dem Finale der Drittem, an manchen Stellen an Grandeur; die Solisten Kate Royal, Christine Rice, Tuomas Katajala und Derek Walton sind gut, der MSO Festival Chorus klingt etwas entfernt. Kein schlechter Einstand. Rolf Fath
Aus Malmö: Beethovens Sinfonien mit Robert Trevino und dem Malmö Symphony Orchestra bei Ondine. Großartiger kann man nicht einsteigen. Nicht auf dem CD-Markt, nicht auf dem Konzertpodium. Nicht einfach nur ein oder zwei Beethoven-Sinfonien, sondern gleich alle neun bildeten den Auftakt der Zusammenarbeit des Malmö Symphony Orchestra und seines im Oktober 2019 neugekürten Chief Conductor Robert Trevino. Die Tinte unter dem Vertrag war kaum getrocknet, als Orchester und Dirigent ihre Partnerschaft im gleichen Monat im Rahmen eines Beethoven-Festivals mit allen neun Sinfonien an vier Abenden besiegelten und im Konserthus live aufnahmen. Für Trevino ist es zwar nicht das CD-Debüt aber immerhin der Einstand bei Ondine, die die fünf CDs in aparter Klappbox und englischem Beiheft samt Interview mit dem Dirigenten herausbrachten (ODE 1348-5Q). Nach Ádám Fischers Aufnahme aus Kopenhagen ist diese von der schwedischen Seite des Öresund stammende Aufnahme der zweite skandinavische Beethoven-Zyklus im Jubiläumsjahr. „The spirit of Beethoven“, den Trevino verspürte, als er erstmals die Fünfte dirigierte, vermittelt sich dem Hörer, der unwillkürlich nach dem Sinn dieser Aufnahme fragen wird, bei den beiden ersten Sinfonien noch nicht. Die erste birgt noch die Welt von Haydn und Mozart, die zweite ist, laut Trevino, „a statement of intent“, doch auf mich wirken die Aufnahmen trotz schöner Momente mit den Holzbläsern und fein empfundenen romantischen Stimmungen, uninteressant, werden im Verlauf immer langweiliger, und das hat nichts mit dem – gegenüber Fischer – durchgehend etwas längeren Spieldauern zu tun (die dritte und vierte auf einer CD mit 85 Minuten Spieldauer). Hier tasten sich Dirigent und Orchester mehr aneinander als an die Welt der Wiener Klassik heran. Der 36jährige Amerikaner mexikanischer Abstammung – eigentlich Treviño – der neben dem schwedischen Chefposten auch den beim Baskischen Nationalorchester in San Sebastián innehat, Opern am Bolshoi und in Washington dirigierte, kürzlich in Zürich die Carmen machen sollte und bei mehreren bedeutenden Orchestern bereits seine Visitenkarte abgegeben hat, hat im Hinblick auf diesen Zyklus David Zinman, der neben Leif Segerstam und Michael Tilson Thomas einer seiner Lehrer war und stets eine historische informierte Aufführungspraxis vertrat, und Daniel Barenboim konsultiert und wählte den nicht unüblichen Weg „historically informed in the way we attack some thing but acknowledging that we’re playing modern instruments with a long tradition“. Attacke und Gestaltungswille und der Elan, unbedingt etwas beweisen zu müssen, teilen sich im Scherzo und vor allem im Finale der Dritten mit. Trotz der Stürme, die Trevino gerne entfacht, ist seine Darstellung ungemein klar und lyrisch grundiert. Er gibt den Instrumenten ausgiebig Gelegenheit, sich vorzustellen, den Streicher in Finale der Dritten, Klarinette und Fagott in der vierten, Oboe im ersten Satz der Fünften. Trevino versucht alle Gruppen durchsichtig und dennoch voll klingen zu lassen. Die Technik hat den Konzerthausklang gut eingefangen. Die ihn live hörten, beschreiben Trevino als vor Energie berstenden Dirigenten mit präziser Vorstellungskraft. Das ist im Trauermarsch der Eroica zu spüren, im Adagio der vierten, mehr im ersten Satz als im Finale der Fünften, in der Sturmszene der Pastorale, doch manchmal übertreibt er Tempo und Effekte, wie in der Siebten und Achten, der neunten fehlt es, wie auch dem Finale der Drittem, an manchen Stellen an Grandeur; die Solisten Kate Royal, Christine Rice, Tuomas Katajala und Derek Walton sind gut, der MSO Festival Chorus klingt etwas entfernt. Kein schlechter Einstand. Rolf Fath
 Und nun zu hmf: die konventionellere Doppel-CD mit der neunten Sinfonie sowie der in gewisser Hinsicht als eine Art Vorläuferin zu bezeichnenden Chorfantasie bei harmonia mundi france (HMM 902431.32) Es spielt das Freiburger Barockorchester unter der Stabführung des spanischen Dirigenten Pablo Heras-Casado, der sich längst einen Namen gemacht hat, und zwar gerade auch bei diesem Label. Das Barockorchester aus Freiburg ist längst in die Vorklassik, die Klassik und sogar in die Romantik vorgestoßen. So standen nicht nur die heftig diskutierten Mozart-Einspielungen unter René Jacobs im Fokus (besonders der Don Giovanni), sondern präsentierte man gar auch einen kompletten Zyklus der fünf Sinfonien von Felix Mendelssohn Bartholdy, wiederum unter Heras-Casado. Hörenswert sind die postbarocken Ausflüge des Orchesters allemal, wie sich auch diesmal erweist. Originalinstrumente bei Beethoven sind seit vierzig Jahren keine Besonderheit mehr, so dass auch diesmal das Rad nicht neu erfunden wird. Die sehr flotten, metronomnahen Tempi reißen nicht mehr per se so sehr vom Hocker wie einst. Dass der Kopfsatz und das Scherzo praktisch auf dieselbe Spielzeit (13 und eine halbe Minute) kommen, mag Zufall sein. Ein Gefühl von maestoso will im ersten Satz jedenfalls nicht aufkommen. Das Adagio gerät mit zwölf Minuten beinahe zur Karikatur, wobei man dazu sagen sollte, dass einst schon Sir John Eliot Gardiner dieses recht absurd anmutende Tempo anschlug. Wird jeder Satz dermaßen schnell gespielt, muss dies auf Kosten der inneren Proportionen des Werkes gehen. Mit 61 Minuten Gesamtspielzeit gehört die Neuaufnahme definitiv zu den allerflottesten auf dem Markt. Die beste HIP-Einspielung stellt sie indes mitnichten dar. Diese wurde im Vorjahr ganz unverhofft von Masaaki Suzuki mit dem Bach Collegium Japan und überragenden Solisten bei BIS vorgelegt. Dies liegt nicht nur daran, dass sich Suzuki fünf Minuten mehr Zeit nahm. Auch klanglich kann die HM-Aufnahme nicht ganz mithalten. Mit Christiane Karg, Sophie Harmsen, Werner Güra und Florian Boesch steht Heras-Casado ein sehr adäquates Solistenquartett zur Verfügung, doch vermisst man den gewissen Aha-Effekt, welchen Suzuki erzielte. Die Zürcher Sing-Akademie meistert den schwierigen Chorpart souverän. Das eigentliche Highlight dieser Neuproduktion (Anfnahme: Teldex Studio Berlin, November 2019) ist dann eher die „Beigabe“ auf der zweiten CD: die Chorfantasie, in der Kristian Bezuidenhout den Fortepiano-Part meisterlich beisteuert. Das dreisprachige Beiheft (Französisch, Englisch, Deutsch) mit Einführungstexten von Barry Cooper und Christian Girardin ist vorzüglich.
Und nun zu hmf: die konventionellere Doppel-CD mit der neunten Sinfonie sowie der in gewisser Hinsicht als eine Art Vorläuferin zu bezeichnenden Chorfantasie bei harmonia mundi france (HMM 902431.32) Es spielt das Freiburger Barockorchester unter der Stabführung des spanischen Dirigenten Pablo Heras-Casado, der sich längst einen Namen gemacht hat, und zwar gerade auch bei diesem Label. Das Barockorchester aus Freiburg ist längst in die Vorklassik, die Klassik und sogar in die Romantik vorgestoßen. So standen nicht nur die heftig diskutierten Mozart-Einspielungen unter René Jacobs im Fokus (besonders der Don Giovanni), sondern präsentierte man gar auch einen kompletten Zyklus der fünf Sinfonien von Felix Mendelssohn Bartholdy, wiederum unter Heras-Casado. Hörenswert sind die postbarocken Ausflüge des Orchesters allemal, wie sich auch diesmal erweist. Originalinstrumente bei Beethoven sind seit vierzig Jahren keine Besonderheit mehr, so dass auch diesmal das Rad nicht neu erfunden wird. Die sehr flotten, metronomnahen Tempi reißen nicht mehr per se so sehr vom Hocker wie einst. Dass der Kopfsatz und das Scherzo praktisch auf dieselbe Spielzeit (13 und eine halbe Minute) kommen, mag Zufall sein. Ein Gefühl von maestoso will im ersten Satz jedenfalls nicht aufkommen. Das Adagio gerät mit zwölf Minuten beinahe zur Karikatur, wobei man dazu sagen sollte, dass einst schon Sir John Eliot Gardiner dieses recht absurd anmutende Tempo anschlug. Wird jeder Satz dermaßen schnell gespielt, muss dies auf Kosten der inneren Proportionen des Werkes gehen. Mit 61 Minuten Gesamtspielzeit gehört die Neuaufnahme definitiv zu den allerflottesten auf dem Markt. Die beste HIP-Einspielung stellt sie indes mitnichten dar. Diese wurde im Vorjahr ganz unverhofft von Masaaki Suzuki mit dem Bach Collegium Japan und überragenden Solisten bei BIS vorgelegt. Dies liegt nicht nur daran, dass sich Suzuki fünf Minuten mehr Zeit nahm. Auch klanglich kann die HM-Aufnahme nicht ganz mithalten. Mit Christiane Karg, Sophie Harmsen, Werner Güra und Florian Boesch steht Heras-Casado ein sehr adäquates Solistenquartett zur Verfügung, doch vermisst man den gewissen Aha-Effekt, welchen Suzuki erzielte. Die Zürcher Sing-Akademie meistert den schwierigen Chorpart souverän. Das eigentliche Highlight dieser Neuproduktion (Anfnahme: Teldex Studio Berlin, November 2019) ist dann eher die „Beigabe“ auf der zweiten CD: die Chorfantasie, in der Kristian Bezuidenhout den Fortepiano-Part meisterlich beisteuert. Das dreisprachige Beiheft (Französisch, Englisch, Deutsch) mit Einführungstexten von Barry Cooper und Christian Girardin ist vorzüglich.
 Die eigentlich interessantere Neuerscheinung stellt die Compact Disc mit Beethovens Sinfonie Nr. 6, der Pastorale, in Verbindung mit dem über zwanzig Jahre zuvor entstandenen Vorläufer, Le Portrait musical de la Nature ou Grande Symphonie, von Justin Heinrich Knecht (1752-1817) dar (HMM 902425). Es zeichnet verantwortlich die Akademie für Alte Musik Berlin unter ihrem Konzertmeister Bernhard Forck. Tatsächlich ist es erstaunlich, welche Parallelen diese beiden Werke, die jeweils eine musikalische Naturschilderung darstellen, aufweisen. Dies beginnt bereits bei der untypischen Fünfsätzigkeit, derer sich Knecht bereits 1785 bediente. Im Mittelpunkt steht da wie dort ein Gewitter, obschon es sich im älteren Werk gleichsam auf die Sätze 2 bis 4 erstreckt, vom Verdunkeln des Himmels bis zum allmählichen Verziehen und Wiederaufhellen, insgesamt gute zehn Minuten, was beinahe die Hälfte der Sinfonie ausmacht. Dies ist bekanntlich anders bei Beethoven, der fast eine Generation jünger war. Hier nimmt das Gewitter nur in etwa ein Zehntel der Pastoral-Sinfonie ein, hier konkret 4 Minuten von insgesamt 41 Minuten Spielzeit. Freilich bediente sich Beethoven bereits einer gänzlich anderen, deutlich expressiveren Tonsprache als sein Vorläufer. Zwischen 1785 und 1808 (Uraufführung der Pastorale) lagen Umwälzungen von einer solchen Tragweite, wie sie die Menschheit selten erlebte – Stichwort Französische Revolution und deren Folgen. Dies musste sich zwangsläufig auch in der Musik ausdrücken. Das soll im Umkehrschluss allerdings nicht bedeuten, dass Knechts „Proto-Pastorale“ belanglos herüberkäme. Zumindest in dieser nagelneuen Darbietung erzeigt sich das Potential dieses zu Unrecht fast unbekannten Werkes, dessen Höhepunkt selbstredend der stürmische, beinahe kriegerische mittlere Satz mit dem eigentlichen Gewitter darstellt. Hier werden die Vorteile einer historisch informierten Aufführungspraxis deutlich, vermitteln die zupackend aufspielenden Pauken doch einen furiosen Eindruck von der Szenerie, fast wie eine Vorahnung auf die noch in der Zukunft liegenden Ereignisse. Hier wurde eine Referenzaufnahme vorgelegt. Die Konkurrenz hervorragender Interpretationen der Beethoven’schen Sechsten ist dem gegenüber geradezu grenzenlos, so dass man mit einem anderen Erwartungshorizont herangeht. Und doch: Forck und den „alten“ Berlinern gelingt das Kunststück, eine der bezwingendsten Darbietungen der Pastorale vorzulegen, die auf Tonträger erschienen sind. Zumal im HIP-Bereich wird man lange suchen müssen, um eine ähnlich überzeugende Einspielung aufzutreiben. Anders als Heras-Casado setzt Forck auf gemäßigte Tempi, wodurch gerade der Gewittersturm gewinnt, der in seiner unbarmherzigen Unmittelbarkeit des Ausdrucks gar einen Hauch Furtwängler in sich trägt – man sollte es nicht für möglich halten. Tontechnisch weiß diese Scheibe völlig zu überzeugen, was wiederum auch für das dreisprachig gehaltene Booklet (Französisch, Englisch, Deutsch) mit Texten von Forck und Peter Gülke gilt. Ohne Einschränkungen ein großer Wurf. Daniel Hauser
Die eigentlich interessantere Neuerscheinung stellt die Compact Disc mit Beethovens Sinfonie Nr. 6, der Pastorale, in Verbindung mit dem über zwanzig Jahre zuvor entstandenen Vorläufer, Le Portrait musical de la Nature ou Grande Symphonie, von Justin Heinrich Knecht (1752-1817) dar (HMM 902425). Es zeichnet verantwortlich die Akademie für Alte Musik Berlin unter ihrem Konzertmeister Bernhard Forck. Tatsächlich ist es erstaunlich, welche Parallelen diese beiden Werke, die jeweils eine musikalische Naturschilderung darstellen, aufweisen. Dies beginnt bereits bei der untypischen Fünfsätzigkeit, derer sich Knecht bereits 1785 bediente. Im Mittelpunkt steht da wie dort ein Gewitter, obschon es sich im älteren Werk gleichsam auf die Sätze 2 bis 4 erstreckt, vom Verdunkeln des Himmels bis zum allmählichen Verziehen und Wiederaufhellen, insgesamt gute zehn Minuten, was beinahe die Hälfte der Sinfonie ausmacht. Dies ist bekanntlich anders bei Beethoven, der fast eine Generation jünger war. Hier nimmt das Gewitter nur in etwa ein Zehntel der Pastoral-Sinfonie ein, hier konkret 4 Minuten von insgesamt 41 Minuten Spielzeit. Freilich bediente sich Beethoven bereits einer gänzlich anderen, deutlich expressiveren Tonsprache als sein Vorläufer. Zwischen 1785 und 1808 (Uraufführung der Pastorale) lagen Umwälzungen von einer solchen Tragweite, wie sie die Menschheit selten erlebte – Stichwort Französische Revolution und deren Folgen. Dies musste sich zwangsläufig auch in der Musik ausdrücken. Das soll im Umkehrschluss allerdings nicht bedeuten, dass Knechts „Proto-Pastorale“ belanglos herüberkäme. Zumindest in dieser nagelneuen Darbietung erzeigt sich das Potential dieses zu Unrecht fast unbekannten Werkes, dessen Höhepunkt selbstredend der stürmische, beinahe kriegerische mittlere Satz mit dem eigentlichen Gewitter darstellt. Hier werden die Vorteile einer historisch informierten Aufführungspraxis deutlich, vermitteln die zupackend aufspielenden Pauken doch einen furiosen Eindruck von der Szenerie, fast wie eine Vorahnung auf die noch in der Zukunft liegenden Ereignisse. Hier wurde eine Referenzaufnahme vorgelegt. Die Konkurrenz hervorragender Interpretationen der Beethoven’schen Sechsten ist dem gegenüber geradezu grenzenlos, so dass man mit einem anderen Erwartungshorizont herangeht. Und doch: Forck und den „alten“ Berlinern gelingt das Kunststück, eine der bezwingendsten Darbietungen der Pastorale vorzulegen, die auf Tonträger erschienen sind. Zumal im HIP-Bereich wird man lange suchen müssen, um eine ähnlich überzeugende Einspielung aufzutreiben. Anders als Heras-Casado setzt Forck auf gemäßigte Tempi, wodurch gerade der Gewittersturm gewinnt, der in seiner unbarmherzigen Unmittelbarkeit des Ausdrucks gar einen Hauch Furtwängler in sich trägt – man sollte es nicht für möglich halten. Tontechnisch weiß diese Scheibe völlig zu überzeugen, was wiederum auch für das dreisprachig gehaltene Booklet (Französisch, Englisch, Deutsch) mit Texten von Forck und Peter Gülke gilt. Ohne Einschränkungen ein großer Wurf. Daniel Hauser
Der Hype um Teodor Currentzis, den griechisch-russischen Dirigenten-Popstar, ist seit Jahren ungebrochen. Dafür sorgt nicht nur dessen ihm ureigene Exzentrik, sondern freilich auch Sony, sein Hauslabel. Dass die nun veröffentlichte Einspielung von Beethovens fünfter Sinfonie (Sony 19075884972) im Design des legendären Duftes Chanel Nº 5 daherkommt, ist sicherlich kein Zufall. Exklusivität ist das Credo, das auch notwendig ist, will man den potentiell Kaufwilligen, der noch kein Jünger des Maestros ist, dazu animieren, 15 Euro für 30 Minuten Musik auszugeben. Mehr ist tatsächlich nicht auf dieser Compact Disc enthalten. In einer Vorankündigung hieß es, die siebente Sinfonie werde zeitnah nachgereicht – Dekadenz pur, die man sich nicht einmal in der CD-Frühzeit in dieser extremen Ausprägung erlaubt hätte. Zugegeben: Die Cover-Gestaltung bei Currentzis-Aufnahmen ist in den meisten Fällen wirklich ausgefallen. Und auch der Inhalt wusste in der Vergangenheit überwiegend zu überzeugen – ob nun jetzt wegen oder doch eher trotz Currentzis. Freilich: Mitnichten alles liegt ihm, doch für welchen Dirigenten gälte diese Einschränkung nicht. Eigentlich ging ich ernüchtert an diese Neuerscheinung heran, war mir doch ein Live-Mitschnitt desselben Werkes unter diesem Dirigenten von den BBC Proms vom Juli 2018 in unguter Erinnerung. Dass die Sony-Produktion zwischen 31. Juli und 4. August desselben Jahres im Wiener Konzerthaus eingespielt wurde, legte auf dem Papier nahe, dass das nicht viel besser sein würde. Weit gefehlt. Dass man hier, ganz altmodisch, auf eine echte Einspielung im alten Sinne setzte, hat sich eindeutig gelohnt. Ist Currentzis am Ende vielleicht, entgegen des Klischees, gar nicht unbedingt der Live-Klangmagier, sondern erzielt er seine besten Ergebnisse im klassischen Aufnahmestudio, wo alles bis ins kleinste Detail ausgetüftelt ist und man den Wünschen des Meisters minutiös nachkommen kann? Zumindest haben mich bisher seine offiziellen Platteneinspielungen mehr überzeugt als die gar nicht so wenigen Mitschnitte aus dem Rundfunk und Fernsehen. Klanglich hat Sony hier wirklich Maßstäbliches geleistet. Kein Vergleich mit der ungünstigen Akustik, die bei der BBC damals im Radio herüberkam.
 Ohne Frage: Das Geschäftsmodell, dass Sony hier abzieht, ist unverschämt. Andererseits ist diese Aufnahme auch unverschämt gut. Gewiss nicht die definitive Lesart, wie könnte sie es auch sein. Doch hat der Dirigent etwas mitzuteilen. Die Radikalität seines Ansatzes, frappierend exekutiert von seinem auf ihn eingespielten und bestens aufspielenden Orchester MusicAeterna, ruft, bald ein halbes Jahrhundert nach den ersten HIP-Versuchen, bestimmt keine neue Ära in Sachen Beethoven-Interpretation aus, doch fließt die Musik bei Currentzis in einer Sogwirkung dahin, wirkt alles organisch und nicht zwecks bloßer Effekthascherei aufgesetzt. Genau das werfen seine schärfsten Kritiker Currentzis häufig vor, wagnerisch ausgedrückt: „Effekt ohne Ursache“. Mir stellt sich dieser Eindruck hier nicht ein. Eigentlich exerziert der Dirigent genau das, was Nikolaus Harnoncourt bereits vor Jahren proklamiert hat: Die Beethoven’sche Fünfte als Programmmusik der Französischen Revolution. Harnoncourts hoch umstrittene Werkanalyse, die der Fünften gar als einziger Beethoven-Sinfonie ein solches Programm unterstellte, passt ausgezeichnet auf Currentzis‘ Interpretation: Im Kopfsatz die Darstellung eines unterdrückerischen Regimes, das jeden Aufruhr im Keim erstickt; im langsamen Satz innere Einkehr der Freiheitsliebenden im Sinne eines Gebetes; im Scherzo sodann der erst kaum merkliche, dann aber unaufhaltsam werdende Übergang zum (diesmal erfolgreichen) Aufbegehren; im Finale schließlich der Sieg der Freiheit über die Tyrannei. Ein zeitloses Plädoyer, das einem Beethoven durchaus zuzutrauen gewesen wäre. Selbst wenn Harnoncourt geirrt haben sollte, so stellt gerade Currentzis diese Hypothese ungemein überzeugend dar – und verzichtet, anders als seinerzeit der greise Altmeister (übrigens auch bei Sony), sogar auf sehr eigenwillige Manierismen.
Ohne Frage: Das Geschäftsmodell, dass Sony hier abzieht, ist unverschämt. Andererseits ist diese Aufnahme auch unverschämt gut. Gewiss nicht die definitive Lesart, wie könnte sie es auch sein. Doch hat der Dirigent etwas mitzuteilen. Die Radikalität seines Ansatzes, frappierend exekutiert von seinem auf ihn eingespielten und bestens aufspielenden Orchester MusicAeterna, ruft, bald ein halbes Jahrhundert nach den ersten HIP-Versuchen, bestimmt keine neue Ära in Sachen Beethoven-Interpretation aus, doch fließt die Musik bei Currentzis in einer Sogwirkung dahin, wirkt alles organisch und nicht zwecks bloßer Effekthascherei aufgesetzt. Genau das werfen seine schärfsten Kritiker Currentzis häufig vor, wagnerisch ausgedrückt: „Effekt ohne Ursache“. Mir stellt sich dieser Eindruck hier nicht ein. Eigentlich exerziert der Dirigent genau das, was Nikolaus Harnoncourt bereits vor Jahren proklamiert hat: Die Beethoven’sche Fünfte als Programmmusik der Französischen Revolution. Harnoncourts hoch umstrittene Werkanalyse, die der Fünften gar als einziger Beethoven-Sinfonie ein solches Programm unterstellte, passt ausgezeichnet auf Currentzis‘ Interpretation: Im Kopfsatz die Darstellung eines unterdrückerischen Regimes, das jeden Aufruhr im Keim erstickt; im langsamen Satz innere Einkehr der Freiheitsliebenden im Sinne eines Gebetes; im Scherzo sodann der erst kaum merkliche, dann aber unaufhaltsam werdende Übergang zum (diesmal erfolgreichen) Aufbegehren; im Finale schließlich der Sieg der Freiheit über die Tyrannei. Ein zeitloses Plädoyer, das einem Beethoven durchaus zuzutrauen gewesen wäre. Selbst wenn Harnoncourt geirrt haben sollte, so stellt gerade Currentzis diese Hypothese ungemein überzeugend dar – und verzichtet, anders als seinerzeit der greise Altmeister (übrigens auch bei Sony), sogar auf sehr eigenwillige Manierismen.
Abschließend könnte man sagen: Frechheit siegt. Sonys Abzocke macht jetzt schon gespannt auf Currentzis‘ Darbietung der Siebenten. Immerhin: Diese wird dann wohl auch unter Currentzis die CD mit etwas mehr als bloß einem halben Stündlein füllen. Daniel Hauser
 Und noch ein Beethoven-Zyklus im Beethoven-Jahr. In kurzer Abfolge erscheint jetzt die zweite Gesamteinspielung der neun Sinfonien Ludwig van Beethovens mit dem WDR Sinfonieorchester, dem früheren Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester: Im vorigen Jahr brachte Profil/Hänssler einen Zyklus mit dem seinerzeitigen Chefdirigenten Jukka-Pekka Saraste auf den Markt, nun folgt Pentatone mit einem weiteren, auf fünf CDs verteilten Zyklus unter Marek Janowski (PTC 5186 860). Richtig gelesen. Der mittlerweile 81-jährige, in Warschau geborene und in Wuppertal aufgewachsene Dirigent ist bislang nicht unbedingt als Interpret des Bonner Meisterkomponisten in Erscheinung getreten. Auch kommen einem eher andere Orchester zuerst in den Sinn, denkt man an Janowski, der sich gerade als Wagner-Dirigent einen Ruf erarbeitet hat. Dessen ungeachtet, ist diese Gesamtaufnahme mehr als bloß hörenswert. Das liegt zu einem nicht unerheblichen Teil schon einmal an der sehr guten Tontechnik, die man bei einer nagelneuen Einspielung, die zwischen September 2018 und November 2019 in der Kölner Philharmonie entstand, aber auch erwarten darf. Welchen Preis kann man mit dem gefühlt tausendsten Beethoven-Zyklus noch gewinnen? Diese Frage stellt sich hier mitnichten, braucht Janowski ja niemandem mehr etwas beweisen. Als längst etablierter und in aller (Klassik-)Welt bekannter Orchesterleiter hat er eine solche Profilierung nicht mehr nötig. Die viel bemühte Formulierung der Altersweisheit, wie weiland etwa bei Günter Wand und jüngst bei Herbert Blomstedt, verkommt allzu leicht zur bloßen Phrase, trifft es im Kern aber ganz gut. Weder will Janowski die Beethoven-Interpretation neu erfinden, noch verfolgt er die Imitation eines längst verflossenen Beethoven-Bildes. Die überzeugende Synthese aus großem Sinfonieorchester und nicht übermäßig romantisiertem Orchesterklang ist festzuhalten. Allzu schroffe Akzente und Übertreibungen sind Janowskis Sache nicht. Es handelt sich um eine im besten Sinne hochseriöse Wiedergabe. Ja man könnte soweit gehen und es gar zu einer adäquaten Einsteiger-Einspielung zu deklarieren, ungeachtet der landläufigen Standardempfehlungen, die in aller Munde sind. Gerade die ersten beiden Sinfonien, in konventionellen Gesamtaufnahmen mitunter eher der Vollständigkeit halber mit enthalten, kommen hier durchaus zu ihrem eigenständigen Recht, ohne dass auf Biegen und Brechen das gewiss vorhandene revolutionäre Element übersteigert würde. Erstaunlich frisch, ohne wegen Leichtgewichtigkeit gänzlich abzuheben, erklingt die Eroica, der Janowski das Pathos versagt, welches ihr Dirigenten wie Klemperer, Giulini oder auch der in unseren Breiten viel zu wenig geläufige Asahina angedeihen ließen. Freilich verkommt es nicht zu einer beinahe schon parodierenden Lesart, wie sie diverse „HIPisten“ an den Tag legen. Durch Janowskis Ansatz wird der häufig kolportierte Quantensprung von der zweiten zur dritten Sinfonie relativiert, letztere nicht zum spätromantischen Monstrum aufgebläht. Nur logisch, dass die darauffolgende Vierte, die zu solchen Auslegungen noch nie recht taugte, deswegen auch nicht „abfällt“, wie in der Rezeption bisweilen der Eindruck erzeugt wird. Wohl keine andere der neun Beethoven-Sinfonien wurde von eben dieser Rezeption derart mystifiziert wie die Fünfte, zur deutschen „Schicksalssinfonie“ erklärt. Marek Janowski scheint sich schlichtweg auf die Noten selbst zu verlassen. Das Ergebnis spricht für sich. Mit Fug und Recht kann man von einer der großen modernen Darbietungen dieses „rauf und runter“ exerzierten Meisterwerkes sprechen. Bemühte Überbetonungen werden vermieden, doch wo es sich anbietet, spielt der Dirigent gekonnt mit behutsam eingesetzten dezenten Rubati, ohne dass auch nur entfernt der Eindruck von Willkür aufkäme. Ungemein einnehmend etwa das mit Herzblut dargebotene Scherzo. Die Akribie, mit der im Finalsatz scheinbar nebensächliche, oft überspielte Details beleuchtet werden, überrascht allemal. Der Kopfsatz der Pastorale ist bei Janowski tatsächlich das vom Komponisten deklarierte Erwachen, kein Dahindämmern wie in sehr vielen Einspielungen (so reizvoll dies im Einzelfall auch klingen mag). Wie gewaltig die Dynamik der WDR-Tontechnik ist, lässt sich im Gewitter-und-Sturm-Satz erfahren, der hier zwar nicht zum Weltgericht ausartet, aber doch den notwendigen scharfen Kontrast zu den anderen Sätzen darstellt. In der Siebenten arbeitet Janowski gerade die Zwischentöne heraus, so insbesondere im feurigen Finale. Im Kopfsatz setzt er auf ein gleichmäßiges Tempo und vermeidet im darauffolgenden Allegretto ein Verschleppen. Die Achte versucht in der hier vorgelegten Aufnahme gar nicht erst groß zu erscheinen und kommt so kammermusikalisch herüber wie keine andere der Sinfonien in der Box. Dies irritiert im ersten Moment, rückt das unterschätzte Werk aber auch näher an Haydn heran, dem Beethoven hier wohl eine postume Hommage darbrachte. Die abschließende neunte Sinfonie ist in jeder Gesamteinspielung gewissermaßen die Bewährungsprobe, was nicht nur an ihren Dimensionen, sondern auch am Hinzutreten des Gesangsteils liegt. Nicht wenigen Beethoven-Zyklen bleibt aufgrund Unstimmigkeiten im vokalen Finalsatz der Neunten eine vollumfängliche Empfehlung verwehrt. Einen tendenziellen Vorteil hat diese Neuaufnahme insofern, als einzig Muttersprachler/innen beteiligt sind: Die Sopranistin Regine Hangler, die Altistin Wiebke Lehmkuhl, der Tenor Christian Elsner sowie der Bassist Andreas Bauer Kanabas. Wie in der Parallelaufnahme unter Saraste, wird der WDR Rundfunkchor durch den NDR Chor verstärkt. Mit 64 Minuten Spielzeit zählt Janowskis Interpretation zu den flottesten, zumal unter den Nicht-HIP-Aufnahmen. Der erste Satz gerät in der Tat vorwärtsdrängend, ohne des Guten zu viel, auch wenn man sich in der letzten Minute des Kopfsatzes ein klein wenig mehr maestoso gewünscht hätte. Fetzig die stellenweise sehr prominent hervortretenden Pauken, was der Dramatik zugute kommt. Das wird auch im Scherzo deutlich, in welchem Janowski sämtliche Wiederholungen beachtet, wodurch der Satz mit 14 Minuten annähernd dieselbe Länge aufweist wie der vorangehende. Das Adagio ist gar eine Minute kürzer, wodurch es auf den ersten Blick in Verdacht gerät, etwas zu unterkühlt herübergebracht zu werden. Glücklicherweise stellt sich dieser Eindruck beim tatsächlichen Hören nicht ein. Das Solistenquartett im Schlusssatz ist indes unausgewogen. Während Bauer Kanabas‘ mächtiger Bass Größeres erhoffen lässt, fehlen Elsners lyrischem, etwas glanzlosen Tenor die hier wünschenswerten heldischen Anflüge. Die Damen zumindest individuell und klar voneinander unterscheidbar. Tadellos die Chorleistung. Bis auf minimalste Unsauberkeiten, die sich an einer Hand abzählen lassen, spielt der Klangkörper des Westdeutschen Rundfunks formidabel und unterstreicht die dirigentische Leistung nachdrücklich. Die englisch-deutsche Textbeilage (Text: Kasper van Kooten) fällt gediegen aus. Daniel Hauser
Und noch ein Beethoven-Zyklus im Beethoven-Jahr. In kurzer Abfolge erscheint jetzt die zweite Gesamteinspielung der neun Sinfonien Ludwig van Beethovens mit dem WDR Sinfonieorchester, dem früheren Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester: Im vorigen Jahr brachte Profil/Hänssler einen Zyklus mit dem seinerzeitigen Chefdirigenten Jukka-Pekka Saraste auf den Markt, nun folgt Pentatone mit einem weiteren, auf fünf CDs verteilten Zyklus unter Marek Janowski (PTC 5186 860). Richtig gelesen. Der mittlerweile 81-jährige, in Warschau geborene und in Wuppertal aufgewachsene Dirigent ist bislang nicht unbedingt als Interpret des Bonner Meisterkomponisten in Erscheinung getreten. Auch kommen einem eher andere Orchester zuerst in den Sinn, denkt man an Janowski, der sich gerade als Wagner-Dirigent einen Ruf erarbeitet hat. Dessen ungeachtet, ist diese Gesamtaufnahme mehr als bloß hörenswert. Das liegt zu einem nicht unerheblichen Teil schon einmal an der sehr guten Tontechnik, die man bei einer nagelneuen Einspielung, die zwischen September 2018 und November 2019 in der Kölner Philharmonie entstand, aber auch erwarten darf. Welchen Preis kann man mit dem gefühlt tausendsten Beethoven-Zyklus noch gewinnen? Diese Frage stellt sich hier mitnichten, braucht Janowski ja niemandem mehr etwas beweisen. Als längst etablierter und in aller (Klassik-)Welt bekannter Orchesterleiter hat er eine solche Profilierung nicht mehr nötig. Die viel bemühte Formulierung der Altersweisheit, wie weiland etwa bei Günter Wand und jüngst bei Herbert Blomstedt, verkommt allzu leicht zur bloßen Phrase, trifft es im Kern aber ganz gut. Weder will Janowski die Beethoven-Interpretation neu erfinden, noch verfolgt er die Imitation eines längst verflossenen Beethoven-Bildes. Die überzeugende Synthese aus großem Sinfonieorchester und nicht übermäßig romantisiertem Orchesterklang ist festzuhalten. Allzu schroffe Akzente und Übertreibungen sind Janowskis Sache nicht. Es handelt sich um eine im besten Sinne hochseriöse Wiedergabe. Ja man könnte soweit gehen und es gar zu einer adäquaten Einsteiger-Einspielung zu deklarieren, ungeachtet der landläufigen Standardempfehlungen, die in aller Munde sind. Gerade die ersten beiden Sinfonien, in konventionellen Gesamtaufnahmen mitunter eher der Vollständigkeit halber mit enthalten, kommen hier durchaus zu ihrem eigenständigen Recht, ohne dass auf Biegen und Brechen das gewiss vorhandene revolutionäre Element übersteigert würde. Erstaunlich frisch, ohne wegen Leichtgewichtigkeit gänzlich abzuheben, erklingt die Eroica, der Janowski das Pathos versagt, welches ihr Dirigenten wie Klemperer, Giulini oder auch der in unseren Breiten viel zu wenig geläufige Asahina angedeihen ließen. Freilich verkommt es nicht zu einer beinahe schon parodierenden Lesart, wie sie diverse „HIPisten“ an den Tag legen. Durch Janowskis Ansatz wird der häufig kolportierte Quantensprung von der zweiten zur dritten Sinfonie relativiert, letztere nicht zum spätromantischen Monstrum aufgebläht. Nur logisch, dass die darauffolgende Vierte, die zu solchen Auslegungen noch nie recht taugte, deswegen auch nicht „abfällt“, wie in der Rezeption bisweilen der Eindruck erzeugt wird. Wohl keine andere der neun Beethoven-Sinfonien wurde von eben dieser Rezeption derart mystifiziert wie die Fünfte, zur deutschen „Schicksalssinfonie“ erklärt. Marek Janowski scheint sich schlichtweg auf die Noten selbst zu verlassen. Das Ergebnis spricht für sich. Mit Fug und Recht kann man von einer der großen modernen Darbietungen dieses „rauf und runter“ exerzierten Meisterwerkes sprechen. Bemühte Überbetonungen werden vermieden, doch wo es sich anbietet, spielt der Dirigent gekonnt mit behutsam eingesetzten dezenten Rubati, ohne dass auch nur entfernt der Eindruck von Willkür aufkäme. Ungemein einnehmend etwa das mit Herzblut dargebotene Scherzo. Die Akribie, mit der im Finalsatz scheinbar nebensächliche, oft überspielte Details beleuchtet werden, überrascht allemal. Der Kopfsatz der Pastorale ist bei Janowski tatsächlich das vom Komponisten deklarierte Erwachen, kein Dahindämmern wie in sehr vielen Einspielungen (so reizvoll dies im Einzelfall auch klingen mag). Wie gewaltig die Dynamik der WDR-Tontechnik ist, lässt sich im Gewitter-und-Sturm-Satz erfahren, der hier zwar nicht zum Weltgericht ausartet, aber doch den notwendigen scharfen Kontrast zu den anderen Sätzen darstellt. In der Siebenten arbeitet Janowski gerade die Zwischentöne heraus, so insbesondere im feurigen Finale. Im Kopfsatz setzt er auf ein gleichmäßiges Tempo und vermeidet im darauffolgenden Allegretto ein Verschleppen. Die Achte versucht in der hier vorgelegten Aufnahme gar nicht erst groß zu erscheinen und kommt so kammermusikalisch herüber wie keine andere der Sinfonien in der Box. Dies irritiert im ersten Moment, rückt das unterschätzte Werk aber auch näher an Haydn heran, dem Beethoven hier wohl eine postume Hommage darbrachte. Die abschließende neunte Sinfonie ist in jeder Gesamteinspielung gewissermaßen die Bewährungsprobe, was nicht nur an ihren Dimensionen, sondern auch am Hinzutreten des Gesangsteils liegt. Nicht wenigen Beethoven-Zyklen bleibt aufgrund Unstimmigkeiten im vokalen Finalsatz der Neunten eine vollumfängliche Empfehlung verwehrt. Einen tendenziellen Vorteil hat diese Neuaufnahme insofern, als einzig Muttersprachler/innen beteiligt sind: Die Sopranistin Regine Hangler, die Altistin Wiebke Lehmkuhl, der Tenor Christian Elsner sowie der Bassist Andreas Bauer Kanabas. Wie in der Parallelaufnahme unter Saraste, wird der WDR Rundfunkchor durch den NDR Chor verstärkt. Mit 64 Minuten Spielzeit zählt Janowskis Interpretation zu den flottesten, zumal unter den Nicht-HIP-Aufnahmen. Der erste Satz gerät in der Tat vorwärtsdrängend, ohne des Guten zu viel, auch wenn man sich in der letzten Minute des Kopfsatzes ein klein wenig mehr maestoso gewünscht hätte. Fetzig die stellenweise sehr prominent hervortretenden Pauken, was der Dramatik zugute kommt. Das wird auch im Scherzo deutlich, in welchem Janowski sämtliche Wiederholungen beachtet, wodurch der Satz mit 14 Minuten annähernd dieselbe Länge aufweist wie der vorangehende. Das Adagio ist gar eine Minute kürzer, wodurch es auf den ersten Blick in Verdacht gerät, etwas zu unterkühlt herübergebracht zu werden. Glücklicherweise stellt sich dieser Eindruck beim tatsächlichen Hören nicht ein. Das Solistenquartett im Schlusssatz ist indes unausgewogen. Während Bauer Kanabas‘ mächtiger Bass Größeres erhoffen lässt, fehlen Elsners lyrischem, etwas glanzlosen Tenor die hier wünschenswerten heldischen Anflüge. Die Damen zumindest individuell und klar voneinander unterscheidbar. Tadellos die Chorleistung. Bis auf minimalste Unsauberkeiten, die sich an einer Hand abzählen lassen, spielt der Klangkörper des Westdeutschen Rundfunks formidabel und unterstreicht die dirigentische Leistung nachdrücklich. Die englisch-deutsche Textbeilage (Text: Kasper van Kooten) fällt gediegen aus. Daniel Hauser
 Auf das berühmteste Ta-ta-ta-taaa der Musik-Geschichte, das die Sinfonik wie eine Wasser-Scheide in ein davor und danach trennen sollte, was man von der Zweiten und Dritten ebenso behaupten könnte, eilte Ludwig van Beethoven in raschen Schritten zu. Er war nach den Verhältnissen der Zeit bereits relativ alt, als er mit 30 Jahren seine erste und im April 1800 in Wien uraufgeführte Sinfonie vorlegte, die von ihrer kunstvollen Einleitung und der durchbrochenen Instrumentation bis zur langsamen Einleitung des vierten Satzes in vieler Hinsicht bemerkenswert ist. In kurzen Abständen schlossen sich die weiteren Sinfonien bis zur Fünften an. Adam Fischer und das Danish Chamber Orchestra bei Naxos weisen in ihrer nun preisgekrönten, kräftig animierten, bei lebhaft ausgewogenen Tempi im Detail geradezu liebevoll ausgeformten und durchsichtig leichten Wiedergabe der C-Dur Sinfonie op. 21 auf das Erbe hin, vor allem die Jupiter-Sinfonie, doch scheint mir vor allem eine menschliche Wärme wie in den Sinfonien Haydns, seit dessen letzter Sinfonie inzwischen fünf Jahre vergangen waren, vorzuherrschen. Die zweite Sinfonie, zwei Jahre später uraufgeführt, spielen Fischer und sein Orchester mit der zielgerichteten Emphase, mit der Beethoven auf das Finale hinarbeitet, gewichtig und ruhig, doch nie schwerfällig im ersten Satz, dem gegenüber der Ersten viel ausgedehnteren Adagio, bis zur aufbäumenden und überwältigenden Coda im vierten Satz. Unter den viele dutzend Gesamteinspielen aller neun Sinfonien gibt es keine, die als Maß der Dinge gilt, wobei weitgehende Einigkeit darüber herrscht, dass Herbert von Karajans erste Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern von 1963 einem Ideal relativ nahekommt. Im Beiheft der Naxos-Box (5 CD in Pappschubern und dän./engl. Beiheft 8.505251) meint Fischer, „Jedes Mal, wenn ich vor 20 Jahren eine CD kaufte, erwartete ich, dass dies die letzte, ultimative Aufnahme eines bestimmten Werkes sein sollte. Doch nach und nach kam ich zu der Überzeugung, dass die Vorstellung von einer ultimativen Aufnahme eine Illusion ist. Sie existiert nicht. Genauso wie ich hinnehmen muss, dass das Orchester und ich unseren Beethoven in ein paar Jahren anders spielen werden. Wie ändern uns alle. Wir werden älter.“
Auf das berühmteste Ta-ta-ta-taaa der Musik-Geschichte, das die Sinfonik wie eine Wasser-Scheide in ein davor und danach trennen sollte, was man von der Zweiten und Dritten ebenso behaupten könnte, eilte Ludwig van Beethoven in raschen Schritten zu. Er war nach den Verhältnissen der Zeit bereits relativ alt, als er mit 30 Jahren seine erste und im April 1800 in Wien uraufgeführte Sinfonie vorlegte, die von ihrer kunstvollen Einleitung und der durchbrochenen Instrumentation bis zur langsamen Einleitung des vierten Satzes in vieler Hinsicht bemerkenswert ist. In kurzen Abständen schlossen sich die weiteren Sinfonien bis zur Fünften an. Adam Fischer und das Danish Chamber Orchestra bei Naxos weisen in ihrer nun preisgekrönten, kräftig animierten, bei lebhaft ausgewogenen Tempi im Detail geradezu liebevoll ausgeformten und durchsichtig leichten Wiedergabe der C-Dur Sinfonie op. 21 auf das Erbe hin, vor allem die Jupiter-Sinfonie, doch scheint mir vor allem eine menschliche Wärme wie in den Sinfonien Haydns, seit dessen letzter Sinfonie inzwischen fünf Jahre vergangen waren, vorzuherrschen. Die zweite Sinfonie, zwei Jahre später uraufgeführt, spielen Fischer und sein Orchester mit der zielgerichteten Emphase, mit der Beethoven auf das Finale hinarbeitet, gewichtig und ruhig, doch nie schwerfällig im ersten Satz, dem gegenüber der Ersten viel ausgedehnteren Adagio, bis zur aufbäumenden und überwältigenden Coda im vierten Satz. Unter den viele dutzend Gesamteinspielen aller neun Sinfonien gibt es keine, die als Maß der Dinge gilt, wobei weitgehende Einigkeit darüber herrscht, dass Herbert von Karajans erste Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern von 1963 einem Ideal relativ nahekommt. Im Beiheft der Naxos-Box (5 CD in Pappschubern und dän./engl. Beiheft 8.505251) meint Fischer, „Jedes Mal, wenn ich vor 20 Jahren eine CD kaufte, erwartete ich, dass dies die letzte, ultimative Aufnahme eines bestimmten Werkes sein sollte. Doch nach und nach kam ich zu der Überzeugung, dass die Vorstellung von einer ultimativen Aufnahme eine Illusion ist. Sie existiert nicht. Genauso wie ich hinnehmen muss, dass das Orchester und ich unseren Beethoven in ein paar Jahren anders spielen werden. Wie ändern uns alle. Wir werden älter.“
Fischer, der sich über Jahrzehnte eine gewissen Jugendlichkeit und gleichbleibende Bescheidenheit bewahrt hat, kann auf eine immense Kapellmeister- und Repertoireerfahrung zurückgreifen. Aus der Talentschmiede Swarowskys kommend, wurde er Korrepetitor in Graz, in jungen Jahren bereits Kapellmeister in Helsinki und Karlsruhe, ab 1981 GMD in Freiburg, dann Kassel und Mannheim, daneben war er ab 1978 Gast an der Bayerischen Staatsoper, wo er Böhm den Fidelio und Kleiber den Otello nachdirigieren durfte, und ab 1982 auch in Wien, wo er, ebenfalls nach dem Fidelio, gleich eine Premiere (Die verkaufte Braut) bekam. Es folgten die weiteren internationalen Häuser von der Met bis zur Scala und schließlich Bayreuth 2001 mit dem Ring, ab 1987 spielte Fischer in Eisenstadt sämtliche 104 Sinfonien Haydns ein, seit 1998 ist er in Kopenhagen Chefdirigent des traditionsreichen Dänischen Rundfunkorchesters, das seit seiner Abwicklung 2014 mittlerweile als unabhängiges Danish Chamber Orchestra firmiert. Mit dem Ensemble spielte Fischer alle Sinfonien Mozart ein, von 2016 bis 2019 folgten die jetzt komplett vorliegenden neun Sinfonien Beethovens; sein zwei Jahre jüngerer Bruder Ivan Fischer war ihm mit dem Concertgebouw Orkest einen Schritt und fünf Jahre voraus. Ein konsequenter Weg. Eine Logik und ein schlüssiger Ansatz, die sich auch im Verlauf des aufnahmetechnisch soliden und interpretatorisch ausgewöhnlichen Kopenhagener Beethoven-Projekts wiederspiegeln: in der durchgehend inspirierten, kraftvoll fest und energisch, mit starker Emphase und bei relativ rascher Spielzeit von 45 Minuten bis zum fesselnden, atemberaubend subtilen, mit vielen Zwischentönen gespielten Finale der Eroica, deren ursprünglicher Titel Sinfonia Eroica … composta per festeggiare il sovvenire di un grande Uomo lautete, in der das Orchester im Pomposo des Trauermarschs fehlenden seidigen Streichglanz durch die Attacke und den Biss der Holzbläser ausgleicht, dann in der ebenso durchsichtig eleganten wie wütend stürmenden, von Bernstein als the biggest surprise package Beethoven has ever handed us bezeichneten vierten Sinfonie op. 60, die Fischer nicht als Nebenwerk zur gleichzeitig entstanden Fünften auffasst und mit starker und einfühlsamer Linie zeigt. Der organische Aufbau der Fünften vom messerscharfen Ta-ta-ta-taa, mit dem das Schicksal an die Tür klopft, zeigt bestürzende Größe wie kurze Augenblicke des Innehaltens, die Streicher, Holzbläser und Horn im Scherzo sind markant, und besitzt eine Spannung die sich im Finale entlädt; eine andere Art Spannung baut Adam Fischer in den getreu der französischen Aufklärung nach retour à la nature rufenden romantischen Szenerien der Pastorale op. 68 auf, in denen das Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande zu einer Sturmszene von elementaren Ausmaß führt. In den lautmalerischen und pastoralen Bildern kann Fischer seine breiten Haydn-Erfahrungen ausspielen, ohne bei diesem Tag auf dem Land pure Kulissenschieberei zu betreiben. Mit geschmeidiger Rhythmik und einem furiosen Finale erklingt die fünf Jahre nach der Pastorale bei ihrer Uraufführung 1813 mit einhelliger Begeisterung aufgenommene Siebte, laut Wagner Eine Apotheose des Tanzes, der eine energische und lichte Widergabe der (vor der siebten Sinfonie aufgenommenen) Achten folgt. Der schlanke an der historischen Aufführungspraxis orientierte Klang, straffe Tempi, pulsierender Rhythmus, Neugierde und ein Sinn für die herben, revolutionär ungestümen Kontraste und die ins Geschehen hineingeschleuderten Kommentare der Soloinstrumente sind kennzeichnend für Fischers ausgezeichnete Interpretation des Zyklus, die sich gleichwohl Ruhe für die ariosen, humoristisch spielerischen und melancholischen Momente nimmt und in der Neunten mit dem Danish National Concert Choir (und enttäuschendem Solistenquartett Sara Swietlicki, Morten Grove Frandsen, Ilker Arcayürek und Lars Møller) die Würde der Ode An die Freude betont. Rolf Fath (Weitere Information zu den CDs/DVDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de.)

Auf den ersten Blick hat es den Eindruck, als habe Roger Norrington, mittlerweile sage und schreibe 86 Jahre alt, einen weiteren Zyklus der neun Beethoven-Sinfonien vorgelegt. Die neue Box von SWR Music (SWR19525CD) vermittelt zumindest zunächst diesen Eindruck. Dass es sich um eine Neuauflage der Anfang der 2000ern erschienen Einzel-CDs handelt, wird erst bei genauerem Hinsehen klar. Die Beethoven-Beschäftigung Norringtons geht indes noch weiter zurück, denn bereits in den späten 1980er Jahren legte er einen ersten, in Teilen sehr umstrittenen Zyklus mit den London Classical Players vor (EMI bzw. Erato). Der zweite Zyklus, um den es hier gehen soll, entstand während Norringtons Tätigkeit als Chefdirigent des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart (1998-2011), welches 2016 mit dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg zum SWR-Symphonieorchester fusionierte. Obwohl es sich bei den zwischen 29. August und 8. September 2002 im Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle anlässlich des Europäischen Musikfestes entstandenen Einspielungen genau genommen um Live-Mitschnitte handelt, ist die Klangqualität frappierend gelungen und sind Störgeräusche weitestgehend nicht zu vernehmen. Einzig der jeweils enthaltene, recht lange Applaus verdeutlicht den Charakter dieser Aufnahmen. Augenscheinlich wurde für diese Produktionen auch nicht nachgebessert, weshalb ein paar vernachlässigbare Unsauberkeiten im Orchesterspiel stehengeblieben sind, was freilich wiederum der Authentizität zuträglich ist. Obwohl ich mich selbst nicht gerade als Anhänger dieses Dirigenten bezeichnen würde, der bekanntlich einem berühmt-berüchtigten Nonvibrato-Klangideal huldigt, bleibt doch festzustellen, dass es sich im Großen und Ganzen um einen wirklich überzeugenden und legitimen Beethoven-Ansatz handelt, der sehr zugespitzt sein kann, aber nie übertrieben oder willkürlich erscheint. Manche Details arbeitet Norrington dergestalt heraus, dass man meint, das noch nie auf diese Weise vernommen zu haben. Die dynamische Bandbreite des Ausdrucks ist gewaltig und einzelne Instrumente sind durch die große Transparenz klar verortbar. Es wird zwar auf modernem Instrumentarium und mit großem Orchester musiziert, doch klar von der historischen Aufführungspraxis beeinflusst. Während manche der Sinfonien von dieser Herangehensweise hörbar profitieren (etwa eine stark aufgewertete Achte, eine gar nicht romantisierte Pastorale und eine wirklich formidable Vierte, die an die ganz großen Interpreten der Vergangenheit denken lässt – großartig die Überleitung vom anfänglichen Adagio zum Allegro vivace), kommt mit der Fünften das Schlachtross etwas holzschnittartig herüber, auch wenn selbst da gewisse Stellen wie die hier sehr paukenlastig geratene mysteriöse Überleitung in den Finalsatz gut gelingen. Norrington erzielt Kontraste eher durch Modulation der Lautstärke, weniger durch Eingriffe in die Agogik. Die ersten beiden Sinfonien werden durch diese Konzept aufgewertet; bei der Eroica stößt es wiederum an seine Grenzen, passen zum heroischen Pathos dann wohl doch eher andere Ansätze. Wirklich feurig gelingt die Siebente, bei der man im Finalsatz (schön mit geteilten Streichern) atemlos zurückbleibt. Norrington lässt offenbar sämtliche Wiederholungen spielen. Mit kaum 63 Minuten Spielzeit legt er eine der flottesten Aufnahmen der Neunten vor. Bereits im Kopfsatz Sturm und Drang, keine proto-brucknerische Vergeistigung. Durchaus gangbar. Dies gilt auch für das Adagio mit gerade zwölf Minuten. Problematisch allerdings, dass sich beide Sätze dadurch temporal nicht mehr so stark vom dazwischen liegenden, hier mächtig donnernden Scherzo unterscheiden – klar einer der stärksten Sätze der Gesamtaufnahme. Gradmesser bei diesem Werk ist immer der Finalsatz, bei welchem unterschiedliche Faktoren zusammenkommen müssen, damit aus einer sehr guten eine herausragende Aufnahme wird. Das Solistenquartett ist mit Camilla Nylund (Sopran), Iris Vermillion (Alt), Jonas Kaufmann (Tenor) sowie Franz-Josef Selig (Bass) prominent besetzt. Seligs schlanker und wohlklingender Bass gibt bereits die Richtung vor. Keiner der Solisten versucht sich künstlich in den Vordergrund zu drängen und ist doch immer gut herauszuhören. Kaufmann, seinerzeit noch auf dem Wege vom lyrischen Tenor zum jugendlichen Heldentenor, muss zuvörderst genannt werden. Die von Helmuth Rilling gegründete und seinerzeit auch noch geleitete, hier allerdings von Klaus Breuninger einstudierte Gächinger Kantorei Stuttgart kann ihre Stellung als einer der führenden gemischten deutschen Chöre eindrucksvoll unter Beweis stellen. Tendenziell ist Norrington den Tempovorstellungen seiner ersten Gesamteinspielung aus den 80er Jahren treu geblieben, hat allerdings freilich ein paar besonders strittige Entscheidungen dieses Mal abgemildert. So war der langsame Satz der Neunten in der Erstaufnahme sogar noch eine Minute schneller. Und das vielfach angekreidete halbe Tempo des türkischen Marsches beim Tenor-Solo entfällt diesmal. Wie ist diese Neuauflage des SWR-Zyklus also abschließend zu beurteilen? Alter Wein in neuen Schläuchen? Ja, aber der wird ja mit den Jahren zuweilen immer besser. Höchst individuell, im Detail manchmal streitbar, aber auf jeden Fall kein 08/15-Beethoven von der Stange. (Weitere Information zu den CDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de.) Daniel Hauser
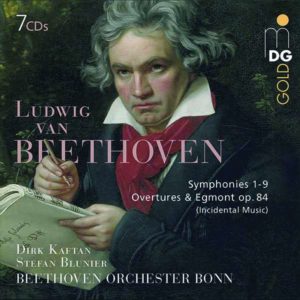 Dass auch Beethovens Geburtsstadt Bonn ihren Teil zum großen Jubiläumsjahr beiträgt, ist nur würdig und recht. Auf insgesamt sieben CDs verteilen sich die neun Sinfonien, sieben Ouvertüren und gleichsam als Zugabe die Schauspielmusik zu Goethes Trauerspiel Egmont, wie sie Musikproduktion Dabringhaus und Grimm nun, in eine Box zusammengefasst, präsentiert (MDG 337 2170-2). Komplett neu ist daraus eigentlich nichts, datieren die Einspielungen doch auf die Jahre 2012 bis 2018 und waren bereits zuvor als Einzel-CDs erhältlich. Aufregend unaufgeregt könnte man den Bonner Zyklus nennen, der zumindest bei den Instrumentalwerken auf keine großen Namen setzt. Abgesehen von der Egmont-Schauspielmusik zeichnet Stefan Blunier, zwischen 2008 und 2016 Generalmusikdirektor der Bundesstadt Bonn und somit Chefdirigent des Beethoven Orchesters Bonn, verantwortlich. Sein Nachfolger Dirk Kaftan hat dann noch die Bühnenmusik beigesteuert, bei welcher man den berühmten Schauspieler Matthias Brandt, Sohn des früheren Bundeskanzlers, aufbieten kann, während Olga Bezsmertna den Sopranpart übernimmt. Um bei den Vokalisten zu bleiben, bilden Elza van den Heever, Janina Baechle, Robert Dean Smith sowie Georg Zeppenfeld das Solistenquartett in der neunten Sinfonie, unterstützt vom Tschechischen Philharmonischen Chor Brünn (Chorleitung: Petr Fiala). Durchaus geläufige Namen, insbesondere die beiden Herren. In ihrem Beethoven-Ansatz ähneln sich die Dirigenten; ein direkter Vergleich ist mittels der Egmont-Ouvertüre möglich, die auch schon Blunier (eine Minute langsamer) eingespielt hat. Das Motto dieser Aufnahmen könnte man als Vermeidung jedweden Ansatzes von Pathos bezeichnen, was freilich keine wirkliche Revolution in Sachen Beethoven-Rezeption darstellt. Weshalb sollte man sich also diese Bonner Aufnahmen ins Regal stellen? Der Beethoven-Markt ist seit langem saturiert, und dennoch gibt es von kaum einem anderen Sinfoniker eine solch hohe, nicht nachlassende Zahl jährlich neu vorgelegter Einspielungen. Klanglich können die Bonner Produktionen locker mit berühmteren mithalten. Frisch und ziemlich zügig geht Blunier zur Sache, vermeidet es aber glücklicherweise, zu überdrehen. Luftig-leicht etwa der Kopfsatz der Fünften, der jede Erdenschwere abgeht. Die Tempi flüssig und ohne Extravaganzen, hie und da dann aber dennoch mit interessanten Farbtupfern durch dieses oder jenes besonders herausgestellte Instrument. Obwohl auf modernem Instrumentarium musiziert wird, gibt es (selbstredend) Einflüsse der historischen Aufführungspraxis. Beethoven nicht als Titan, sondern mit Bodenhaftung. Interessanterweise lässt Blunier nicht sämtliche Wiederholungen spielen (auffällig besonders im Finalsatz der Fünften). Bei den „kleinen“ Sinfonien (Nr. 1, 2 und 8) zeitigt die unprätentiöse Herangehensweise womöglich ihre überzeugendsten Ergebnisse. Schön, dass auch die viel zu selten berücksichtigte Ouvertüre Zur Namensfeier bedacht wurde. Insgesamt fehlt den Ouvertüren aber ein wenig die Gewichtigkeit, die man sich zumal im Coriolan und Egmont wünscht – in letzterer bei Kaftan mit gerade einmal 7:22 Minuten Spielzeit noch ausgeprägter, aber in ihrer Konsequenz, wenn man diesen Ansatz bereit ist mitzugehen, gar überzeugender. Die Güte des Beethoven Orchesters Bonn, das in deutscher Aufstellung spielt, ist ganz allgemein über jeden Zweifel erhaben. Ob im schwungvoll ausgespielten Kopfsatz der Eroica, in der verträumten Szene am Bach in der Pastorale (später mit fulminantem Gewittersturm) oder im erstaunlich getragenen Allegretto der Siebenten, bei ihrem Namensgeber sind die Bonner spürbar in ihrem Element. Stark gerät die oftmals unterschätzte Vierte mit hingebungsvollen Nuancen bei den Holzbläsern. Und wie sieht es bei den Werken mit Gesangsbeteiligung aus? Blunier macht aus der Neunten keine Ego-Show, lässt die Musik einfach für sich selbst sprechen. Indem er sich weder eindeutig für die rein klassische noch die betont romantische Lesart entscheidet, trifft er am Ende gerade besonders einen adäquaten Tonfall, steht die Chorsinfonie doch gerade für diese Zeitenwende. An dieser Stelle ist ein Sonderlob für den Paukisten vonnöten, der im Scherzo sein Bestes gibt. Das Adagio ist weder verhetzt noch verschleppt. Alle vier zuvor genannte Solisten, besonders die Herren, haben sich gerade im Wagner-Gesang einen Namen gemacht. Georg Zeppenfelds schlanker, gut geführter Bass ist auch berüchtigten Höhen gewachsen. Robert Dean Smith ist vielleicht nicht ganz so heroisch wie andere Solo-Tenöre, doch auch im bereits vorgerückten Alter durchaus zufriedenstellend. Elza van den Heever und Janina Baechle erliegen nicht der Versuchung, sich gegenseitig überbieten zu wollen, und sind durch ihr sehr unterschiedliches Timbre eine Bereicherung. Die deutsche Diktion ist bei allen vorbildlich. So auch beim sehr guten Chor aus dem tschechischen Brünn. Gleichsam als Bonus, wie gesagt, die Schauspielmusik zu Egmont unter dem Dirigat von Dirk Kaftan. Genau genommen handelt es sich hierbei um eine Bearbeitung von Tilmann Böttcher und Matthias Brandt, der auch als Erzähler auftritt, die sich auf wichtige Nummern beschränkt, also keine vollständige Einspielung darstellt. Brandt, ein bekannter Schauspieler, hat sich einem bewusst (stellenweise gar zu) unpathetischen Vortrag verschrieben, was mit dem Interpretationsstil Kaftans Hand in Hand geht. Diese moderne Herangehensweise kontrastiert insofern bewusst mit den traditionellen Lesarten von Hermann Scherchen und George Szell, deren Erzähler auf (durchaus adäquates) Pathos setzen. Wie dem auch sei, vielleicht ist dies ein Egmont fürs 21. Jahrhundert. Die kurzen Gesangspassagen steuert die aus der Ukraine stämmige Sopranistin Olga Bezsmertna völlig rollendeckend mit schöner Klangfarbe bei. Diese Beethoven-Box aus der Beethoven-Stadt Bonn ist keineswegs provinziell und braucht also summa summarum keine Vergleiche zu scheuen, auch wenn sie schwerlich die einzige Gesamtaufnahme der Sinfonien in einer Sammlung sollte, eher eine feine, nicht ganz ins Auge springende Ergänzung darstellen wird. Daniel Hauser (Weitere Information zu den CDs/DVDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de.)
Dass auch Beethovens Geburtsstadt Bonn ihren Teil zum großen Jubiläumsjahr beiträgt, ist nur würdig und recht. Auf insgesamt sieben CDs verteilen sich die neun Sinfonien, sieben Ouvertüren und gleichsam als Zugabe die Schauspielmusik zu Goethes Trauerspiel Egmont, wie sie Musikproduktion Dabringhaus und Grimm nun, in eine Box zusammengefasst, präsentiert (MDG 337 2170-2). Komplett neu ist daraus eigentlich nichts, datieren die Einspielungen doch auf die Jahre 2012 bis 2018 und waren bereits zuvor als Einzel-CDs erhältlich. Aufregend unaufgeregt könnte man den Bonner Zyklus nennen, der zumindest bei den Instrumentalwerken auf keine großen Namen setzt. Abgesehen von der Egmont-Schauspielmusik zeichnet Stefan Blunier, zwischen 2008 und 2016 Generalmusikdirektor der Bundesstadt Bonn und somit Chefdirigent des Beethoven Orchesters Bonn, verantwortlich. Sein Nachfolger Dirk Kaftan hat dann noch die Bühnenmusik beigesteuert, bei welcher man den berühmten Schauspieler Matthias Brandt, Sohn des früheren Bundeskanzlers, aufbieten kann, während Olga Bezsmertna den Sopranpart übernimmt. Um bei den Vokalisten zu bleiben, bilden Elza van den Heever, Janina Baechle, Robert Dean Smith sowie Georg Zeppenfeld das Solistenquartett in der neunten Sinfonie, unterstützt vom Tschechischen Philharmonischen Chor Brünn (Chorleitung: Petr Fiala). Durchaus geläufige Namen, insbesondere die beiden Herren. In ihrem Beethoven-Ansatz ähneln sich die Dirigenten; ein direkter Vergleich ist mittels der Egmont-Ouvertüre möglich, die auch schon Blunier (eine Minute langsamer) eingespielt hat. Das Motto dieser Aufnahmen könnte man als Vermeidung jedweden Ansatzes von Pathos bezeichnen, was freilich keine wirkliche Revolution in Sachen Beethoven-Rezeption darstellt. Weshalb sollte man sich also diese Bonner Aufnahmen ins Regal stellen? Der Beethoven-Markt ist seit langem saturiert, und dennoch gibt es von kaum einem anderen Sinfoniker eine solch hohe, nicht nachlassende Zahl jährlich neu vorgelegter Einspielungen. Klanglich können die Bonner Produktionen locker mit berühmteren mithalten. Frisch und ziemlich zügig geht Blunier zur Sache, vermeidet es aber glücklicherweise, zu überdrehen. Luftig-leicht etwa der Kopfsatz der Fünften, der jede Erdenschwere abgeht. Die Tempi flüssig und ohne Extravaganzen, hie und da dann aber dennoch mit interessanten Farbtupfern durch dieses oder jenes besonders herausgestellte Instrument. Obwohl auf modernem Instrumentarium musiziert wird, gibt es (selbstredend) Einflüsse der historischen Aufführungspraxis. Beethoven nicht als Titan, sondern mit Bodenhaftung. Interessanterweise lässt Blunier nicht sämtliche Wiederholungen spielen (auffällig besonders im Finalsatz der Fünften). Bei den „kleinen“ Sinfonien (Nr. 1, 2 und 8) zeitigt die unprätentiöse Herangehensweise womöglich ihre überzeugendsten Ergebnisse. Schön, dass auch die viel zu selten berücksichtigte Ouvertüre Zur Namensfeier bedacht wurde. Insgesamt fehlt den Ouvertüren aber ein wenig die Gewichtigkeit, die man sich zumal im Coriolan und Egmont wünscht – in letzterer bei Kaftan mit gerade einmal 7:22 Minuten Spielzeit noch ausgeprägter, aber in ihrer Konsequenz, wenn man diesen Ansatz bereit ist mitzugehen, gar überzeugender. Die Güte des Beethoven Orchesters Bonn, das in deutscher Aufstellung spielt, ist ganz allgemein über jeden Zweifel erhaben. Ob im schwungvoll ausgespielten Kopfsatz der Eroica, in der verträumten Szene am Bach in der Pastorale (später mit fulminantem Gewittersturm) oder im erstaunlich getragenen Allegretto der Siebenten, bei ihrem Namensgeber sind die Bonner spürbar in ihrem Element. Stark gerät die oftmals unterschätzte Vierte mit hingebungsvollen Nuancen bei den Holzbläsern. Und wie sieht es bei den Werken mit Gesangsbeteiligung aus? Blunier macht aus der Neunten keine Ego-Show, lässt die Musik einfach für sich selbst sprechen. Indem er sich weder eindeutig für die rein klassische noch die betont romantische Lesart entscheidet, trifft er am Ende gerade besonders einen adäquaten Tonfall, steht die Chorsinfonie doch gerade für diese Zeitenwende. An dieser Stelle ist ein Sonderlob für den Paukisten vonnöten, der im Scherzo sein Bestes gibt. Das Adagio ist weder verhetzt noch verschleppt. Alle vier zuvor genannte Solisten, besonders die Herren, haben sich gerade im Wagner-Gesang einen Namen gemacht. Georg Zeppenfelds schlanker, gut geführter Bass ist auch berüchtigten Höhen gewachsen. Robert Dean Smith ist vielleicht nicht ganz so heroisch wie andere Solo-Tenöre, doch auch im bereits vorgerückten Alter durchaus zufriedenstellend. Elza van den Heever und Janina Baechle erliegen nicht der Versuchung, sich gegenseitig überbieten zu wollen, und sind durch ihr sehr unterschiedliches Timbre eine Bereicherung. Die deutsche Diktion ist bei allen vorbildlich. So auch beim sehr guten Chor aus dem tschechischen Brünn. Gleichsam als Bonus, wie gesagt, die Schauspielmusik zu Egmont unter dem Dirigat von Dirk Kaftan. Genau genommen handelt es sich hierbei um eine Bearbeitung von Tilmann Böttcher und Matthias Brandt, der auch als Erzähler auftritt, die sich auf wichtige Nummern beschränkt, also keine vollständige Einspielung darstellt. Brandt, ein bekannter Schauspieler, hat sich einem bewusst (stellenweise gar zu) unpathetischen Vortrag verschrieben, was mit dem Interpretationsstil Kaftans Hand in Hand geht. Diese moderne Herangehensweise kontrastiert insofern bewusst mit den traditionellen Lesarten von Hermann Scherchen und George Szell, deren Erzähler auf (durchaus adäquates) Pathos setzen. Wie dem auch sei, vielleicht ist dies ein Egmont fürs 21. Jahrhundert. Die kurzen Gesangspassagen steuert die aus der Ukraine stämmige Sopranistin Olga Bezsmertna völlig rollendeckend mit schöner Klangfarbe bei. Diese Beethoven-Box aus der Beethoven-Stadt Bonn ist keineswegs provinziell und braucht also summa summarum keine Vergleiche zu scheuen, auch wenn sie schwerlich die einzige Gesamtaufnahme der Sinfonien in einer Sammlung sollte, eher eine feine, nicht ganz ins Auge springende Ergänzung darstellen wird. Daniel Hauser (Weitere Information zu den CDs/DVDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de.)
 Ironie des Schicksals, dass es nun der Deutschen Grammophon Gesellschaft zukommt, sich des über Jahrzehnte vernachlässigten diskographischen Nachlasses des deutsch-amerikanischen Dirigenten William Steinberg anzunehmen. Dieser, 1899 in Köln als Hans Wilhelm Steinberg geboren, wurde als Jude 1936 in die Emigration gezwungen, wirkte an der Gründung des heutigen Israel Philharmonic Orchestra mit und machte insbesondere in den Vereinigten Staaten Karriere. Steinberg war bereits Mitte der 1920er Jahre zeitweilig Assistent von Otto Klemperer an der Kölner Oper und durchaus schon vor seinem Zwangsexil eine Dirigentenpersönlichkeit von Rang. Dass er in Deutschland bis zum heutigen Tage nur Kennern ein Begriff ist, wird man insofern unter die zahllosen Folgen des Aufstiegs des Nationalsozialismus mit all seinen furchtbaren Konsequenzen verbuchen können. Immerhin kehrte er in der Nachkriegszeit ab und zu in seine Heimatstadt zurück und machte beim WDR auch einige Rundfunkproduktionen, von welchen Mahlers zweite Sinfonie und Beethovens Missa solemnis bei ICA erschienen sind. Der Bonner Großmeister steht auch in der nunmehrigen DG-Box im Mittelpunkt, handelt es sich doch um die CD-Premiere des kompletten Zyklus der neun Sinfonien von Beethoven unter Steinbergs Leitung (DG 00028948383443). Diese Einspielungen, entstanden zwischen 1962 und 1966, sind ursprünglich beim US-Label Command Classics erschienen; die Rechte fielen später an die Deutsche Grammophon. Tatsächlich hatte William Steinberg indes einen astreinen Plattenvertrag mit der DG, wenngleich dieser in seine letzten Jahre datiert, nachdem er 1969 mit siebzig Jahren doch noch das Boston Symphony Orchestra (BSO; 1969-1972) übernommen hatte. Schon 1962 beim Abgang von Charles Munch war er der Wunschkandidat der Bostoner gewesen, doch setzte sich seinerzeit noch das mächtige Label RCA durch, welches den besonders als Operndirigenten zu Weltruhm gelangten Erich Leinsdorf präferierte. Auch wenn die drei Jahre mit dem BSO fraglos den künstlerischen Höhepunkt in der Dirigentenlaufbahn Steinberg darstellen, so geht sein anhaltender Nachruhm doch in erster Linie auf seine ein Vierteljahrhundert umfassende Chefdirigententätigkeit beim Pittsburgh Symphony Orchestra (PSO; 1952-1976) zurück. Zunehmende gesundheitliche Probleme erzwangen schließlich seinen Rückzug; zwei Jahre später starb Steinberg knapp 79-jährig in New York City. Das PSO hatte indes gewissermaßen das Pech, dass es trotz all seiner unbestreitbaren Qualitäten, die unter Steinberg und vor ihm unter dem strengen Orchestererzieher Fritz Reiner zuwege gebracht wurden, im Schatten der sogenannten „Big Five“ stand (New York Philharmonic, Boston Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra). So hatte sich der Steinberg’sche Beethoven-Zyklus bereits bei seinem Erscheinen gegen hochberühmte Konkurrenz in Gestalt von Leonard Bernstein (New York), Erich Leinsdorf (Boston), Eugene Ormandy (Philadelphia), George Szell (Cleveland) und nicht zuletzt auch Bruno Walter (mit dem eigens zusammengestellten Columbia Symphony Orchestra, mit Musikern hauptsächlich des Los Angeles Philharmonic und auch aus Hollywood) zu behaupten; später kam noch Sir Georg Solti (Chicago) hinzu. Auf dem deutschen Tonträgermarkt scheint der Steinberg-Beethoven praktisch überhaupt keine Rolle gespielt zu haben. Dadurch, dass er Jahrzehnte lang alles andere als leicht greifbar war, verstärkte sich diese Problematik, selbst wenn MCA zumindest einige der Sinfonien in der CD-Frühzeit weitgehend unbeachtet auf den Markt brachte. Denkt man heute an William Steinberg, so werden noch am ehesten seine phänomenalen Bostoner Aufnahmen der Planets von Gustav Holst und von Also sprach Zarathustra von Richard Strauss im allgemeinen Bewusstsein verankert sein. Bereits seine RCA-Einspielungen von Schuberts Großer Sinfonie in C-Dur sowie Bruckners sechster Sinfonie erreichten in Europa niemals diesen Bekanntheitsgrad.
Ironie des Schicksals, dass es nun der Deutschen Grammophon Gesellschaft zukommt, sich des über Jahrzehnte vernachlässigten diskographischen Nachlasses des deutsch-amerikanischen Dirigenten William Steinberg anzunehmen. Dieser, 1899 in Köln als Hans Wilhelm Steinberg geboren, wurde als Jude 1936 in die Emigration gezwungen, wirkte an der Gründung des heutigen Israel Philharmonic Orchestra mit und machte insbesondere in den Vereinigten Staaten Karriere. Steinberg war bereits Mitte der 1920er Jahre zeitweilig Assistent von Otto Klemperer an der Kölner Oper und durchaus schon vor seinem Zwangsexil eine Dirigentenpersönlichkeit von Rang. Dass er in Deutschland bis zum heutigen Tage nur Kennern ein Begriff ist, wird man insofern unter die zahllosen Folgen des Aufstiegs des Nationalsozialismus mit all seinen furchtbaren Konsequenzen verbuchen können. Immerhin kehrte er in der Nachkriegszeit ab und zu in seine Heimatstadt zurück und machte beim WDR auch einige Rundfunkproduktionen, von welchen Mahlers zweite Sinfonie und Beethovens Missa solemnis bei ICA erschienen sind. Der Bonner Großmeister steht auch in der nunmehrigen DG-Box im Mittelpunkt, handelt es sich doch um die CD-Premiere des kompletten Zyklus der neun Sinfonien von Beethoven unter Steinbergs Leitung (DG 00028948383443). Diese Einspielungen, entstanden zwischen 1962 und 1966, sind ursprünglich beim US-Label Command Classics erschienen; die Rechte fielen später an die Deutsche Grammophon. Tatsächlich hatte William Steinberg indes einen astreinen Plattenvertrag mit der DG, wenngleich dieser in seine letzten Jahre datiert, nachdem er 1969 mit siebzig Jahren doch noch das Boston Symphony Orchestra (BSO; 1969-1972) übernommen hatte. Schon 1962 beim Abgang von Charles Munch war er der Wunschkandidat der Bostoner gewesen, doch setzte sich seinerzeit noch das mächtige Label RCA durch, welches den besonders als Operndirigenten zu Weltruhm gelangten Erich Leinsdorf präferierte. Auch wenn die drei Jahre mit dem BSO fraglos den künstlerischen Höhepunkt in der Dirigentenlaufbahn Steinberg darstellen, so geht sein anhaltender Nachruhm doch in erster Linie auf seine ein Vierteljahrhundert umfassende Chefdirigententätigkeit beim Pittsburgh Symphony Orchestra (PSO; 1952-1976) zurück. Zunehmende gesundheitliche Probleme erzwangen schließlich seinen Rückzug; zwei Jahre später starb Steinberg knapp 79-jährig in New York City. Das PSO hatte indes gewissermaßen das Pech, dass es trotz all seiner unbestreitbaren Qualitäten, die unter Steinberg und vor ihm unter dem strengen Orchestererzieher Fritz Reiner zuwege gebracht wurden, im Schatten der sogenannten „Big Five“ stand (New York Philharmonic, Boston Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra). So hatte sich der Steinberg’sche Beethoven-Zyklus bereits bei seinem Erscheinen gegen hochberühmte Konkurrenz in Gestalt von Leonard Bernstein (New York), Erich Leinsdorf (Boston), Eugene Ormandy (Philadelphia), George Szell (Cleveland) und nicht zuletzt auch Bruno Walter (mit dem eigens zusammengestellten Columbia Symphony Orchestra, mit Musikern hauptsächlich des Los Angeles Philharmonic und auch aus Hollywood) zu behaupten; später kam noch Sir Georg Solti (Chicago) hinzu. Auf dem deutschen Tonträgermarkt scheint der Steinberg-Beethoven praktisch überhaupt keine Rolle gespielt zu haben. Dadurch, dass er Jahrzehnte lang alles andere als leicht greifbar war, verstärkte sich diese Problematik, selbst wenn MCA zumindest einige der Sinfonien in der CD-Frühzeit weitgehend unbeachtet auf den Markt brachte. Denkt man heute an William Steinberg, so werden noch am ehesten seine phänomenalen Bostoner Aufnahmen der Planets von Gustav Holst und von Also sprach Zarathustra von Richard Strauss im allgemeinen Bewusstsein verankert sein. Bereits seine RCA-Einspielungen von Schuberts Großer Sinfonie in C-Dur sowie Bruckners sechster Sinfonie erreichten in Europa niemals diesen Bekanntheitsgrad.
Wie also klingt dieser obskure Beethoven aus Pittsburgh, der nun endlich allgemein greifbar ist? Zuvörderst muss den Tontechnikern ein ganz herzliches Lob ausgesprochen werden. Wer die bisherige CD-Transfers (MCA) und diverse mehr oder weniger professionelle Digitalisierungen der alten Command-Schallplatten kennt, wird es kaum glauben können, was die DG hier herausgeholt hat. Offenbar konnte auf die Masterbänder zurückgegriffen werden. Klanglich braucht sich das Ergebnis jedenfalls nicht vor den etwa zeitgleich entstandenen Konkurrenzzyklen verstecken. Allenfalls ist eine gewisse Bassarmut und eine recht ausgeprägte Einbettung des Schlagwerkes in den Gesamtklang zu konstatieren, was freilich der Philosophie des Toningenierus entsprochen haben dürfte, denn vergleicht man mit Live-Mitschnitten dieses Dirigenten, so kann von sich zu sehr im Hintergrund befindlichen Pauken nicht im Mindesten die Rede sein. Die dirigentischen Qualitäten Steinbergs zu loben, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Alles ist organisch und im Fluss, die gewählten Tempi sind stets ansprechend und in sich schlüssig. Weihrauch ist Steinbergs Sache nicht, doch verleugnet er seine Verwurzelung in der Spätromantik keinesfalls, was sich schon in der aus heutiger Sicht unidiomatischen Verwendung der Mahler-Retuschen (besonders auffällig in der Neunten) ausdrückt. Gleichwohl ist Steinbergs Beethoven vergleichsweise sachlich, gewissermaßen der Gegenentwurf zur vollblütigen Romantik eines Bruno Walter, aber auch zum zuweilen gleißend anmutenden Ansatz Herbert von Karajans. Oft wird leichtfertig hingeschrieben, dieser und jener Dirigent werte besonders die „kleinen“ Sinfonien auf, doch trifft es bei Steinberg in besonderem Maße zu. Gerade die Achte war seine ganz besondere Spezialität. Bei Steinberg ist die Pastorale wirklich pastoral, auch beim Gewittersturm nicht infernal, die Eroica in ihrer Klassizität maßstäblich. Bei der Fünften ist die Feld besonders weit; auch hier schwimmt er weit vorne mit. Den heftigen Ausbruch im Finalsatz der Siebenten erreichen in dieser Form nicht viele (es sei in diesem Zusammenhang auch auf eine ebenfalls bei ICA erschienene DVD mit einem Mitschnitt aus Boston verwiesen). Quasi als Bonus ist auch die dritte Leonoren-Ouvertüre inkludiert – man wünschte sich gar einige der Ouvertüren mehr. Die in Amerika häufig als Choral Symphony bezeichnete Neunte ist trotz des nicht eben prominenten Solistenquartetts im Finalsatz (Ella Lee, Joanna Simon, Richard Kness, Thomas Paul) absolut hörenswert. In der Summe also eine ernsthafte 60er-Jahre-Alternative zu Karajan und Co. Daniel Hauser
 Nein, einen kompletten Beethoven-Zyklus der neun Sinfonien hat Hans Rosbaud vor seinem Ableben nicht mehr vorlegen können, doch ist das, was der SWR – diesmal in Zusammenarbeit mit dem WDR – auf den Markt bringt, gleichwohl von großem historischen Interesse (SWR19089CD). Eine insgesamt sieben CDs umfassende Box, welche abgesehen von der Vierten und der Neunten die übrigen Sinfonien enthält (die Achte gar zweifach), dazu fünf Ouvertüren, das fünfte Klavierkonzert (mit Géza Anda), das Violinkonzert (mit Ginette Neveu) sowie das Tripelkonzert (mit Dario de Rosa, Renato Zanettovich und Libero Lana, die als Trio di Trieste firmierten). Entstanden sind diese Rundfunkproduktionen in den Jahren zwischen 1949 und 1962 (Rosbauds Todesjahr), mehrheitlich für den Südwestfunk Baden-Baden; im Falle der zweiten Sinfonie handelt es sich um eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln von 1959. Es ist zu begrüßen, dass diese hier ebenfalls beigesteuert wurde. Der Beethoven-Ansatz ist freilich in Baden-Baden wie in Köln derselbe und trägt eindeutig die Handschrift Rosbauds: nüchtern, nicht übermäßig gefühlsbetont und eng an der Partitur. Von daher ist dieser Beethoven viel eher der Lesart Hermann Scherchens und René Leibowitz‘ zuzuordnen denn jener Wilhelm Furtwänglers und Hans Knappertsbuschs, um nur einige wenige bedeutende Beethoven-Dirigenten der 1950er und 60er Jahre zu benennen. Jahrzehnte lange musste man auf diese offiziellen Editionen des SWR warten. In Sammlerkreisen kursierten diverse Aufnahmen natürlich schon lange als private Mitschnitte. Besser haben sie aber bis jetzt nicht geklungen (Remastering der originalen Tonbänder), auch wenn die natürlichen Limitierungen des Mono-Klanges nicht zu leugnen sind und es einmal wieder schade ist, dass die deutschen Rundfunkanstalten erst in der zweiten Hälfte der 1960er allmählich auf die Stereophonie umstiegen – zu spät für Rosbaud. Hörenswert ist das Dargebotene auch heute noch, so man geneigt ist, sich darauf einzulassen. Sowohl das Südwestfunk-Orchester (dem Rosbaud zwischen 1948 und 1962 als Chefdirigent vorstand) als auch das Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester (so die damalig gebräuchlichen Bezeichnungen) offerieren die bereits seinerzeit gebotene hohe Spielkultur, selbst wenn die jeweiligen Klangkörper bis zum heutigen Tage nochmal an Qualität zugelegt haben. Rosbauds Beethoven widerlegt eindrucksvoll, dass er viel mehr war als bloßer Experte für moderne Musik, als welcher er lange Zeit abgestempelt wurde. Allerdings ist die hörbare Strenge seines Dirigats womöglich in der Tat nicht zuletzt durch seine Erfahrung mit der Musik des 20. Jahrhunderts zurückzuführen. Willkürliche Temporückungen im Stile der Spätromantik wird man hier kaum finden. Vor zeitweiliger Schroffheit schreckt Rosbaud nicht zurück, so etwa im angriffslustig vorgetragenen Kopfsatz der 1961 eingespielten Fünften. Dabei erzielt der Dirigent das dem Werk innewohnende revolutionäre Momentum nicht durch heilloses Gehetze, sondern durch akribische Herausarbeitung der Strukturen mit besonders hervorgehobenen Instrumenten (insbesondere die Holz- und Blechbläser brillieren). Stellenweise hört man Beethoven hier wirklich neu. Hochkarätig sind auch die Instrumentalsolisten, die zum Einsatz kamen. Zuvörderst und auch chronologisch als erstes ist hier die in Paris geborene französische Violinistin Ginette Neveu anzuführen, deren Weltkarriere, gerade erst dreißigjährig, infolge eines Flugzeugabsturzes am 28. Oktober 1949 aufhörte, bevor sie wirklich begann. Die vorliegende Rundfunkaufnahme des Violinkonzerts entstand beinahe exakt einen Monat vor dieser Tragödie, am 25. September 1949 im Kurhaus Baden-Baden. Beinahe alle übrigen Aufnahmen wurden übrigens im bewährten Studio V, dem späteren Hans-Rosbaud-Studio, in Baden-Baden eingespielt. Der Aufnahmeort der einzigen Kölner Produktion lässt sich nicht mehr ermitteln. Das Klavierkonzert Nr. 5 mit dem legendären Géza Anda datiert auf 1956, das Tripelkonzert mit dem Trio di Trieste schließlich auf 1953. Bei der im September 1962 eingespielten Produktion der siebenten Sinfonie handelt es sich um eine der letzten Aufnahmen Rosbauds, der am 29. Dezember desselben Jahres 67-jährig in Lugano einer schweren Erkrankung erlag. Daniel Hauser (Weitere Information zu den CDs/DVDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de.)
Nein, einen kompletten Beethoven-Zyklus der neun Sinfonien hat Hans Rosbaud vor seinem Ableben nicht mehr vorlegen können, doch ist das, was der SWR – diesmal in Zusammenarbeit mit dem WDR – auf den Markt bringt, gleichwohl von großem historischen Interesse (SWR19089CD). Eine insgesamt sieben CDs umfassende Box, welche abgesehen von der Vierten und der Neunten die übrigen Sinfonien enthält (die Achte gar zweifach), dazu fünf Ouvertüren, das fünfte Klavierkonzert (mit Géza Anda), das Violinkonzert (mit Ginette Neveu) sowie das Tripelkonzert (mit Dario de Rosa, Renato Zanettovich und Libero Lana, die als Trio di Trieste firmierten). Entstanden sind diese Rundfunkproduktionen in den Jahren zwischen 1949 und 1962 (Rosbauds Todesjahr), mehrheitlich für den Südwestfunk Baden-Baden; im Falle der zweiten Sinfonie handelt es sich um eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln von 1959. Es ist zu begrüßen, dass diese hier ebenfalls beigesteuert wurde. Der Beethoven-Ansatz ist freilich in Baden-Baden wie in Köln derselbe und trägt eindeutig die Handschrift Rosbauds: nüchtern, nicht übermäßig gefühlsbetont und eng an der Partitur. Von daher ist dieser Beethoven viel eher der Lesart Hermann Scherchens und René Leibowitz‘ zuzuordnen denn jener Wilhelm Furtwänglers und Hans Knappertsbuschs, um nur einige wenige bedeutende Beethoven-Dirigenten der 1950er und 60er Jahre zu benennen. Jahrzehnte lange musste man auf diese offiziellen Editionen des SWR warten. In Sammlerkreisen kursierten diverse Aufnahmen natürlich schon lange als private Mitschnitte. Besser haben sie aber bis jetzt nicht geklungen (Remastering der originalen Tonbänder), auch wenn die natürlichen Limitierungen des Mono-Klanges nicht zu leugnen sind und es einmal wieder schade ist, dass die deutschen Rundfunkanstalten erst in der zweiten Hälfte der 1960er allmählich auf die Stereophonie umstiegen – zu spät für Rosbaud. Hörenswert ist das Dargebotene auch heute noch, so man geneigt ist, sich darauf einzulassen. Sowohl das Südwestfunk-Orchester (dem Rosbaud zwischen 1948 und 1962 als Chefdirigent vorstand) als auch das Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester (so die damalig gebräuchlichen Bezeichnungen) offerieren die bereits seinerzeit gebotene hohe Spielkultur, selbst wenn die jeweiligen Klangkörper bis zum heutigen Tage nochmal an Qualität zugelegt haben. Rosbauds Beethoven widerlegt eindrucksvoll, dass er viel mehr war als bloßer Experte für moderne Musik, als welcher er lange Zeit abgestempelt wurde. Allerdings ist die hörbare Strenge seines Dirigats womöglich in der Tat nicht zuletzt durch seine Erfahrung mit der Musik des 20. Jahrhunderts zurückzuführen. Willkürliche Temporückungen im Stile der Spätromantik wird man hier kaum finden. Vor zeitweiliger Schroffheit schreckt Rosbaud nicht zurück, so etwa im angriffslustig vorgetragenen Kopfsatz der 1961 eingespielten Fünften. Dabei erzielt der Dirigent das dem Werk innewohnende revolutionäre Momentum nicht durch heilloses Gehetze, sondern durch akribische Herausarbeitung der Strukturen mit besonders hervorgehobenen Instrumenten (insbesondere die Holz- und Blechbläser brillieren). Stellenweise hört man Beethoven hier wirklich neu. Hochkarätig sind auch die Instrumentalsolisten, die zum Einsatz kamen. Zuvörderst und auch chronologisch als erstes ist hier die in Paris geborene französische Violinistin Ginette Neveu anzuführen, deren Weltkarriere, gerade erst dreißigjährig, infolge eines Flugzeugabsturzes am 28. Oktober 1949 aufhörte, bevor sie wirklich begann. Die vorliegende Rundfunkaufnahme des Violinkonzerts entstand beinahe exakt einen Monat vor dieser Tragödie, am 25. September 1949 im Kurhaus Baden-Baden. Beinahe alle übrigen Aufnahmen wurden übrigens im bewährten Studio V, dem späteren Hans-Rosbaud-Studio, in Baden-Baden eingespielt. Der Aufnahmeort der einzigen Kölner Produktion lässt sich nicht mehr ermitteln. Das Klavierkonzert Nr. 5 mit dem legendären Géza Anda datiert auf 1956, das Tripelkonzert mit dem Trio di Trieste schließlich auf 1953. Bei der im September 1962 eingespielten Produktion der siebenten Sinfonie handelt es sich um eine der letzten Aufnahmen Rosbauds, der am 29. Dezember desselben Jahres 67-jährig in Lugano einer schweren Erkrankung erlag. Daniel Hauser (Weitere Information zu den CDs/DVDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de.)
 Gut Ding will Weile haben. Lange Zeit nur schwer greifbar, liegen mittlerweile mindestens fünf CD-Ausgaben des Zyklus der neun Beethoven-Sinfonien unter André Cluytens – der ersten Gesamtaufnahme der Berliner Philharmoniker – vor. Die EMI-Einspielungen, entstanden zwischen 1957 und 1960, sämtlich bereits in Stereo, waren ursprünglich für den französischen Markt konzipiert und erschienen erstmals 1995, wiederum bei EMI France, auf CD. Es folgten Neuauflagen in den Jahren 2006 und 2013 (zuletzt unter dem Label Erato); zudem waren sie 2017 in der insgesamt 65 CDs umfassenden Mammutbox André Cluytens – The Complete Orchestral & Concerto Recordings inkludiert. Nun legt sie Erato – oder man sollte besser sagen Warner – unter dem Titel Beethoven: 9 Symphonies · Overtures abermals auf, zum ersten Male nicht in erster Linie für Frankreich bestimmt, sondern für den internationalen Markt (Erato 0190295381066). Begründet wird dies mit einem neuen Remastering in 24-bit/96kHz von den Originalbändern durch Studio Art & Son, Annecy, von 2017. Die ältere Erato-Ausgabe ist derzeit offenbar parallel nach wie vor erhältlich, allerdings sogar teurer als die Neuausgabe; die alte Produktion dürfte nach menschlichem Ermessen freilich im Auslaufen begriffen sein.
Gut Ding will Weile haben. Lange Zeit nur schwer greifbar, liegen mittlerweile mindestens fünf CD-Ausgaben des Zyklus der neun Beethoven-Sinfonien unter André Cluytens – der ersten Gesamtaufnahme der Berliner Philharmoniker – vor. Die EMI-Einspielungen, entstanden zwischen 1957 und 1960, sämtlich bereits in Stereo, waren ursprünglich für den französischen Markt konzipiert und erschienen erstmals 1995, wiederum bei EMI France, auf CD. Es folgten Neuauflagen in den Jahren 2006 und 2013 (zuletzt unter dem Label Erato); zudem waren sie 2017 in der insgesamt 65 CDs umfassenden Mammutbox André Cluytens – The Complete Orchestral & Concerto Recordings inkludiert. Nun legt sie Erato – oder man sollte besser sagen Warner – unter dem Titel Beethoven: 9 Symphonies · Overtures abermals auf, zum ersten Male nicht in erster Linie für Frankreich bestimmt, sondern für den internationalen Markt (Erato 0190295381066). Begründet wird dies mit einem neuen Remastering in 24-bit/96kHz von den Originalbändern durch Studio Art & Son, Annecy, von 2017. Die ältere Erato-Ausgabe ist derzeit offenbar parallel nach wie vor erhältlich, allerdings sogar teurer als die Neuausgabe; die alte Produktion dürfte nach menschlichem Ermessen freilich im Auslaufen begriffen sein.
Zur Bedeutung dieses Zyklus muss aus künstlerischer Sicht an und für sich nicht mehr allzu viel gesagt werden. Nicht nur, weil es sich um die erste Gesamtaufnahme durch das Berliner Philharmonische Orchester handelt, ist sie bedeutsam. Wie sehr seinerzeit noch länderspezifisch für den jeweiligen Markt produziert wurde, ergibt sich bereits aus der aus heutiger Sicht kuriosen Tatsache, dass praktisch gleich nach Vollendung des Cluytens-Zyklus jener, heutzutage viel bekanntere erste Stereo-Zyklus der Berliner Philharmoniker unter Herbert von Karajan in den Jahren 1961 und 1962 eingespielt wurde (wenn auch für die Deutsche Grammophon-Gesellschaft). Auch dieser Umstand dürfte dazu beigetragen haben, dass Cluytens‘ Interpretationen zumindest im deutschsprachigen Raum relativ bald durch andere verdrängt wurden und aus dem Fokus gerieten. In Frankreich und Belgien, dem Geburtsland dieses Dirigenten, der seinen Namen übrigens gerne flämisch „Kleutens“ ausgesprochen wissen wollte, mag das anders gewesen sein. Künstlerisch unterscheiden sich die Ansätze von Cluytens und Karajan jedenfalls deutlich voneinander, repräsentiert letzterer eine modernere Interpretation, die in ihrer gleißenden Schärfe zumindest seinerzeit für Aufsehen sorgte und das Beethoven-Bild entscheidend reformierte. Cluytens hingegen verfolgt einen traditionelleren Stil, der stellenweise eher an Furtwängler gemahnt, also in die Vergangenheit verweist. Überhaupt war André Cluytens ein hervorragender Interpret deutscher Komponisten und jahrelang bei den Bayreuther Festspielen eine Größe, an der man nicht vorbeikam. Seinen Meistersingern etwa sagt man nach, deutscher zu klingen als bei manchem deutschen Dirigenten. So könnte man bei seinem Beethoven auf den ersten Blick eher eine Nähe zum etwa gleichzeitig, ebenfalls von EMI eingespielten Zyklus von Otto Klemperer erkennen, wobei Klemperer bei aller Monumentalität doch nüchtern-sachlich vorgeht, während Cluytens spätromantische Anflüge nicht scheut. So verzichtet er nicht auf eine aus heutiger Sicht etwas altertümliche Agogik, setzt gekonnt hie und da auf Tempowechsel und große Dynamikschwankungen. Es fällt nicht leicht, eine der Sinfonien besonders herauszustellen, doch bekommt diese Herangehensweise gerade der Eroica und der Fünften zugute, die hier sehr wuchtig und ohne Verzicht auf Pathos daherkommen. In der Neunten schließlich wird mit Gré Brouwenstijn, Kerstin Meyer, Nicolai Gedda und Frederick Guthrie ein zwar etwas heterogenes, aber letztlich vorzügliches Vokalistenensemble aufgeboten, unterstützt durch den Chor der St.-Hedwigs-Kathedrale Berlin, der trotz seiner Größe durchaus klar und präzise agiert. Von besonderer Güte auch die fünf Ouvertüren, die gleichsam als Bonus beigegeben wurden: Hochdramatisch besonders jene zu Coriolan und Egmont. Interessant, dass sich Cluytens für die bis heute zu Unrecht stark im Schatten stehende Ouvertüre zum Schauspiel Die Ruinen von Athen einsetzte, die hier eine formidable Wiedergabe erfährt. Komplettiert wird dies durch die Ouvertüren zu Fidelio und Die Geschöpfe des Prometheus.
Es kann nicht ausbleiben, noch ein Wort zum Klangbild zu äußern. Tatsächlich ist dieses trotz des hohen Alters und gewisser Vorbehalte gegen die EMI-Tontechniker jener Tage erstaunlich überzeugend. Die stetigen Verbesserungen der damals noch in den Kinderschuhen steckenden Stereophonie können hier nachvollzogen werden. Einzig die ältesten Produktionen, die Sinfonien Nr. 8 und 9 sowie die Prometheus-Ouvertüre, die bereits 1957 entstanden sind, fallen etwas ab. Bereits bei den Einspielungen vom Folgejahr, der dritten und der fünften Sinfonie, tritt diese leichte Einschränkung nicht mehr auf. Beschlossen wurden die Aufnahmen im November 1960 mit der Fidelio-Ouvertüre und jener zu den Ruinen in Athen. Als Aufnahmeort diente die ob ihrer guten Akustik gerühmten Grunewaldkirche in Berlin. Man hat gar den Eindruck, dass es das Gros der Cluytens-Aufnahmen mit den etwas später entstandenen unter Karajan locker aufnehmen kann, sie womöglich klanglich sogar etwas überflügelt. Dies ist ohne Frage eine weitere Stärke dieser Gesamtaufnahme. Beim genauen Hörvergleich mit der älteren CD-Auflage für EMI France von 2006 fragt sich allerdings, worin das neue Remastering das bereits ausgezeichnete ältere übertrifft. Trotz gewissenhaften Vorgehens konnte nur ein praktisch identisches Klangbild festgestellt werden. Insofern muss sich niemand, der den Cluytens’schen Beethoven bereits besitzt, zwingend auch noch diese Neuauflage ins Regal stellen. Für alle anderen ist es freilich eine willkommene Gelegenheit, dies nun preiswert nachzuholen (Weitere Information zu den CDs/DVDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei https://www.warnerclassics.com/). Daniel Hauser

Michael Gielen/ Wikipedia
Und noch ein addendum: Michael Gielen, der 2019 verstorbene große Doyen der neuen Sachlichkeit unter den Dirigenten, hatte in Sachen Beethoven etwas mitzuteilen. Sein bei Hänssler erschienener SWR-Zyklus der neun Sinfonien machte zum Zeitpunkt seines Erscheinens einige Furore. Nun legt Orfeo eine 1985 entstandene Aufnahme der Missa solemnis, produziert vom Österreichischen Rundfunk, erstmals auf CD vor (Orfeo C999201). Die Problematik, welche das Beethovens Schüler Erzherzog Rudolph anlässlich seiner Ernennung zum Bischof von Olmütz gewidmete Werk dem heutigen Publikum bereitet, liegt neben des ihm innewohnenden Bombastes nicht zuletzt in den hohen Anforderungen begründet. Dem wollte Gielen bewusst gegensteuern. Seine Tempi sind eher flott, tendenziell näher an der HIP-Einspielung von Gardiner (Archiv) als bei den Aufnahmen von Klemperer (EMI) oder Karajan (DG). Die einzelnen Sätze sind bei Orfeo übrigens nicht weiter unterteilt, wie in den meisten Einspielungen der Fall; man hat also vier, teils sehr lange Tracks vorliegen. Sehr hochkarätig auch das Solistenquartett, bestehend aus der Sopranistin Alison Hargan, der Mezzosopranistin Marjana Lipovsek, dem Tenor Thomas Moser sowie dem Bariton Matthias Hölle. Mitte der 80er Jahre nahe am Optimum. Welch gewichtiger Dirigent Gielen war, wird man auch daran ermessen können, dass er den Wiener Singverein, der bei dieser und jener Aufnahme als Manko in Kauf genommen werden muss – so auch unter Karajan –, hier auf demselben hohen Niveau erklingen lässt. Kongenial die Leistung des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien. An der Orgel begleitet Rudolf Scholz .(Weitere Information zu den CDs/DVDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de.) Daniel Hauser
 Mit Liedern von Ludwig van Beethoven lässt sich Ian Bostridge zum 250. Geburtstag des Komponisten vernehmen. Die CD ist im Oktober 2019 in London aufgenommen worden, damit sie rechtzeitig zum Jubiläum herauskommen konnte. Erschienen ist sie bei Warner (0190295276430). Bostridge hat aber auch schon früher Beethoven in Konzerten gesungen, so 2017 den Zyklus An die ferne Geliebte in der Hamburger Laeiszhalle, der im Zentrum der CD steht. Er versucht es erst gar nicht mit Schöngesang wie einst Nicolai Gedda, Hermann Prey oder Dietrich Fischer-Dieskau. Bostridge bohrt tief in den inhaltlichen Schichten, setzt teils grelle dramatische Akzente. Manchmal kommt es einem so vor, als liege der Vortragende als Ich-Erzähler auf der Couch eines Psychoanalytikers. Dabei gerät die musikalische Linie etwas unter die Räder. Bostridge hält sich gern bei Details auf und malt sie voller Zerknirschung und Schwermut aus. Seine Interpretation, an der man mit der Zeit durchaus Gefallen finden kann, wirkt sehr bildhaft. Sie könnte die Tonspur für einen Film sein. Im gleichen Interpretationsstil schließt sich das Lied „Adelaide“ fast nahtlos wie ein Bestandteil des Zyklus an.
Mit Liedern von Ludwig van Beethoven lässt sich Ian Bostridge zum 250. Geburtstag des Komponisten vernehmen. Die CD ist im Oktober 2019 in London aufgenommen worden, damit sie rechtzeitig zum Jubiläum herauskommen konnte. Erschienen ist sie bei Warner (0190295276430). Bostridge hat aber auch schon früher Beethoven in Konzerten gesungen, so 2017 den Zyklus An die ferne Geliebte in der Hamburger Laeiszhalle, der im Zentrum der CD steht. Er versucht es erst gar nicht mit Schöngesang wie einst Nicolai Gedda, Hermann Prey oder Dietrich Fischer-Dieskau. Bostridge bohrt tief in den inhaltlichen Schichten, setzt teils grelle dramatische Akzente. Manchmal kommt es einem so vor, als liege der Vortragende als Ich-Erzähler auf der Couch eines Psychoanalytikers. Dabei gerät die musikalische Linie etwas unter die Räder. Bostridge hält sich gern bei Details auf und malt sie voller Zerknirschung und Schwermut aus. Seine Interpretation, an der man mit der Zeit durchaus Gefallen finden kann, wirkt sehr bildhaft. Sie könnte die Tonspur für einen Film sein. Im gleichen Interpretationsstil schließt sich das Lied „Adelaide“ fast nahtlos wie ein Bestandteil des Zyklus an.
Editorisch sehr verdienstvoll ist die Aufnahme aller vier Fassungen des Liedes „Sehnsucht“ nach einem Gedicht Goethes aus dem Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre. Beethoven hatte die unterschiedlichen Versionen auf dem Autograph damit begründet, dass es ihm an Zeit mangele, ein einziges gutes Lied hervorzubringen. Boistridge aber macht die Erklärung des Komponisten vergessen und formt aus jeder Version ein eigenes Meisterwerk. Ins Programm der CD aufgenommen wurden auch das „Flohlied“ aus Faust, „Ich liebe dich“, „Un questa tomba oscura“, „Maigesang“, „Andenken“ und „Resignation“. Auch sprachlich ganz in seinem Element ist Bostridge, dessen Deutsch nach wie vor problematisch ist und zu wünschen übrig lässt, in einer Auswahl aus der reichen Sammlung von Volksliedern, die teils auf Textvorlagen von Walter Scott beruhen. Zum Abschluss noch einmal eine Goethe-Vertonung: „Marmotte“ aus seinem Schwank Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern.
Als Begleiter kehrt Antonio Pappano, der jetzt hauptsächlich als Dirigent tätig ist, an die Ursprünge seines musikalischen Wirkens zurück. im Alter von einundzwanzig Jahren war er nach grünlicher Ausbildung als Probenpianist an der New York City Opera engagiert worden. Bei den Volksliedern kommen zusätzlich Vilde Frang (Violine) und Nicolas Altstaedt (Cello) zum Einsatz (Foto Simon Fowler/ Warner). Rüdiger Winter
 Mit einer neuen Gesamtausgabe auf 118 CDs und mehreren DVDs feiert die Deutsche Grammophon das Beethoven-Jahr. Die fünf Klavierkonzerte interpretiert der kanadische Pianist Jan Lisiecki. Er ist es auch, der Matthias Goerne (Foto oben/ DG/ Marie Staggat)auf seiner aktuellen CD mit Liedern des Komponisten begleitet (00289 483 8351). Der deutsche Bariton kehrt damit – nach mehreren Jahren der Bindung an harmonia mundi – zum Universal-Konzern zurück, bei dem er die ersten Jahre seiner Karriere unter Vertrag stand. 2005 veröffentlichte die Decca einen Liederabend Goernes mit Alfred Brendel aus der Londoner Wigmore Hall von 2003, in welchem neben Schuberts Schwanengesang Beethovens An die ferne Geliebte auf dem Programm stand. Bislang war dies das einzige offiziell existierende Beethoven-Dokument mit dem Sänger auf CD. Der Zyklus findet sich nun auch auf der neuen Platte, die im Juli 2019 im Berliner Teldex Studio aufgenommen wurde. Der Vergleich nach 16 Jahren ist aufschlussreich. In der ersten Studio-Aufnahme klingt die Stimme jugendlicher und leichter, doch in der Gestaltung noch nicht so prägnant wie heute.
Mit einer neuen Gesamtausgabe auf 118 CDs und mehreren DVDs feiert die Deutsche Grammophon das Beethoven-Jahr. Die fünf Klavierkonzerte interpretiert der kanadische Pianist Jan Lisiecki. Er ist es auch, der Matthias Goerne (Foto oben/ DG/ Marie Staggat)auf seiner aktuellen CD mit Liedern des Komponisten begleitet (00289 483 8351). Der deutsche Bariton kehrt damit – nach mehreren Jahren der Bindung an harmonia mundi – zum Universal-Konzern zurück, bei dem er die ersten Jahre seiner Karriere unter Vertrag stand. 2005 veröffentlichte die Decca einen Liederabend Goernes mit Alfred Brendel aus der Londoner Wigmore Hall von 2003, in welchem neben Schuberts Schwanengesang Beethovens An die ferne Geliebte auf dem Programm stand. Bislang war dies das einzige offiziell existierende Beethoven-Dokument mit dem Sänger auf CD. Der Zyklus findet sich nun auch auf der neuen Platte, die im Juli 2019 im Berliner Teldex Studio aufgenommen wurde. Der Vergleich nach 16 Jahren ist aufschlussreich. In der ersten Studio-Aufnahme klingt die Stimme jugendlicher und leichter, doch in der Gestaltung noch nicht so prägnant wie heute.
Eröffnet wird das Programm der CD mit den 6 Liedern op. 48 auf Gedichte von Christian Fürchtegott Gellert, die Goerne 2003 bei den Schwetzinger Festspielen interpretierte, wovon unter Sammlern ein privater Mitschnitt kursiert. Also auch hier derselbe zeitliche Abstand wie bei der Fernen Geliebten und vergleichbare Erkenntnisse. Das erste Lied („Bitten“) erklingt in ganz schlichtem, verinnerlichtem Ton und suggeriert einen tief gläubigen Menschen. Voll energischer Strenge dagegen das folgende „Die Liebe des Nächsten“, das Barmherzigkeit und Nächstenliebe preist. „Vom Tode“ handelt mit ernsten Tönen vom unausweichlichen Ende des Menschen und stellt den Klangreichtum der sonoren Stimme besonders heraus. Autoritären Nachdruck besitzen „Die Ehre Gottes“ und „Gotttes Macht und Vorsehung“. Den Zyklus beschließt das nachsinnende und sich zur Zuversicht wandelnde „Bußlied“.
Erstmals von Goerne zu hören sind elf Lieder, die zwischen den beiden Zyklen positioniert sind, von denen „Adelaide“ das bekannteste ist. Deren Beginn intoniert der Pianist wunderbar kantabel, der Sänger nimmt diese Vorgabe auf und formt zärtlich-weiche Töne von feinster Lyrik, die erst am Schluss einem drängenden Duktus weichen. Auch die einleitende „Resignation“ oder der später folgende „Maigesang“ sind gelegentlich zu hören, kaum dagegen „Der Liebende“ (nach Christian Ludwig Reissig) und „Klage“ (Ludwig Hölty). Hier hört man eine vielfältige Palette von Farben und Stimmungen: verhalten und zögerlich die „Resignation“, munter und hoffnungsvoll „Gesang aus der Ferne“, schlicht und volksliedhaft der „Maigesang“, erwartungsvoll bebend „Der Liebende“, resignierend wehmütig die „Klage“, lebhaft auftrumpfend „An die Hoffnung“, wehmütig die „Wonne der Wehmut“, sanft und tröstlich „Das Liedchen von der Ruhe“ . Den Abschluss dieser Gruppe bildet „An die Geliebte“ (Joseph Ludwig Stoll) – quasi als Einstimmung auf den danach folgenden berühmten Zyklus als Ende der Programmfolge.
Schon dessen Beginn, „Auf dem Hügel sitz ich“, bestimmt die Atmosphäre dieser Strophenlieder zwischen Sehnsucht, Verlangen und Resignation. Dies setzt sich fort im träumerischen „Wo die Berge so blau“ bis zum „Nimm sie hin denn, diese Lieder“, wo das Klavier das Thema des ersten Liedes wieder aufnimmt.
Der Sänger ist bekannt dafür, mit renommierten Pianisten zusammenzuarbeiten, um sich gegenseitig zu befruchten und mit wechselseitigen Impulsen zu bereichern. Das beweist seine Schubert-Edition bei hm, wo ihm eine Elite von Liedbegleitern zur Seite steht. Stets ist es dem Sänger auch ein Anliegen, mit Künstlern der jungen Generation aufzutreten und aufzunehmen. Jan Lisiecki ist dafür (neben Daniil Trifonov) ein treffliches Beispiel. Den höchst anspruchsvollen Klavierpart absolviert der Kanadier meisterhaft, ist darüber hinaus dem Sänger ein einfühlsamer und inspirierender Partner. Bernd Hoppe
 Optisch deutlich unter Wert verkauft hat Naxos zwei bemerkenswerte neue Einspielungen von Werken Ludwig van Beethovens: König Stephan (8.574042) und Die Ruinen von Athen (8.574076). Das Label ist seinem Prinzip treu geblieben, auch exklusive Titel ohne viel Schnickschnack unter die Leute zu bringen. Neuerscheinungen bei Naxos wollen und müssen entdeckt werden. So war es immer. Großer Verbreitung auf Tonträgern und im Konzertsaal erfreuen sich die Ouvertüren zu diesen Schauspielen. Auch die einzelnen musikalischen Nummern – Chöre, Zwischenmusiken, Märsche, Arien, Duette – sind nicht nur einmal vollständig aufgenommen worden. König Stephan hielt mit dem Dirigenten Myung-Whun Chung als deutsch-italienische Koproduktion Einzug in eine Beethoven-Edition der Deutschen Grammophon. Bernhard Klee (Polydor), Karl Anton Rickenbacher (Koch Classics), Wilfried Böttcher (Bella Musica) und Hans Hubert Schoenzeler (Brilliant) nahmen sich der Ruinen von Athen an. Eine Einspielung und gemeinsame Veröffentlichung beider Stücke durch das ungarischen Label Hungaroton mit Margit Laszlo und Sandor Solyom Nagy als Gesangssolisten unter Geza Oberfrank führte nach Budapest und damit an den Ort des historischen Anlasses für die Entstehung beider Festspiele. Naxos legt erstmals die kompletten Werke vor, zur Musik auch den gesprochenen Text. Deshalb wäre es wünschenswert gewesen, dies gleich auf den CD-Covern herausgestellt zu sehen. So entsteht zunächst der flüchtige Eindruck, als sei wiederum nur die Musik bedacht worden. Einzig bei den Ruinen von Athen ist auf der Rückseite vermerkt, dass es sich um eine „World premiere recording of version with Narration“ handelt.
Optisch deutlich unter Wert verkauft hat Naxos zwei bemerkenswerte neue Einspielungen von Werken Ludwig van Beethovens: König Stephan (8.574042) und Die Ruinen von Athen (8.574076). Das Label ist seinem Prinzip treu geblieben, auch exklusive Titel ohne viel Schnickschnack unter die Leute zu bringen. Neuerscheinungen bei Naxos wollen und müssen entdeckt werden. So war es immer. Großer Verbreitung auf Tonträgern und im Konzertsaal erfreuen sich die Ouvertüren zu diesen Schauspielen. Auch die einzelnen musikalischen Nummern – Chöre, Zwischenmusiken, Märsche, Arien, Duette – sind nicht nur einmal vollständig aufgenommen worden. König Stephan hielt mit dem Dirigenten Myung-Whun Chung als deutsch-italienische Koproduktion Einzug in eine Beethoven-Edition der Deutschen Grammophon. Bernhard Klee (Polydor), Karl Anton Rickenbacher (Koch Classics), Wilfried Böttcher (Bella Musica) und Hans Hubert Schoenzeler (Brilliant) nahmen sich der Ruinen von Athen an. Eine Einspielung und gemeinsame Veröffentlichung beider Stücke durch das ungarischen Label Hungaroton mit Margit Laszlo und Sandor Solyom Nagy als Gesangssolisten unter Geza Oberfrank führte nach Budapest und damit an den Ort des historischen Anlasses für die Entstehung beider Festspiele. Naxos legt erstmals die kompletten Werke vor, zur Musik auch den gesprochenen Text. Deshalb wäre es wünschenswert gewesen, dies gleich auf den CD-Covern herausgestellt zu sehen. So entsteht zunächst der flüchtige Eindruck, als sei wiederum nur die Musik bedacht worden. Einzig bei den Ruinen von Athen ist auf der Rückseite vermerkt, dass es sich um eine „World premiere recording of version with Narration“ handelt.

Das neue Theater in Pest während einer Überschwemmung der Stadt., 1889 bei einem Brand zerstört./ Wikipedia
Beethoven hatte die Bühnenmusiken für das neue Theater in Pest, das seinerzeit noch eine selbstständige Stadt war und erst 1873 mit den ebenfalls eigenständigen Buda zu Budapest zusammengelegt wurde, komponiert. Dazu brauchte er nur wenige Wochen. Die für Oktober 1811 in Aussicht genommene Eröffnung musste auf den 9. Februar 1812 verschoben werden. In dem Haus, das über dreitausend Plätze verfügt haben soll, wurde ausschließlich in deutscher Sprache gespielt – neben Schauspielen auch Opern und Operetten. Zwischenzeitlich nahm es bei einem Brand Schaden, wurde aber umgehend wieder aufgebaut. Mit der Revolution 1848/1849 kam der Betrieb zum Erliegen. 1889 brannte das Gebäude vollständig ab. Es existiert also nicht mehr.
Die Initiative zu dem Theaterneubau war 1804 ausgegangen von Franz II., (letztem) Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und Erzherzog von Österreich, der noch im selben Jahr als Franz I. das Kaisertum Österreich begründete. Damit sollte die Treue Ungarn zur österreichischen Monarchie symbolisiert werden. Dementsprechend musste auch die feierliche Einweihung mit König Stephan als „Vorspiel mit Chören“ und den Ruinen von Athen als „Nachspiel mit Chören und Gesängen“ vonstattengehen. Als Textdichter war der in hohem Ansehen stehende August von Kozebue gewonnen worden, für die Musik der auf dem Höhepunkt seines Schaffens stehende Beethoven. Dem Publikum der Uraufführung waren die Libretti gedruckt gereicht worden. Erhaltene Exemplare sind rar. Digitalisiert stehen sie bei der Library of Congress in Washington – der größten Bibliothek der Welt – kostenlos über das Netz zur Verfügung. Nicht in den Booklets, wohl aber auf der eigenen Internetseite bietet Naxos moderne Abschriften an.

Das originale Libretto der „Ruinen von Athen“ : Naxos bietet den Text als Abschrift auf seiner Internetseite an/ Wiki
Revolutionäre Theaterstücke, die dem Freiheitsgedanken huldigen wie Fidelio oder die 9. Sinfonie, sind nicht zu erwarten. Im Gegenteil. Dem Anlass gemäß werden Pathos und Heldenverehrung historisch verbrämt und mit antiker Garnierung gereicht. Auch das ist Beethoven. Er lebte von Aufträgen. In den Ruinen von Athen, die zuletzt herausgekommen sind, erwacht die Göttin Athene – hier als Minerva auftretend – nach tausenden von Jahren. Getrieben von der Sehnsucht, die ihr geweihte Stadt mit dem Parthenon wiederzusehen, findet sie sich in Ruinen wieder. Athen steht unter osmanischer Herrschaft, der legendäre Turm der Winde ist eine Moschee. Derwische huldigen ihrem großen Propheten und der Kaaba, was Minerva ihrerseits als „barbarisches Geschrei“ wahrnimmt. Ein türkischer Marsch, der zu den Zugnummern des Werkes gehört, verbreitet mehr eingängig-flotte Folklore als Schrecken. Nachdem die Göttin ein in Musik gesetztes Gespräch eines griechischen Mädchen und eines Griechen mit angehört hatte, bei dem diese Menschen aus dem Volke beklagen „ohne Verschulden Knechtschaft dulden“ zu müssen, entschließt sie sich zur Flucht. Sie begibt sich auf die Suche nach einer neuen Heimat, wo „Wissenschaft und Künste blühen“. Denn wo man die holden Musen feiere, da „steht gewiss auch mein Altar“. Von Merkur geleitet, gelangt sie nicht ganz zufällig nach Pest. Von einem Greis erfährt das mythologische Paar, bei einem Volk angelangt zu sein, dem „die alte Treue für seinen König nie erstarb“. Dieses Volk nun schickt sich an, das Theater, diesen neuen Tempel der Musen, in Besitz zu nehmen. Und Merkur ruft Minerva zu: „Vergiss dein Griechenland, es ist gewesen, das Alte schwand, das Neue begann.“ Die Musik- und Theatermusen Thalia und Melpomene werden enthusiastisch gefeiert. Und so schließt das Festspiel damit, dass sich Zeus, der Vater Minervas, dazu herablässt, ein Bildnis des Kaisers Franz auf dem Altar der Kunst zwischen die beiden Musen zu stellen. Mit dem Chor „Heil unserm König! Heil! Vernimm uns Gott. Dankend schwören wir aufs Neue alte ungarische Treue bis in den Tod!“ endet das Spiel.
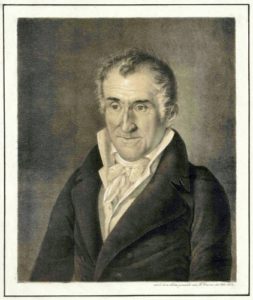
Der Textdichter beider Werke: August von Kotzebue (1761-1819) Wikipedia
Ohne die Einbettung in das Gesamtwerk bleiben die musikalischen Nummern unverständlich. Andererseits ist es schwer vorstellbar, eine Schöpfung wie die Ruinen von Athen einem heutigen Publikum bei einer öffentlichen Aufführung zuzumuten. Das Wissen um die Mythologie und ihre Gestalten sowie sehr spezielle historische Ereignisse sind nicht mehr so verbreitet wie einst. Aspekte, die als islamfeindlich wahrgenommen werden könnten, ließen sich auch mit Mitteln des zeitgenössischen Theaters schwerlich relativieren. Umso verdienstvoller ist es, derartige Stücke komplett wenigstens als CD-Produktion zugänglich zu machen, zumal in einem Jubiläumsjahr, in dem solche Ausgrabungen mehr wiegen sollten als eine neue Einspielung aller Sinfonien. Zu danken ist die Ausgrabung dem finnischen Dirigenten Leif Sergerstam, dem Chorus Cathedralis Aboesis und dem Turku Philharmonic Orchestra. Es war eine glückliche Wahl, deutschsprachige Schauspieler zu verpflichten. Sie garantieren die Textverständlichkeit. Angela Eberlein spricht die Minerva, Claus Obalski den Merkur, Roland Astor unter anderen den Greis. Die drei Gesangspartien, das griechische Mädchen und der Grieche sowie der Hohepriester, der am Schluss in Erscheinung tritt, sind mit Reetta Haavisto und Juha Kotilainen besetzt. Gewiss kann die ambitionierte Neuerscheinung das Werk als Ganzen nicht retten. Es wird sein Nischendasein auch künftig führen und weiterhin vornehmlich als Gelegenheitsarbeit des Komponisten wahrgenommen werden.
Wer sich aber tiefer hineinhört, findet einen Einfallsreichtum, wie ihn nur ein Beethoven hervorbringen kann. Als ob sich die Musik über den abstrusen Inhalt erhebt. Dreimal gehört, und bestimmte Passagen gehen einem nicht mehr aus dem Kopf. So ist es vielleicht auch Richard Strauss ergangen, der eine tiefe Neigung zu antiken Stoffen hatte. Der benutze nämlich Beethovens Musik für seine neue Bearbeitung nach einem Schauspiel von Hugo von Hofmannsthal, das genauso in der Versenkung verschwunden ist wie das Original (Foto oben Winter). Rüdiger Winter
 Wirklich große Komponisten zeichnen sich unter anderem auch dadurch aus, dass sie selbst zu eher mediokren Vorlagen grandiose Musik beisteuern können. Im Falle Ludwig van Beethovens, des heurigen Jubilars, trifft dies für einige bühnenmusikalische Gelegenheitswerke zu, von denen allenfalls noch die Ouvertüren im Konzertsaal erklingen. König Stephan, Ungarns erster Wohltäter ist solch ein Fall. Zusammen mit Die Ruinen von Athen erklang das Werk erstmals im Jahre 1812 anlässlich der Einweihung des neuen Theaters in Pest, dem heutigen Budapest. Die Texte steuerte mit August von Kotzebue eigentlich eine literarisch durchaus bedeutende Persönlichkeit bei, die freilich insbesondere durch die Umstände ihres gewaltsamen Todes in die Geschichte eingehen sollte. Das Sujet allerdings war insbesondere bei König Stephan dann eben doch die aus heutiger Sicht eher plump anmutende Verherrlichung der Habsburgermonarchie, die sich selbstredend als nahtlosen Erben des ersten christlichen Königs von Ungarn begriff. Dessen Ehe mit Gisela von Bayern, der Schwester des späteren Kaisers Heinrich II. (des Heiligen), mutet ein wenig an wie ein Blick in die damalige Zukunft, sollten doch sowohl der Widmungsträger der Komposition, Kaiser Franz I. von Österreich, als auch (ungleich berühmter) dessen Enkel Franz Joseph bayerische Prinzessinnen zur Gemahlin erwählen (in Franzens Falle übrigens erst in Ehe Nummer vier). Trotz reichlich viel überhöhtem Pathos kann doch zumindest die herrliche Ouvertüre bestehen, die so überhaupt nicht nach einem mittelalterlichen ungarischen König klingt und unter Kennern als Geheimtipp unter den Beethoven’schen Vorspielen gilt. In den übrigen 22 Nummern viele Chöre, Melodramen und ein paar Märsche, alles durchaus anhörbar, wenn auch schwerlich das sonstige Niveau Beethovens erreichend. Insgesamt vier Sprechrollen (Claus Obalski, Roland Astor, Ernst Oder und Angela Eberlein) sieht der Komponist hier vor. Verantwortlich zeichnet auch diesmal die finnische Dirigentenlegende Leif Segerstam, der sich jetzt im Alter tatsächlich vermehrt der mitteleuropäischen Wiener Klassik zuzuwenden scheint. Zumindest hat er für Naxos in jüngster Zeit einiges von Beethoven eingespielt, darunter etliche Raritäten. Die größtenteils finnischen Kräfte wissen durchaus zu überzeugen, so besonders die beiden beteiligten Chöre, zum einen das Key Ensemble, einer der führenden Kammerchöre Finnlands, sowie der Chorus Cathedrals Aboensis. Es spielt, wie üblich, das Philharmonische Orchester Turku. Und auch die verhältnismäßig gut dokumentierte Ouvertüre zu König Stephan hat man schon bezwingender vernommen (Ferencsik, Szell und Klemperer). Alles in allem gleichwohl eine erfreuliche Neuproduktion, eine der wenigen Gesamtaufnahmen dieser Bühnenmusik überhaupt. Daniel Hauser
Wirklich große Komponisten zeichnen sich unter anderem auch dadurch aus, dass sie selbst zu eher mediokren Vorlagen grandiose Musik beisteuern können. Im Falle Ludwig van Beethovens, des heurigen Jubilars, trifft dies für einige bühnenmusikalische Gelegenheitswerke zu, von denen allenfalls noch die Ouvertüren im Konzertsaal erklingen. König Stephan, Ungarns erster Wohltäter ist solch ein Fall. Zusammen mit Die Ruinen von Athen erklang das Werk erstmals im Jahre 1812 anlässlich der Einweihung des neuen Theaters in Pest, dem heutigen Budapest. Die Texte steuerte mit August von Kotzebue eigentlich eine literarisch durchaus bedeutende Persönlichkeit bei, die freilich insbesondere durch die Umstände ihres gewaltsamen Todes in die Geschichte eingehen sollte. Das Sujet allerdings war insbesondere bei König Stephan dann eben doch die aus heutiger Sicht eher plump anmutende Verherrlichung der Habsburgermonarchie, die sich selbstredend als nahtlosen Erben des ersten christlichen Königs von Ungarn begriff. Dessen Ehe mit Gisela von Bayern, der Schwester des späteren Kaisers Heinrich II. (des Heiligen), mutet ein wenig an wie ein Blick in die damalige Zukunft, sollten doch sowohl der Widmungsträger der Komposition, Kaiser Franz I. von Österreich, als auch (ungleich berühmter) dessen Enkel Franz Joseph bayerische Prinzessinnen zur Gemahlin erwählen (in Franzens Falle übrigens erst in Ehe Nummer vier). Trotz reichlich viel überhöhtem Pathos kann doch zumindest die herrliche Ouvertüre bestehen, die so überhaupt nicht nach einem mittelalterlichen ungarischen König klingt und unter Kennern als Geheimtipp unter den Beethoven’schen Vorspielen gilt. In den übrigen 22 Nummern viele Chöre, Melodramen und ein paar Märsche, alles durchaus anhörbar, wenn auch schwerlich das sonstige Niveau Beethovens erreichend. Insgesamt vier Sprechrollen (Claus Obalski, Roland Astor, Ernst Oder und Angela Eberlein) sieht der Komponist hier vor. Verantwortlich zeichnet auch diesmal die finnische Dirigentenlegende Leif Segerstam, der sich jetzt im Alter tatsächlich vermehrt der mitteleuropäischen Wiener Klassik zuzuwenden scheint. Zumindest hat er für Naxos in jüngster Zeit einiges von Beethoven eingespielt, darunter etliche Raritäten. Die größtenteils finnischen Kräfte wissen durchaus zu überzeugen, so besonders die beiden beteiligten Chöre, zum einen das Key Ensemble, einer der führenden Kammerchöre Finnlands, sowie der Chorus Cathedrals Aboensis. Es spielt, wie üblich, das Philharmonische Orchester Turku. Und auch die verhältnismäßig gut dokumentierte Ouvertüre zu König Stephan hat man schon bezwingender vernommen (Ferencsik, Szell und Klemperer). Alles in allem gleichwohl eine erfreuliche Neuproduktion, eine der wenigen Gesamtaufnahmen dieser Bühnenmusik überhaupt. Daniel Hauser
Würdiges Geburtstagsgeschenk. In die Schar der Gratulanten zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens reiht sich auch Chen Reiss, Sopran aus Israel und Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, ein. „Immortal beloved“ nennt sich ihre CD mit Arien vor allem noch des Bonners, begleitet wird der Sopran von der auf Originalinstrumenten spielenden Academy of ancient music unter der Leitung von Richard Egarr.
 Vom ersten Ton an überrascht und erfreut die Unmittelbarkeit der Kommunikation mit dem Hörer ebenso wie die Frische der Stimme, ihre Jugendlichkeit und ihre Klarheit. Aus den ungefähr 600 Gesangsstücken, die Beethoven im Verlauf seines Lebens komponierte, hat Chen Reiss vor allem solche ausgewählt, die bereits in Bonn entstanden sind. Dazu gehört auch eines mit ziemlich schrecklichem Text auf die Krönung Erzherzogs Leopold zum Kaiser, eine wahre Bravourarie, der die Leichtigkeit der Acuti zu Gute kommt, die einer Blonde oder eines Ännchen würdig sind. Der Sopran hat aber darüber hinaus weit mehr Substanz und einen beachtlichen Kern, die zu den sauberen Koloraturen kommen, so dass die hohl tönenden Worte eines gewissen Severin Anton Averdonk zur vernachlässigbaren Nebensächlichkeit werden.
Vom ersten Ton an überrascht und erfreut die Unmittelbarkeit der Kommunikation mit dem Hörer ebenso wie die Frische der Stimme, ihre Jugendlichkeit und ihre Klarheit. Aus den ungefähr 600 Gesangsstücken, die Beethoven im Verlauf seines Lebens komponierte, hat Chen Reiss vor allem solche ausgewählt, die bereits in Bonn entstanden sind. Dazu gehört auch eines mit ziemlich schrecklichem Text auf die Krönung Erzherzogs Leopold zum Kaiser, eine wahre Bravourarie, der die Leichtigkeit der Acuti zu Gute kommt, die einer Blonde oder eines Ännchen würdig sind. Der Sopran hat aber darüber hinaus weit mehr Substanz und einen beachtlichen Kern, die zu den sauberen Koloraturen kommen, so dass die hohl tönenden Worte eines gewissen Severin Anton Averdonk zur vernachlässigbaren Nebensächlichkeit werden.
Befreit von den Verschlimmbesserungen Salieris hat die Sängerin, die sich auch Gedanken über des Komponisten kompliziertes Liebesleben gemacht hat, den zweiten und dritten Track, Scena ed Aria „No, non tubarti“, für die die Stimme einen schmerzlichen Klang annimmt. Trotz des lyrischen Zuschnitts zeigt sie eine enorme akustische Präsenz für „Ma tu tremi“. Über „Il primo amore“ hat sich das Booklet Gedanken gemacht, der Verfasser Andrew Stewart meint in ihm Erfahrungen Beethovens mit seiner ersten Liebe Jeanette d’Honrath verarbeitet zu sehen, zu hören ist eine Stimme mit unverwechselbarem Timbre und manchmal leichter, nie unangenehmer Schärfe. Recht dramatisch und besonders für die Orchesterbegleitung typisch beethovenisch wird es ab „non cognosce il vero amore“, ehe der Sopran zu einem gut tragendem Piano zurückkehrt, ein mehraktiges Drama aus dem Track macht mit einem „morte“ von dunkler Färbung und einem leuchtenden „piacer del ciel“.
„Soll ein Schuh nicht drücken“ lässt Ironiespritzer aufblitzen, ist von komischem Pathos und wird von einem sieghaften Spitzenton gekrönt. Das Auftrittslied der Marzelline zeigt weit mehr als eine Soubrette, stattdessen eine selbstbewusste junge Frau, deren Stimme in Vorahnung des Eheglück strahlen kann. Von frischem Übermut ist aus der Musik zu Goethes Egmont Klärchens „Die Trommel gerühret“, sehr beherzt und schwungvoll begleitet. Extrem ausgereizt werden die Kontraste in ihrem „Freudvoll und leidvoll“. Für eine andere jugendliche Heldin im Soldatenrock, für Eleonora Prohaska, ist die Romanze „Es blüht eine Blume“ bestimmt, die Chen Reiss, von sensiblen Harfenklängen begleitet, mit anmutiger Naivität erfüllt.
Die beiden letzten Tracks sind Scena ed aria „Ah! perfido“, sie zeigen noch einmal, wie substanzreich der Sopran bei aller lyrischen Gestimmtheit ist im Zusammenwirken von Reinheit und Klarheit mit schönem Ernst, so im „voglio morir per lui“, wie ebenmäßig der Fluss des Soprans ist, der schweben, aber auch eindrucksvoll wüten kann. Man kann annehmen, dass sich Beethoven über diese Interpretation seiner Werke gefreut hätte (Onyx 4218). Ingrid Wanja
Das Jahr ist noch jung, der Überdruss aber schon groß: das Beethoven-Jubiläum droht zu einem öden Schauspiel zu werden. Das hängt zum einen für die CD-Produktion damit zusammen, dass die Majors viele ihrer Produkte schon Ende 2019 auf den Markt geworfen haben, um den Konkurrenten zuvorzukommen; da alle auf denselben Gedanken gekommen sind, ist der an sich gesättigte Markt schon vier Wochen nach Beginn des Gedenkjahres übersättigt von Boxen, die keiner will. Zum anderen gaukelt man im Konzertwesen Events vor, die keine sind. Typisch dafür sind etwa die Reenactments, in denen in Cardiff und Wien jene berühmte Beethoven-Akademie von 1808 nachgespielt wurde. Keine schlechte Idee an sich, aber da Beethoven damals das vierte Klavierkonzert, die Fünfte und die Pastorale ins Programm aufnahm, wurden letztendlich auch nur tausendmal gehörte Stücke zu Gehör gebracht. Das ist praktisch für denkfaule Solisten, Dirigenten und Impresari, aber der Musikliebhaber gähnt sich dabei zu Tode.

Der junge Hugo Wolf/ Foto Hugo Wolf Akademie
Dass es anders geht, zeigen intelligente Interpreten, die wirklich Neues wagen. Das Siemens Orchester in Erlangen hat sogar auf Ungehörtes gesetzt. Im Jahre 1876 nahm sich der damals 16jährige Konservatoriumsschüler Hugo Wolf Beethovens Sonate op. 27 Nr. 2, die sogenannte Mondscheinsonate, vor und orchestrierte sie. Die Annalen verzeichnen gelegentlich Versuche dieser Art. So machte der heute vergessene Münchner Komponist Heinrich Ludwig Spengel (1775-1865) hörenswerte Symphonien aus den Quartetten op. 18. Die durch Felix Weingartner 1925 für Orchester gesetzte Hammer-Klaviersonate mag Beethoven-Groupies anekeln, sie ist jedoch weit mehr als nur der bizarre Auswuchs einer fehlgeleiteten Beethoven-Verehrung. Gespielt werden diese Werke, die eine angenehme Alternative zu lustlos abgespulten Beethoven-Originalen bieten könnten, leider nicht mehr.
Umso dankbarer war man, die Mondscheinsonate in Wolfs Bearbeitung als Uraufführung fast 150 Jahren nach ihrer Entstehung hören zu dürfen. Es ist insgesamt zwar kein Meisterwerk, doch lässt der erste Satz aufhorchen: Wolf überträgt die Melodie der rechten Hand den Hörnern (hier exzellent gespielt von Kay Herold und Gaby Lorenz), die äußerst effektvoll über einem dunklen Klangteppich schweben. Weniger gelungen hingegen ist in der Tat der schülerhaft gesetzte zweite Satz, in dem ein einfältig anmutender Dialog zwischen Streichern und Bläser die falsche Naivität des Allegretto ins 18. Jahrhundert schleudert . Den dritten Satz ließ Wolf hingegen links liegen. Im Konzert gab es die seltene Möglichkeit, eine zweite überraschende Bearbeitung der Mondscheinsonate kennenzulernen: der nach c-moll transponierte erste Satz diente dem Dresdner Gottlob Benedict Bierey (1772-1840) als Grundlage für ein „Kyrie“ mit Chor, darin einer Praxis folgend, die ihren Höhepunkt im späten 18 Jahrhundert erreicht hatte (ich denke hier etwa an die Messen nach Themen aus Mozarts „Don Giovanni“, „Zauberflöte“ und sogar „Così fan tutte“). Man staunte, wie gut diese eigenartige Verkirchlichung über den Ursprung des Satzes täuschen konnte.
Das Siemens Orchester spielte diese und die anderen Stücke des Abends (darunter die Violinromanze op. 50, die Konzertmeister Michael Sigler mit schlankem Ton zum Besten gab, und die durch einen kurzen, witzigen Text von Marec Béla Steffens angereicherten Ausschnitte aus dem Ballet „Die Geschöpfe des Prometheus“) mit Aufmerksamkeit und Disziplin. Dirigent Lukas Meuli begnügte sich nicht, die freiwilligen Überstunden seiner Truppe mit nachsichtigem Entgegenkommen zu belohnen, sondern spornte sie unablässig an und erzielte eine lebendige, der Musik angemessene Kontrastierung der Klangebenen. Das „Kyrie“ von Bierey und den „Elegischen Gesang“ op. 118 sang mit großer Innigkeit die vorzügliche Stadtkantorei Fürth unter der Gesamtleitung von Ingeborg Schilffahrt. Das sehr zahlreiche erschienene Publikum spendete zu Recht viel Applaus für eine überaus originellen und anregenden Beitrag zum Beethoven-Jahr (Konzert am 2. Februar 2020). Michele C. Ferrari
 Das Beethoven-Jahr hat kaum begonnen, und schon können sich neben dem Musik-Giganten in den Klassik-Charts gerade noch Jonas Kaufmann mit seinen Wiener Liedern und das Neujahrskonzert der Wiener behaupten. Auch Naxos hat vorgesorgt mit dem ersten Teil einer Einspielung aller Lieder des Bonner Komponisten im Sommer 2018. Das Besondere an der CD ist das mehrmalige Nacheinander dreier verschiedener, wenngleich nicht allzu verschiedener Fassungen von bekannten Liedern wie Mignons „Sehnsucht“, Klärchens, der Geliebten Egmonts „Freudvoll und leidvoll“ und „An die Geliebte“, allerdings nicht die „ferne“. Die meisten Texte stammen von Goethe und zwar aus seiner Sturm- und Drang-Zeit, ansonsten kommen mit Gellert der Pietismus und mit der Gattin Brentanos, Sophie Mereau, die Romantik zum Zuge. Neben deutschen Texten gibt es auch zwei italienische, darunter zwei Fassungen von „Dimmi, ben mio“ in doppelter Version.
Das Beethoven-Jahr hat kaum begonnen, und schon können sich neben dem Musik-Giganten in den Klassik-Charts gerade noch Jonas Kaufmann mit seinen Wiener Liedern und das Neujahrskonzert der Wiener behaupten. Auch Naxos hat vorgesorgt mit dem ersten Teil einer Einspielung aller Lieder des Bonner Komponisten im Sommer 2018. Das Besondere an der CD ist das mehrmalige Nacheinander dreier verschiedener, wenngleich nicht allzu verschiedener Fassungen von bekannten Liedern wie Mignons „Sehnsucht“, Klärchens, der Geliebten Egmonts „Freudvoll und leidvoll“ und „An die Geliebte“, allerdings nicht die „ferne“. Die meisten Texte stammen von Goethe und zwar aus seiner Sturm- und Drang-Zeit, ansonsten kommen mit Gellert der Pietismus und mit der Gattin Brentanos, Sophie Mereau, die Romantik zum Zuge. Neben deutschen Texten gibt es auch zwei italienische, darunter zwei Fassungen von „Dimmi, ben mio“ in doppelter Version.
Vier Sänger teilen sich die Aufgaben, darunter mit nur einem Beitrag, „In questa tomba oscura“ der Bass Ricardo Bojórquez mit reichlich verquollener, unausgeglichener Tongebung. Das Tenorfach ist mit Rainer Trost vertreten, der mit schöner Farbe einer jünglingshaft klingenden Stimme Höltys „Klage“ beredten Ausdruck verleiht. Wahrlich stürmend und drängend ertönt „Neue Liebe, neues Leben“, mit feinem Zögern im Mittelteil und mit dem hurtigen Klavier im Wettstreit. Der recht banale Text von „Gesang aus der Ferne“ (nicht von Goethe) wird nicht nur durch die Komposition, sondern zusätzlich durch den lebendigen, leidenschaftlichen Vortrag aufgewertet. Dass der Tenor auch eine ausdrucksvolle Tiefe hat, beweist er mit „Dimmi, ben mio“, die zweite Version wird dramatischer als die erste angelegt. Balsamisch klingt „Wonne der Wehmut“, baritonal gefärbt „Traute Henriette“.
Die zweite Säule der CD ist der Bariton Paul Armin Edelmann, der mit „Erlkönig“ beginnt, das Rollenspiel konsequent durchzieht und zu einem beeindruckenden Schluss findet. Die drei Fassungen von „An die Geliebte“ beeindruckenden besonders durch das fein variierende „mein, mein“. Wunderbar passt die virile Stimmfarbe zu Gellerts „Bußlied“, dazu erfreut die ernsthafte, durch und durch protestantische Haltung, die in der Interpretation zum Ausdruck kommt. Eine schöne Feierlichkeit vermag der Sänger mit „Opferlied“ zu vermitteln.
Irritiert ist man vom Sopran Elisabeth Breuers, die Mignons „Sehnsucht“ in dreifacher Fassung singt, nicht weil man sich einen Mezzosopran für die Figur wünscht, sondern weil ihr Sopran allzu soubrettenhaft zwitschernd, zu säuselnd und manieriert klingt. Auch für das beherzte Klärchen wünscht man sich eine weniger tändelnd klingende, weniger kindlich aufgefasste Verkörperung. Weit mehr gefallen kann da die Interpretation des volksliedhaften „Gretels Warnung“. Stets auf der Höhe der Situation zeigt sich die Pianistin Bernadette Bartos (Naxos 8.574071). Ingrid Wanja

Beethovens „Leonore“: Anna Milder-Hauptmann (1785–1838), die erste Leonore in allen drei fassungen/ Wiki
Allzu viele Einspielungen der kompletten Beethoven’schen Schauspielmusik zu Goethes Trauerspiel Egmont gibt es auf dem Markt nicht. Daher ist die Neueinspielung, welche Naxos (8.573956) nun unter der finnischen Dirigentenlegende Leif Segerstam vorlegt, erst einmal zu begrüßen. Als Klangkörper fungiert das an der Südspitze Finnlands situierte Philharmonische Orchester Turku, welches, 1790 gegründet, im Übrigen das älteste Orchester des Landes darstellt. Tatsächlich ist diese Aufnahme so etwas wie ein letztes Aufbäumen der großen Alten aus dem Norden. Zu meiner Überraschung ist niemand Geringerer als Matti Salminen mit von der Partie. Zwar gab dieser im Dezember 2016 bereits seinen Bühnenabschied bekannt, allerdings kehrte er anlässlich einer Reihe von Festaufführungen von Wagners Meistersingern unter Daniel Barenboim an der Staatsoper Unter den Linden im April 2019 dann doch wieder auf die Bühne zurück. So sollte es gar nicht so sehr verwundern, dass er sich anlässlich dieser im Jänner 2018 in Turku eingespielten Produktion zur Übernahme der Sprecherrolle aufraffen konnte. Vielleicht mag da auch die langjährige und dem Vernehmen nach sehr enge Freundschaft mit Segerstam eine gewisse Rolle gespielt haben. Wie dem auch sei: Jedenfalls konnte Naxos diese Aufnahme initiieren, ergänzt um die ebenfalls finnische Sopranistin Kaisa Ranta als Klärchen. So begrüßenswert dieses Vorhaben auch ist, kann es insgesamt nicht auf ganzer Linie als gelungen bezeichnet werden. Dies liegt leider gerade auch an Salminen, der hier zuweilen etwas unbeweglich daherkommt. An die wienerische Noblesse eines Karl Paryla unter Scherchen (Tahra) oder an die zugespitzte Dramatik eines Klausjürgen Wussow unter Szell (Decca) darf man nicht denken.
Kaisa Ranta absolviert ihre Aufgabe mit angenehmem Timbre sehr gediegen und mit tadelloser deutscher Diktion. An die großartigen Leistungen einer Gundula Janowitz unter Karajan (DG) oder einer Pilar Lorengar unter Szell (Decca) kommt sie freilich nicht heran. Die orchestrale Begleitung Segerstams gerät auch etwas pauschal. Daher sind es eher die Beigaben, die diese CD dann doch noch empfehlenswert machen: Die Einleitung zum zweiten Akt von Leonore (Fassung 1805), der Trauermarsch aus Leonore Prohaska und der Triumphmarsch aus Tarpeja. Von diskographischem Interesse auch die von Franz Beyer 1982 rekonstruierte Orchesterfassung der sechs Menuette WoO 10. Klangtechnisch gibt es nichts zu beanstanden. Daniel Hauser



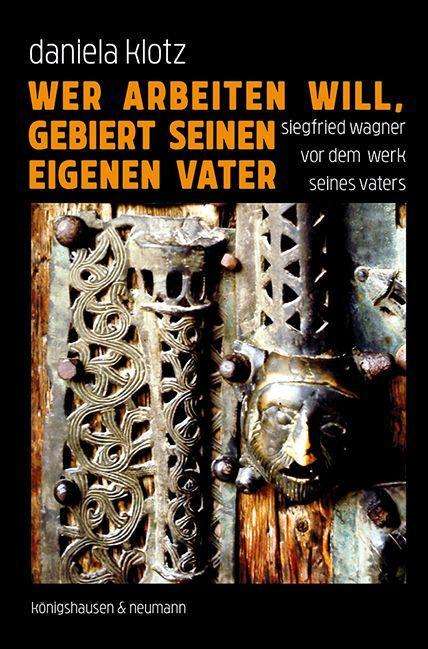









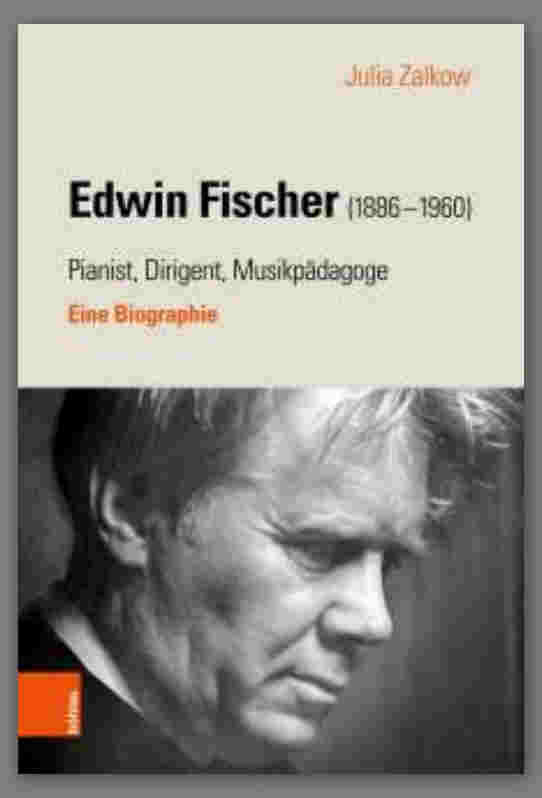


 Dass
Dass 

 Aus Malmö: Beethovens Sinfonien mit Robert Trevino und dem Malmö Symphony Orchestra bei Ondine.
Aus Malmö: Beethovens Sinfonien mit Robert Trevino und dem Malmö Symphony Orchestra bei Ondine. Und nun zu hmf:
Und nun zu hmf: Die eigentlich interessantere Neuerscheinung stellt die Compact Disc mit
Die eigentlich interessantere Neuerscheinung stellt die Compact Disc mit Ohne Frage: Das Geschäftsmodell, dass Sony hier abzieht, ist unverschämt. Andererseits ist diese Aufnahme auch unverschämt gut. Gewiss nicht die definitive Lesart, wie könnte sie es auch sein. Doch hat der Dirigent etwas mitzuteilen. Die Radikalität seines Ansatzes, frappierend exekutiert von seinem auf ihn eingespielten und bestens aufspielenden Orchester
Ohne Frage: Das Geschäftsmodell, dass Sony hier abzieht, ist unverschämt. Andererseits ist diese Aufnahme auch unverschämt gut. Gewiss nicht die definitive Lesart, wie könnte sie es auch sein. Doch hat der Dirigent etwas mitzuteilen. Die Radikalität seines Ansatzes, frappierend exekutiert von seinem auf ihn eingespielten und bestens aufspielenden Orchester  Und noch ein Beethoven-Zyklus im Beethoven-Jahr
Und noch ein Beethoven-Zyklus im Beethoven-Jahr Auf das berühmteste Ta-ta-ta-taaa der Musik-Geschichte, das die Sinfonik wie eine Wasser-Scheide in ein davor und danach trennen sollte, was man von der Zweiten und Dritten ebenso behaupten könnte, eilte Ludwig van Beethoven in raschen Schritten zu. Er war nach den Verhältnissen der Zeit bereits relativ alt, als er mit 30 Jahren seine erste und im April 1800 in Wien uraufgeführte Sinfonie vorlegte, die von ihrer kunstvollen Einleitung und der durchbrochenen Instrumentation bis zur langsamen Einleitung des vierten Satzes in vieler Hinsicht bemerkenswert ist. In kurzen Abständen schlossen sich die weiteren Sinfonien bis zur Fünften an.
Auf das berühmteste Ta-ta-ta-taaa der Musik-Geschichte, das die Sinfonik wie eine Wasser-Scheide in ein davor und danach trennen sollte, was man von der Zweiten und Dritten ebenso behaupten könnte, eilte Ludwig van Beethoven in raschen Schritten zu. Er war nach den Verhältnissen der Zeit bereits relativ alt, als er mit 30 Jahren seine erste und im April 1800 in Wien uraufgeführte Sinfonie vorlegte, die von ihrer kunstvollen Einleitung und der durchbrochenen Instrumentation bis zur langsamen Einleitung des vierten Satzes in vieler Hinsicht bemerkenswert ist. In kurzen Abständen schlossen sich die weiteren Sinfonien bis zur Fünften an.
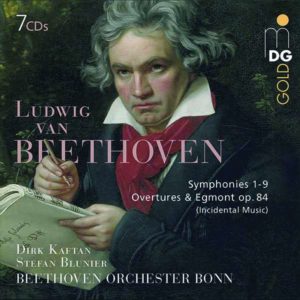 Dass auch
Dass auch  Ironie des Schicksals, dass es nun der
Ironie des Schicksals, dass es nun der  Nein, einen kompletten
Nein, einen kompletten  Gut Ding will Weile haben. Lange Zeit nur schwer greifbar, liegen mittlerweile mindestens
Gut Ding will Weile haben. Lange Zeit nur schwer greifbar, liegen mittlerweile mindestens
 Mit Liedern von Ludwig van Beethoven lässt sich
Mit Liedern von Ludwig van Beethoven lässt sich  Mit einer neuen Gesamtausgabe auf 118 CDs und mehreren DVDs feiert die
Mit einer neuen Gesamtausgabe auf 118 CDs und mehreren DVDs feiert die 


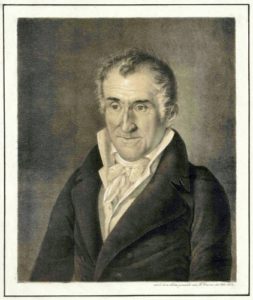

 Vom ersten Ton an überrascht und erfreut die Unmittelbarkeit der Kommunikation mit dem Hörer ebenso wie die Frische der Stimme, ihre Jugendlichkeit und ihre Klarheit. Aus den ungefähr 600 Gesangsstücken, die Beethoven im Verlauf seines Lebens komponierte, hat Chen Reiss vor allem solche ausgewählt, die bereits in Bonn entstanden sind. Dazu gehört auch eines mit ziemlich schrecklichem Text auf die Krönung Erzherzogs Leopold zum Kaiser, eine wahre Bravourarie, der die Leichtigkeit der Acuti zu Gute kommt, die einer Blonde oder eines Ännchen würdig sind. Der Sopran hat aber darüber hinaus weit mehr Substanz und einen beachtlichen Kern, die zu den sauberen Koloraturen kommen, so dass die hohl tönenden Worte eines gewissen Severin Anton Averdonk zur vernachlässigbaren Nebensächlichkeit werden.
Vom ersten Ton an überrascht und erfreut die Unmittelbarkeit der Kommunikation mit dem Hörer ebenso wie die Frische der Stimme, ihre Jugendlichkeit und ihre Klarheit. Aus den ungefähr 600 Gesangsstücken, die Beethoven im Verlauf seines Lebens komponierte, hat Chen Reiss vor allem solche ausgewählt, die bereits in Bonn entstanden sind. Dazu gehört auch eines mit ziemlich schrecklichem Text auf die Krönung Erzherzogs Leopold zum Kaiser, eine wahre Bravourarie, der die Leichtigkeit der Acuti zu Gute kommt, die einer Blonde oder eines Ännchen würdig sind. Der Sopran hat aber darüber hinaus weit mehr Substanz und einen beachtlichen Kern, die zu den sauberen Koloraturen kommen, so dass die hohl tönenden Worte eines gewissen Severin Anton Averdonk zur vernachlässigbaren Nebensächlichkeit werden.
 Das Beethoven-Jahr hat kaum begonnen, und schon können sich neben dem Musik-Giganten in den Klassik-Charts gerade noch Jonas Kaufmann mit seinen Wiener Liedern und das Neujahrskonzert der Wiener behaupten. Auch Naxos hat vorgesorgt mit dem ersten Teil einer Einspielung aller
Das Beethoven-Jahr hat kaum begonnen, und schon können sich neben dem Musik-Giganten in den Klassik-Charts gerade noch Jonas Kaufmann mit seinen Wiener Liedern und das Neujahrskonzert der Wiener behaupten. Auch Naxos hat vorgesorgt mit dem ersten Teil einer Einspielung aller 




 Botiaux und seine Aufnahmen sind heute weitgehend vergessen. Man rekuriert immer gleich auf Georges Thill und vergisst die Zwischenzeitsänger wie Liccioni. Und deswegen war die Sammlung bei
Botiaux und seine Aufnahmen sind heute weitgehend vergessen. Man rekuriert immer gleich auf Georges Thill und vergisst die Zwischenzeitsänger wie Liccioni. Und deswegen war die Sammlung bei 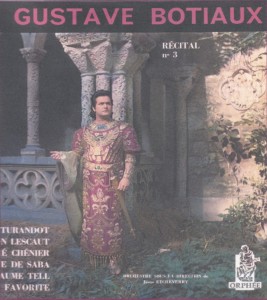 Für heutige Ohren eher bizarr ist eine Sammlung von
Für heutige Ohren eher bizarr ist eine Sammlung von 
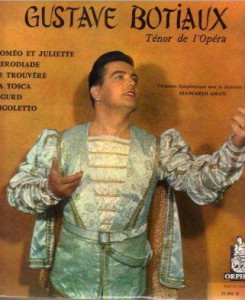 Au début des années 60, il a enregistré pour la marque Orphée (Pacific) : récital n°1, dir. Giancarlo Amati (Roméo et Juliette, Hérodiade, le Trouvère, la Tosca, Sigurd, Rigoletto) ; récital n°2, dir. Giancarlo Amati (la Favorite, l’Africaine, la Bohème, la Juive, Aïda) ; récital n°3, dir. Jésus Etcheverry (Turandot, Manon Lescaut, André Chénier, la Reine de Saba, Guillaume Tell, la Favorite) ; des versions anthologiques de Carmen(Don José), dir. Erasmo Ghiglia ; Faust (Faust), dir. Jésus Etcheverry ; Sigurd (Sigurd), dir. Jésus Etcheverry ; la Tosca (Mario) [version française de Paul Ferrier], dir. Giancarlo Amati ; le Pays du sourire (Sou-Chong) [version française d’André Mauprey et Jean Marietti], dir. Giancarlo Amati (1963) ; pour la marque Vogue : Chansons patriotiques, arrangements et direction d’orchestre : Michel Villard (1968).
Au début des années 60, il a enregistré pour la marque Orphée (Pacific) : récital n°1, dir. Giancarlo Amati (Roméo et Juliette, Hérodiade, le Trouvère, la Tosca, Sigurd, Rigoletto) ; récital n°2, dir. Giancarlo Amati (la Favorite, l’Africaine, la Bohème, la Juive, Aïda) ; récital n°3, dir. Jésus Etcheverry (Turandot, Manon Lescaut, André Chénier, la Reine de Saba, Guillaume Tell, la Favorite) ; des versions anthologiques de Carmen(Don José), dir. Erasmo Ghiglia ; Faust (Faust), dir. Jésus Etcheverry ; Sigurd (Sigurd), dir. Jésus Etcheverry ; la Tosca (Mario) [version française de Paul Ferrier], dir. Giancarlo Amati ; le Pays du sourire (Sou-Chong) [version française d’André Mauprey et Jean Marietti], dir. Giancarlo Amati (1963) ; pour la marque Vogue : Chansons patriotiques, arrangements et direction d’orchestre : Michel Villard (1968). 



 Fazit der Lebensbeschreibung dieses verträumten Jungen aus Linz hin zum kosmopolitischen Dirigenten: „Den schönsten Beruf, den des Dirigenten, ausüben zu dürfen, ein Leben lang mit der Musik zu verbringen, ist wahrlich mehr, als man jemals erhoffen durfte.“
Fazit der Lebensbeschreibung dieses verträumten Jungen aus Linz hin zum kosmopolitischen Dirigenten: „Den schönsten Beruf, den des Dirigenten, ausüben zu dürfen, ein Leben lang mit der Musik zu verbringen, ist wahrlich mehr, als man jemals erhoffen durfte.“