Luigi Cherubini. Vielzitiert, bewundert, unbekannt: 2010 fand anlässlich des 250. Geburtstags des Komponisten in Weimar ein Kongress über Luigi Cherubini statt, nun, sechs Jahre später erscheint als erster Band der Cherubini Studies ein Buch mit dem Untertitel Vielzitiert, bewundert, unbekannt, das Beiträge der auf der Tagung zu Wort gekommenen Musikologen in drei Sprachen, deutsch, englisch und italienisch, daneben auch viele Zitate in Französisch, enthält. Auch das erste Kapitel, von den Herausgebern Helen Geyer und von Michael Pauser stammend, trägt diesen etwas missverständlichen Titel, denn vielzitiert und bewundert dürfte der Komponist auch nur von einer kleineren Gruppe Musikinteressierter sein, einer wenn auch darauf beschränkten Popularität dürfte er sich nur innerhalb eines recht kleinen Kreises erfreuen. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war das ganz anders, erfreute sich doch zum Beispiel in Deutschland besonders seine Oper Der Wasserträger großer Beliebtheit.
Außer in Weimar, so berichtet das Eingangskapitel, fand zum Jubiläum auch in Florenz ein Kongress statt, der in Weimar befasste sich mit der Quellenlage, besonders was die Opern des Komponisten betrifft, einige Kapitel sind seiner Kirchenmusik, kaum etwas der Kammermusik gewidmet, dem Vergleich zwischen seinen italienischen und seinen französischen Opern, der Rezeptionsgeschichte und der Literatur oder den zeitgenössischen Kritiken über ihn. Ein reicher kritischer Apparat unterstreicht den wissenschaftlichen Anspruch der Arbeiten, ebenso Abbildungen, vergleichende Tabellen und Notenbeispiele.
Etwas verwirrend ist der schwer auffindbare Grund für die Überschrift Augenblicke der Freiheit, die Norbert Miller für die Darstellung von Cherubinis Aufenthalt in Wien, wo seine Oper Fanista, ein der bekannteren Lodoiska sehr ähnliches Werk, uraufgeführt wurde, wählt. Es geht zunächst vor allem um Beethovens Fidelio, generell um Rettungsopern, um die Begegnungen mit Haydn und Beethoven, das Vorbild Mozart. Eine dramaturgische und musikalische Interpretation der Fanista schließt sich an.
Berthold Over fragt sich in seinem Beitrag, was Cherubini von Mozart gelernt habe, sieht dies vor allem im Requiem, das Cherubini in Paris zur dortigen Erstaufführung brachte. Dem sehr leserfreundlich übersichtlich gestalteten Artikel kann man entnehmen, welchen Einfluss das Requiem Mozarts auf die beiden von Cherubini hatte, außerdem wird das von Nicolò Jommelli zum Vergleich herangezogen.
Svend Bach widmet sich der Oper Demophon als Werk des Übergangs von der italienischen zur französischen Oper, vermittelt dem Leser zeitgenössische Urteile über das Werk, das Gianluigi Gelmetti einspielte. Ausführlich werden die Quellen des Librettos (von Metastasio zu Marmontel) befragt, wird die versuchte Synthese zwischen italienischer und französischer Oper vom Autor positiver gesehen als von den Zeitgenossen Cherubinis und werden Überlegungen zu Aufführungsmöglichkeiten heutzutage angestellt.
Arnold Jacobshagen interessierte die Bedeutung des Chors in Cherubinis französischen Opern, und er gestattet interessante Einblicke in das damalige französische Opernleben, als es nur der Pariser Oper erlaubt war, einen Chor einzusetzen. Erst zu Lebzeiten Cherubinis wurde das Gesetz geändert, konnte auch die Opéra Comique diesen wichtigen Bestandteil auch französischer Opern unterhalten. Die Struktur der damaligen Ensembles erschließt sich durch einige Tabellen.
Christine Siegert schreibt über die Entstehung der Arie „O toi, victime de l’honneur“ aus Les deux journées (eben: Der Wasserträger) und kommt zu dem Schluss, dass ihr Fehlen im Werkverzeichnis darauf zurückzuführen ist, dass sie erst 42 Jahre nach der Uraufführung der Oper entstand.
Über die polnischen Elemente in den beiden Opern Lodoiska und Faniska schreibt Giada Viviani und führt ihr Vorhandensein u.a. darauf zurück, dass ein großes Interesse an Polen bestand, seitdem 1573 Henri de Valois zum König von Polen berufen worden war. Ein Vergleich der beiden Opern in Tabellenform macht den Artikel vollständig.
Markus Oppeneiger steuert Anmerkungen zur Idalide-Thematik bei Sarti und Cherubini bei, vermittelt den Inhalt des Inka-Dramas, das sieben Libretti und elf Vertonungen provozierte, des Librettos von Ferdinando Moretti bedienten sich vier Komponisten, neben Cherubini auch Sarti, und auch Cimarosa erlag der Verführung durch den sentimentalen Stoff.
Eine Diskussion über den Wert der italienischen Opern Cherubinis stellt der Artikel von Karl Traugott Goldbach dar. Ifigenia bietet den Anlass dazu, fordert zu einem Vergleich mit Gluck heraus und diskutiert den Zwang zum lieto fine. Generell wird erläutert, ob Fortschritt gleichzusetzen sei mit höherem musikalischem Wert, und der Beitrag befasst sich mit Grundsätzlichem im Vergleich italienischer mit französischen Opern.
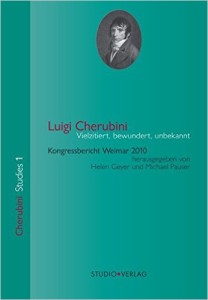 Angesichts jüngster Aufführungen ist der Aufsatz Heiko Cullmanns Von Médée zu Medea besonders interessant. Wie bei Carmen geht es um die Frage Dialog- oder Rezitativfassung (von Lachner für die Frankfurter Aufführung 1855), die Veränderungen an der Partitur durch fremde oder die Hand des Komponisten, die verhängnisvolle Rolle, die Maria Callas spielte, indem sie die italienische Rezitativfassung als ausschließlich würdige ansah (und ja auch die originalen Sprechtexte nicht kannte). Erst 1996 gab es im französischen Compiegne sowie im englischen Buxton szenisch und dann 1997 in New York konzertant die Urfassung, wovon es auch optische bzw. akustische Dokumente gibt, 1998 kam für Deutschland Gießen – womit der Bann gebrochen scheint, wenngleich die Bastardfassung Lachners immer noch vorherrscht. Bizarre Bearbeitungen wie die kürzlich von Alan Curtis mit neuen Rezitativen tragen wenig zur Kenntnis der originalen Medée bei. In operalounge.de wurde darüber berichtet.
Angesichts jüngster Aufführungen ist der Aufsatz Heiko Cullmanns Von Médée zu Medea besonders interessant. Wie bei Carmen geht es um die Frage Dialog- oder Rezitativfassung (von Lachner für die Frankfurter Aufführung 1855), die Veränderungen an der Partitur durch fremde oder die Hand des Komponisten, die verhängnisvolle Rolle, die Maria Callas spielte, indem sie die italienische Rezitativfassung als ausschließlich würdige ansah (und ja auch die originalen Sprechtexte nicht kannte). Erst 1996 gab es im französischen Compiegne sowie im englischen Buxton szenisch und dann 1997 in New York konzertant die Urfassung, wovon es auch optische bzw. akustische Dokumente gibt, 1998 kam für Deutschland Gießen – womit der Bann gebrochen scheint, wenngleich die Bastardfassung Lachners immer noch vorherrscht. Bizarre Bearbeitungen wie die kürzlich von Alan Curtis mit neuen Rezitativen tragen wenig zur Kenntnis der originalen Medée bei. In operalounge.de wurde darüber berichtet.
Gianluca Ferrari befasst sich mit der Ballettoper Anacréon, 1973 von der RAI aufgenommen und 1983 von Gavazzeni an der Scala herausgebracht, und stellt die Entwicklung des Textes dar.
Einfach „Beobachtungen“ stellt Erich Tremmel über Les abencérages ou l’étendard de Grenade an, über den umstrittenen Zeitpunkt der Uraufführung und die Frage, ob die Geschichte um den Verlust einer Standarte tatsächlich, wie vermutet, auf ein Vorkommnis zwischen dem napoleonischen Marschall Soult und Napoleons Bruder Joseph, König von Spanien, zurückzuführen ist. Ein wesentlicher Teil des Beitrags ist der ungewöhnlichen Instrumentierung des Werks gewidmet.
Den Band mit der Ordnungszahl 1 zu versehen, spricht von einem gewissen Optimismus der Herausgeber, die hoffentlich nicht wieder einen ganz runden Jahrestag abwarten müssen, ehe sie den zweiten erscheinen lassen können ( (Studio Verlag, 342 Seiten mit Abbildungen und Notenbeispielen 24×17 cm, Hardcover mit Fadenheftung; ISBN 978-3-89564-158-9). Ingrid Wanja

