.
Als konservativer Bewahrer und als vielgeehrtes Bollwerk gegen Wagner wurde der 1920 in Berlin verstorbene und uns nur noch durch sein Violinkonzert in Erinnerung gebliebener KomponistMax Bruch in seiner Zeit gesehen, die er mit seinen 85 Jahren deutlich überlebte und während der er zu seiner eigenen Legende wurde. Er war wie die Komponisten Dorn oder Bungert einer der Wenigen, die nicht dem Wagner-Sog verfielen, und er behauptete sich dagegen erfolgreich. Wir sind heute geneigt, Richard Wagners Bedeutung für seine Epoche zu überschätzen, wenngleich gewiss sein Einfluss aus moderner Sicht übermächtig war. Deshalb ist es so spannend, auf Musiker zu stoßen, die sich erfolgreich seiner Wirkung widersetzten, bei denen – wie die Kritik 1858 zur Uraufführung seiner Jugendoper Die Loreley schrieb – »keine grellen Dissonanzen, keine Tortur des Ohrs durch ewige Vorhalte und Trugschlüsse, nichts Widriges und Hässliches« herrschten.
Vergessen blieb diese Oper, Die Loreley, weitgehend bis zum November 2014, als sie konzertant beim Münchner Rundfunkorchester (und der Philharmonische Chor Prag) unter Stefan Blunier mit Michaela Kaune, Magdalena Hinterdobler, Thomas Mohr, Benedikt Eder, Danae Kantora, Jan-Hendrik Rooterink, Thomas Hamberger und Sebastian Campione als Sonntagskonzert gegeben wurde. In dieser Konstellation ist sie auch nun bei cpo auf 2 CD erschienen und gibt uns wie vergleichsweise Die Nibelungen von Dorn (vergl. operalounge.de) einen hoch informativen Einblick in die noch nicht von Wagner beherrschte Musikszene des mittleren neunzehnten Jahrhunderts.
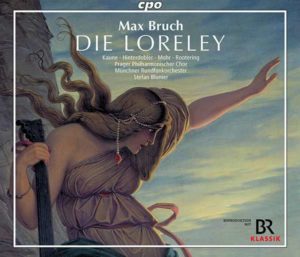 Rolf Fath beschreibt seine Eindrücke beim Hören der neuen cpo-CD, die wir nachstehend zitieren. Vorher gibt es den hochinformativen Text von Florian Heurich aus dem Programmheft zur konzertanten Aufführung. Beiden sowie dem Münchner Rundfunkorchester sei Dank! G. H.
Rolf Fath beschreibt seine Eindrücke beim Hören der neuen cpo-CD, die wir nachstehend zitieren. Vorher gibt es den hochinformativen Text von Florian Heurich aus dem Programmheft zur konzertanten Aufführung. Beiden sowie dem Münchner Rundfunkorchester sei Dank! G. H.
.
.
Und nun Florian Heurich: Max Bruch – ein Hüter der Romantik. Er war ein unerschütterlicher Romantiker, dessen künstlerische Ideale und Weltanschauung sich Zeit seines langen Lebens kaum änderten. Max Bruch wurde 1838 in Köln geboren und starb 1920 in Berlin. In dieser Zeitspanne fand jedoch in Deutschland und Europa ein drastischer Wandel statt. Als Kind erlebte Bruch noch die Revolution von 1848 mit, als alter Mann das Ende des Ersten Weltkriegs, und sein Leben war geprägt durch die politischen und gesellschaftlichen Umstände des Deutschen Kaiserreichs.
In Kunst und Musik verhielt es sich ähnlich. Die Avantgarde der Jahrhundertwende verdrängte mehr und mehr die Romantik des 19. Jahrhunderts. Doch selbst als längst die Neutöner die musikalische Bildfläche betraten, hielt Bruch an seinen frühromantischen Idealen sowie an seinen großen Vorbildern Schumann und insbesondere Mendelssohn Bartholdy fest. Er kämpfte gegen alle modernen Tendenzen, war ein Gegner Wagners und später von Komponisten wie Richard Strauss und Max Reger, die er für Vertreter einer nichtswürdigen »musikalischen Sozialdemokratie« hielt. Den Veränderungen um ihn herum konnte er sich nicht anpassen; er isolierte sich zunehmend, und eine gewisse Verbitterung machte sich breit.
Wegen der enormen Popularität seines Ersten Violinkonzerts wird oft übersehen, dass Bruch darüber hinaus noch fast hundert weitere Werke geschrieben hat – eine Tatsache, die schon den Komponisten selbst besonders ärgerte. Auch wenn die Oper eine untergeordnete Rolle spielt, so macht doch die Vokalmusik in Form von Oratorien, weltlichen Chorwerken und Liedern einen nicht unerheblichen Teil seines Schaffens aus. Erstaunlicherweise ist sogar Bruchs Opus 1 ein Bühnenwerk, das Singspiel Scherz, List und Rache (1858), das er noch unter der Anleitung seines Lehrers, des angesehenen Musikpädagogen Ferdinand Hiller, schrieb. Für die Opernbühne folgten außerdem Die Loreley (1863) und Hermione (1872).
Gerade die Geschichte um das verführerische, nixenhafte Zauberwesen, das auf einem Felsen am Rhein sitzt und durch seine Schönheit und seinen Gesang die Männer ins Verderben reißt, war als Inbegriff deutscher Romantik wie geschaffen für den Romantiker Bruch.

„De Loreley“/ St. Goarhausen/ Rheinfelsen/ Postkarte um 1916/ OBA
Der Librettist Emanuel Geibel hatte das Textbuch zu Die Loreley ursprünglich für Felix Mendelssohn Bartholdy, Bruchs großes Vorbild, geschrieben. Das Opernprojekt ging jedoch schleppend voran, Mendelssohn komponierte nur drei Nummern, ehe er starb. Daraufhin lehnte Geibel alle weiteren Anfragen von anderen Komponisten, das Librelto vertonen zu dürfen, ab. Im Herbst 1 860 ließ er den Text jedoch veröffentlichen, und Bruch war einer der ersten Käufer des Buchs. »Es ist […] begreiflich u. natürlich, dass ich die Geibel’sche Loreley-Dichtung mit Entzücken las u. mich darauf stürzte, wie ein wildes Tier auf seine Beute«, so Bruch, der »in einem Rausch d. Begeisterung« sogleich begann, einige Szenen des Werks zu vertonen. Damit setzte er sich eigenmächtig über das strikte Verbot des Librettisten hinweg; erst verspätet bat er Geibel um die Genehmigung, die dieser jedoch zunächst verweigerte. Auch Anfragen an die Mendelssohn-Nachfahren blieben erfolglos. Dennoch komponierte Bruch weiter an der Oper, die er schließlich dem noch immer zögerlichen Librettisten in Auszügen präsentieren konnte. Auf Vermittlung des Grafen von Stainlein, eines Bruch wohlgesonnenen Musikfreundes, wurde ein Treffen mit Geibel in München arrangiert. Da sich Geibel »die Komposition seiner Dichtung ganz schlicht und volkstümlich vorstellte«, spielte ihm Bruch »nur die kleineren u. einfacheren Stücke d. Oper« vor. Kurz darauf schreibt Bruch an einen Freund: »Die Loreley ist frei!. .. Geibel sagte geradezu – ,Ihr Trotz hat den meinen überwunden; wären Sie nicht, trotz meines ausdrücklichen Verbots, mit der Fertigen Oper gekommen, so hätte ich Ihnen die Erlaubnis nie gegeben.«
Hoffnungen, dass die Uraufführung in München stattfinden könne, erfüllten sich nicht, da Franz Lachner, die führende Persönlichkeit des Münchner Musiklebens zu jener Zeit, nicht sonderlich an dem Werk interessiert war. Bei Lachners Bruder Vinzenz, der Hofkapellmeister in Mannheim war, hatte Bruch mehr Erfolg, sodass die Premiere für den 14. Juni 1863 am Mannheimer Hof- und Nationaltheater angesetzt wurde. Zu den illustren Besuchern der ersten Aufführungen zählten etwa Anton Rubinstein, Joseph Joachim Raff, Hermann Levi und Clara Schumann, die später an Bruchs Lehrer Ferdinand Hiller schreibt: »[… ] es sind sehr schöne Momente darin, durchweg Orchester und Chor so meisterhaft behandelt, dass ich es kaum von einem so jungen Componisten begreife.« Emanuel Geibel hingegen war nicht gekommen, da er Bruchs Komposition skeptisch gegenüberstand: »Jene volksliedartigen Weisen, die mir bei den Worten vorschwebten, werden dem Musiker wohl kaum zu Gebote gestanden haben.«

„Die Loreley“/ Postkarte/ OBA
Als Bruch seine Loreley schrieb, war er erst Anfang zwanzig. Dass Mendelssohn sich bereits mit diesem Stück beschäftigt hatte, war ihm Ansporn und Bürde zugleich. Das Herzstück der Oper ist die große Beschwörungsszene, in der Lenore, die Hauptfigur, die Rheingeister anruft und ihre Seele für sinnliche und todbringende Schönheit verkauft; sie will sich an dem Pfalzgrafen Ott rächen, der sie betrogen hat. Dies ist eine der wenigen Szenen, die schon Mendelssohn vertont hatte, und die erste, die auch Bruch in Angriff nimmt. Die zentrale Bedeutung, die er diesem Teil der Handlung beimisst, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass er daraus den ganzen Zweiten Akt der Oper macht. In Geibels Textvorlage hingegen ist Lenores Anrufung der Wassergeister noch Teil des Ersten Akts. Formal ist er als große Szene mit Chor gestaltet, in der sich rezitativische und ariose Passagen abwechseln. Auf einen Einleitungschor der Rheingeister folgt in düsterem b-Moll Lenores Klagegesang über ihre verratene Liebe. In einem dialogischen Mittelteil bittet Lenore die Geister um Hilfe bei ihrer Rache; als Preis soll sie ihre Liebe opfern und sich mit dem Rhein als Braut vermählen. Eine Stretta, in der sie die Verlobung mit dem Rhein besiegelt, beschließt die Szene. Nicht nur musikalisch, auch dramaturgisch ist dies eine der interessantesten Stellen der Oper, da sich hier die Wandlung der Protagonistin von der verzweifelt Liebenden zum Geisterwesen und zur Rachefurie vollzieht, die eindrucksvoll mit musikalischen Mitteln nachgezeichnet wird. Bruch und Geibel ziehen alle Register der Schauerromantik, für die im Bereich des Musiktheaters Giacomo Meyerbeers Robert le diable mit seiner Friedhofsszene oder Carl Marie von Webers Freischütz mit der Szene in der Wolfsschlucht unumstößliche Paradigmen sind.

„Die Loreley“/ Carl Joseph Begas, 1835/ Wiki
Der Erste Akt spielt sich noch in einer weitgehend idyllischen Atmosphäre ob – mit Arien von Otto und Lenore, einem Duett der beiden und vor allem mit stimmungsvollen Chören wie einem Ave-Maria oder einem Winzerlied. Jedoch schon die Erkenntnis Lenores, das sie betrogen wurde, leitet im Aktfinale eine Wendung ein, die im Zweiten Akt komplett vollzogen wird. Als schillernde, rätselhafte und dabei doch von einer gewissen Kühle umgebene femme fatale erscheint Leonore dann im Dritten Akt. Mittlerweile ist sie zur Loreley geworden und treibt mit ihrem Gesang, der zentralen Musiknummer des Akts, Otto und die übrigen Männer in den Wahnsinn. Selbst die Kirche in Gestalt des Erzbschofs, der über die als Hexe Verurteilte Gericht halten soll, ist nicht vor ihrem Verderben bringenden Zauber gefeit. Einen lyrischen Kontrast zur weil ausladenden Titelpartie repräsentiert Ottos Braut Bertha mit ihrer zart-kontemplativen Kavatine im Dritten Akt.
Der Vierte Akt schließlich ist als großes Crescendo gestaltet. Ein Chor der Winzerinnen und Winzer evoziert noch eine trügerische Idylle, ein einfaches Strophenlied von Lenores Vater Hubert schließt sich an. Vor dem großen Finalkomplex steht als erster Höhepunkt Ottos Verzweiflungsarie. Dabei handelt es sich um eine breit angelegte, dreiteilige Nummer, bei der sich Orgelklang und Mönchsgesang hinter der Szene in Ottos heldentenorale Aufschwünge mischen.

„Die Loreley“/ Postkarte/ OBA
Das Finale selbst beginnt mit einer Orchestereinleitung, in der Friedrich Silchers Melodie »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten« nach dem bekannten LoreleyGedicht von Heinrich Heine zitiert wird und die direkt in Lenores beseelte Liebesklage übergeht. Glutvolle Duettpassagen, in denen Otto seine Geliebte noch einmal für sich gewinnen will und diese nur schwer widerstehen kann, und die Unisono-Rufe der Rheingeister, die Lenore an ihren Schwur erinnern, leiten schließlich in die finale Katastrophe. Otto stürzt sich in den Rhein, und in einem Schlussbild sieht man Lenore, die Loreley, die nun auf immer und ewig mit dem Fluss vermählt ist, mit einer Harfe auf ihrem Felsen sitzen, während die Wassergeister ihr in einem Schlusschor huldigen. Diese letzte Szene zeigt Lenore zum ersten Mal in der Gestalt der Loreley, wie sie in der Sage beschrieben wird, nämlich als nixenhafte, blonde Sirene, die von ihrem Felsen aus die Männer mit ihrem Gesang betört und in den Tod reißt.

Der Autor: Florian Heurich ist freier Autor und Musikjournalist, schreibt und produziert Radiofeatures und Reportagen für BR-Klassik und gestaltet das Online-Format Opern.TV sowie die Audio-Podcasts der Bayerischen Staatsoper. Dabei versucht er immer seine Opernleidenschaft, seine Reiselust nach Asien und Lateinamerika und seine Arbeit unter einen Hut zu bringen/ Quelle Bayr. Staatsoper
Bis dahin hat die Figur eine Wandlung durchlaufen vom unschuldigen Mädchen, das betrogen wird, über die Rachefurie bis hin zur mythischen, geheimnisvollen Zauberin und Braut des Rheins. Bruch zeichnet diese unterschiedlichen Phasen musikalisch nach, indem Lenores anfänglich eher lyrischer Gesang sich immer dramatischer zuspitzt und am Schluss in den letzten, harfenbegleiteten Phrasen der Loreley einen übersinnlichen, irrealen Charakter bekommt. Eingebettet ist diese Figur in eine Landschaft, die Spiegelbild ihres jeweiligen Stadiums ist: liebliche Weinberge, ein wildes Felsental, mystisch-romantische Rheinszenerie.
In Geibels Libretto ist all dies vorgegeben, und Bruch lässt diesen Stoff, in dem sowohl im Ambiente als auch in der Handlung alles angelegt ist, was eine »Große romantische Oper« – so der Untertitel des Werks – ausmacht, in eine hochromantische Tonsprache , Dies ist es auch, was in einer Rezension der Uraufführung, die insgesamt durchaus als Erfolg bezeichnet werden kann, hervorgehoben wird. Bruch, der Wagner-Gegner, wird als Bewahrer einer klassizistisch-romantischen Tradition gefeiert, bei dem es »keine grellen Dissonanzen, keine Tortur des Ohrs durch ewige Vorhalte und Trugschlüsse, nichts Widriges und Hässliches« gebe. Von seinem Jugendwerk Die Loreley bis zu seinem Tod mit 82 Jahren sollte Bruch, dieser letzte Romantiker, seine künstlerischen Ideale und seinen Kompositionsstil unverändert beibehalten, quasi als Hüter einer längst vergangenen Zeit. Florian Heurich
.
.
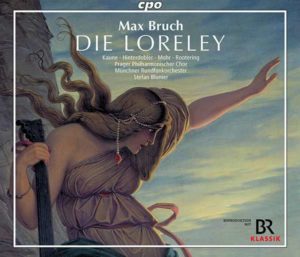
Max Bruch: „Die Loreley“, der Münchner Mitschnitt bei cpo
Und nun Rolf Fath: Ein nobler melodischer und aufblühender Ton durchzieht die stimmungsvolle Einleitung. Man hat allen Grund, wider besseres Wissen, auf eine Rarität der deutschen romantischen Oper neugierig zu sein. Max Bruchs Große romantische OperLoreleyist völlig verschwunden; erst Stefans Bluniers Konzert mit den München Rundfunkorchester vom 23. November 2014 ruft uns in Erinnerung, dass dies die Oper hätte sein sollen, die für Felix Mendelssohn-Bartholdy bestimmt war. Und natürlich gibt es noch die Loreley (1890) des Wally-Komponisten Alfredo Catalani. Man darf sich nach gut 140 Minuten und vier Akten schon ein bisschen wundern, weshalb man dieser fünf Jahre vor dem berühmten Violinkonzert 1863 in Mannheim von Vinzenz Lachner uraufgeführten Oper keine Chance geben wollte. Clara Schumann meinte, „es sind sehr schöne Momente darin, durchweg Orchester und Chor so meisterhaft behandelt, dass ich es kaum von einem so jungen Componisten begreife“.
Die Loreley des 25jährigen Bruch klingt nach Spohr, Schumann, dessen Genoveva ja eine ähnlich volkstümlich legendehhafte Frauengestalt beschreibt, und Mendelssohn, womit auch ihre teilweise mangelnde Dramatik und Bühnentauglichkeit umrissen sind. In der Folge von Marschners 30 Jahre älterem Hans Heilig und den diversen Undinen-Stoffen thematisiert sie die Begegnung eines Menschen mit einem übersinnlichen Wesen, im Fall der von Clemens Brentano um 1800 durch seine Ballade in die Literatur eingeführten Loreley des Pfalzgrafen Otto mit des Fährmanns-Tochter Lenore, die erst durch die Zurückweisung Ottos und seine Hochzeit mit Bertha von Stahleck von den Rheingeistern zur Braut des Rheines erkoren wird, die Männer verführen und ins Unheil stürzen kann. So geschieht es. Otto bereut, irrt nach Berthas Tod auf der Suche nach der Geblieben umher, findet sie auf einem Felsen sitzend. Als sie ihn endgültig abweist, stürzt er sich in den Rhein. Loreley ist in Emanuel Geibels Text eine starke Frau, die wegen Hexerei angeklagt wird, dem Tod auf dem Scheiterhaufen entgeht, weil es ihr gelingt, die Richter für sich einzunehmen, und die schließlich zur sinnlich-verderberischen Verführerin wird. Bruch hat alles aufgeboten, was die Konventionen der romantischen Oper bereithielten: kräftige Chöre, der Winzerinnen, Rheingeister, der Hochzeitsgäste vor der Kapelle, die an Webers volkstümliche Beispiele erinnern, Arien, Lieder, Kavatine, Gebet, Ensembles, Duette. Die Ensembles und Aktschlüsse sind zudem dramatisch geradezu monumental geschliffen, gegen Ende schwächelt Loreley allerdings ein wenig.

„Loreley“: der Komponist Max Bruch/ Wikipedia
Die cpo-Aufnahme, welche die vier Akte großzügig auf drei CDs verteilt (777 005-2) kann aufgrund der Mitwirkung des Prager Philharmonischen Chors vor allem in den Chorszenen auftrumpfen. Stefan Blunier und das Münchner Rundfunkorchester unternehmen alles, um die vergessene Oper, wenn schon nicht zu retten, so doch zu ihrem Recht kommen zu lassen. Sie kosten die romantische Musik, auch die Soli der Holzbläser und Harfe, vital aus, so im ersten Finale und im kurzen zweiten Akt, dessen einzige Nummer mit Lenore und den Geistern als „Große Szene“ überschrieben ist. Die Titelrolle erweist sich als ausgesprochen dankbar und Michaela Kaune kann die Wandlungen der Lenore-Loreley mit einem lieblichen, dabei unnahbar kühl scheinenden Sopran nachvollziehen, darunter der „Gesang der Loreley“ mit Chor („Siehst du ihn glühen im Brautpokal“). Ausgesprochen eindrucksvoll gerät Thomas Mohr, der 1990 noch die Bariton-Titelrolle des Hans Heilig auf Marco Polo gesungen hatte, der Pfalzgraf Otto, den er heldentenoral hochtourig, viril leidenschaftlich und mit über dem Ensemble des dritten Aktes thronenden Tönen singt. Magdalena Hinterdobler macht wenig aus der Kavatine der am Boden zerstörten Bertha, Sebastian Campione fällt als Lenores Vater Hubert angenehm auf, Benedikt Eder ist prägnant als Ottos Seneschall Leupold, Jan-Hendrick Rootering als Minnesänger Renald fehl am Platz. Rolf Fath
.
.Den vorstehenden Artikel, der im Programmheft anlässlich der konzertanten Aufführung der Oper mit dem Münchner Rundfunkorchesters 2014 erschien, übernahmen wir mit sehr freundlicher Genehmigung des Orchesters/ Doris Sennefelder und des Autors, der Lesern von operalounge.de mit seinen zahlreichen Artikeln zu den in München konzertant aufgeführten Opern kein unbekannter ist. Danke! Abbildung oben: „Die Loreley“ von Carlo Joseph Begas, 1835, Wikipedia
.
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

