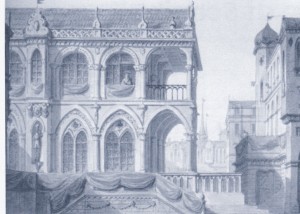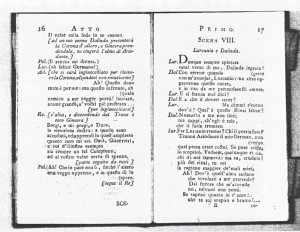.
Kaum eine andere Neuaufnahme der letzten Jahre bereitet mir soviel Freude wie die vorliegende Ginevra di Scozia von Giovanni Simone Mayr (um für diese seine erfolgreichste italienische Oper auch seinen italienischen Namen zu verwenden), die bei Oehms als Mitschnitt des Bayerischen Rundfunks (3 CD Oehms Classics OC 960) in ihrer konzertanten Aufführung am 14. Juni 2013 im Stadttheater von Ingolstadt festgehalten wurde. Ingolstadt ist der Sitz der Internationalen Simon-Mayr-Gesellschaft (unter Vorsitz von Rainer Rupp), die namhaft an der Pflege des nahe Ingolstadt in Mendorf geborenen Komponisten beteiligt ist.
Während Mayrs Geburtsjahr 2013 anderswo fast unbemerkt vorbei ging, rafften sich Ingolstadt und der Bayerische Rundfunk zu einer Großtat auf und brachten Ginevra di Scozia in der gültigen Edition bei Ricordi heraus, konzertant und wirkungsvoll. Ich war schon 2001 zur 200-Jahr-Feier der Premiere mit einer szenischen Aufführung in Triest gewesen und hatte dort bereits von dem musikalischen Reichtum des Werkes geschwärmt, aber die dortige Besetzung (bei Opera Rara nachzuhören) war stilistisch und vokal nicht auf diesem Niveau von Ingolstadt gewesen, auch weil die Triester Premierenbesetzung mit einem wirklich gewöhnungsbedürftigen Counter als Lurciano besetzt war, der im Gegensatz zur Alternative (Gabriella Sborgi, eben nicht aufgenommen, was auch schade wegen der tollen Romina Basso als Ariodante war) mir den Abend verdarb
Nun, bei Oehms (und am BR vorab gesendet und begeisternd) hat man eine homogene Besetzung vor sich, die nur entzücken kann. Myrto Papatanasiu bezaubert als resolute, gar nicht weinerliche und dabei dunkel-schön singende Ginevra. Anna Bonitatibus begeistert mit gut geführter, weicher Mezzostimme der durchaus heroischen Dimensionen in der Kastratenpartie des Ariodante, ganz wunderbar (und Gott sei Dank kam niemand auf die Idee, einen der üblichen Counter hierfür zu verpflichten!). Magdalena Hinterdobler gibt die freche, liebeshungrige Dalinda mit Effekt. Stefanie Irányi ist ein markanter Bruder des Ariodante, Lurciano (Mezzo, danke!). Der renommierte Mario Zeffiri ist der fiese Polinesso in Person und führt seinen geschmeidigen Tenor in dieser Bösewichtpartie zwischen Schöngesang und Häme außerodentlich eindrucksvoll. Marko Cillic ist ein präsenter Knappe Vafrono, Virgil Mischok der Vorsteher des Templerordens. Peter Schöne sprang sehr kurzfristig als König von Schottland mit markantem Bariton ein – chapeau für diese Leistung.
Der Männerchor des Heinrich-Schütz-Ensembles Vornbach (Martin Steidler) und das flexible Münchner Rundfunkorchester stehen unter der Leitung des Spezialisten George Petrou, der vom Hammerflügel aus dirigiert und der ein rasantes, individuelles Idiom in die Musik bringt, ihr ein Gesicht gibt und die Tempi federnd-beweglich hält. Namentlich die Rezitative gehen ab wie die Post und tragen zur lebendigen, natürlichen Wirkung bei. Ich muss gestehen, dass ich bereits die Radioaufnahme viele Male gespielt und nun die CDs seit Tagen laufen habe. Dieser Mayr geht wirklich in die Füße. Danke an alle.
Angesichts wohl auch der finanziellen Zwänge beim beigefügten Spar-Booklet der CD-Ausgabe (immerhin das Libretto italienisch-deutsch und eine deutsch-englische Inhaltsangabe) gibt es nachfolgend drei Artikel zum Werk und zum Komponisten aus dem umfangreichen originalen Programmheft des Bayerischen Rundfunks zum Konzert in Ingolstadt 2013 (wie auch die llustrationen – soweit nicht anders gekennzeichnet mit Dank übernommen), die zu Recht auf die Wichtigkeit dieser Mayr-Oper damals und auf die der Einspielung bei Oehms heute hinweisen. Auch wegen der rein englischsprachigen Ausstattung der älteren Opera-Rara-Aufnahme aus Triest werden sich dankbare Leser finden. G. H.
.
Auf dem Weg zur romantischen italienischen Oper – Ginevra di Scozia/die Verbreitung: »Dieser Mann hat aber zu seiner Zeit eine glänzende Epoche gemacht«, hieß es 1831 in der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung anerkennend über den Komponisten Simon Mayr. Von seinen Zeitgenossen hoch geschätzt, geriet Mayr (geboren 13. Oder 14. Juni 1763 in Mendorf bei Altmannstein/Ingolstadt; gestorben 12. Dezember 1845 in Bergamo) später jedoch fast vollständig in Vergessenheit, und es sollte bis zum ausgehenden 20. Jahrhundert dauern, ehe in der Fachwelt wieder nachhaltig auf seine Bedeutung hingewiesen wurde. Als die Musiktheaterwerke des Komponisten Mitte des 19. Jahrhunderts von den europäischen Opernbühnen verschwanden, war wesentlich nur dem Schülerkreis Simon Mayrs sein Name bekannt. Dabei rechnete der Schweizer Musikhistoriker Arnold Niggli noch 1885 Mayrs Oper Ginevra di Scozia unter die »zugkräftigsten Werke« des Komponisten (21. April 1801 am Teatro Nuovo in Triest).
Nach der Uraufführung 1801 am Teatro Nuovo in Triest beherrschte das Stuck europaweit die Bühnen. Noch im selben Jahr fand beispielsweise die Premiere in Wien statt; es folgten viele weitere Aufführungen, u. a. an der Mailänder Scala, am Münchner Hoftheater oder auch in Weimar (zur Aufführungsgeschichte nachstehend). Der bahnbrechende Erfolg von Mayrs Ginevra di Scozia manifestierte sich also, wie die weit verstreuten Quellen belegen, in erster Linie über die Aufführungen. Darüber hinaus verbreiteten zahlreiche Notendrucke und Abschriften besonders wirkungsvoller Szenen und Arien sowie Bearbeitungen das Werk. Die einleitende sinfonia war zum Beispiel auch in ihrer Klavierfassung überaus populär. Und von Joseph Hartmann Stuntz, Hofkapellmeister in München, stammen die 1815 in Augsburg erschienenen Variationen für Harfe und Klavier bzw. für zwei Klaviere über einen Marsch aus der Oper. Eine besonders intensive Rezeption der Oper ist naturgemäß für Italien zu verzeichnen, wo Ginevra di Scozia iiber dreißig Jahre hinweg kontinuierlich gespielt wurde, bevor sie von den Bühnen verschwand. Erst 1901 hat der Musikverleger Carlo Schmidl zur 100-Jahr-Feier des Teatro Giuseppe Verdi in Triest Mayrs Ginevra di Scozia wiederentdeckt. (…)
Gesangsstars der Zeit: Ähnlich wie heute waren auch damals die Gesangsstars oft die Hauptattraktionen der Oper. Mit dem Tenor Giacomo David als Polinesso und dem Kastraten Luigi Marchesi als Ariodante begegneten sich bei der Uraufführung von Mayrs Ginevra di Scozia interessanterweise nicht nur zwei Rivalen, sondern ganze Opernwelten: Die Partie des Ariodante, von Mayr als Kastratenrolle konzipiert, ist dabei als Erbe der alten Operntradition zu verstehen, das dank Aufklärung, Humanismus, französischer Herrschaft und nicht zuletzt Napoleons Gesetzgebung bald schon abdanken sollte (wenngleich auch Napoleon durchaus noch ein feines Ohr fur den Kastratengesang besaß). Ariodante ist in Ginevra di Scozia der Held, der romantische schwarze Ritter. Die Tenorpartie hingegen kommt dem Gegenspieler, dem Intriganten und Boösewicht Polinesso zu und wurde mit Giacomo David von einem der berühmtesten Tenöre des Jahrhunderts gesungen. Wie schon bei der Figur des bösen Boleslao in der Mailander Fassung seiner Lodoiska interessierte Mayr auch bei Ginevra di Scozia besonders das Zwiespältige der Figuren: Dem strahlenden Helden Ariodante wird mit Polinesso ein Antiheld, ein Schatten, entgegengestellt, der aber keineswegs eindimensional aufzufassen ist. (…) Wie Mozart weiß Mayr um die Wirkung konzertierender Instrumente zur Charakterzeichnung der Personen, was sich neben der Figur des Polinesso insbesondere auch bei Ginevra offenbart.
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurden die Kastraten zunehmend durch Frauen in Hosenrollen ersetzt. Einen der letzten Kastraten der Zeit, Giovanni Battista Velluti, erlebte 1810 Franz Grillparzer bei einer Wiener Aufführung von Ginevra di Scozia: »Mir begegnete heute etwas sehr Außergewöhnliches. Gleich Anfangs als der Kastrat Velluti nach Wien kam, hatte ich mir fest vorgenommen, ihn nicht zu hören, weil ich alles Widernatürliche scheue, und diese Art insbesondere verabscheue. Ich hielt meinen Vorsatz bis heute. Unablässiges Drängen einiger meiner Bekannten, Velluti zu hören, und wohl meistens die Langeweile, die mich plagte, trieben mich dazu an. Ich ging in’s Theater, wo man eben Ginevra di Scozia gab, aber wie ward ich bestraft. Kaum hörte ich den ersten Ton aus dem Munde des Kastraten, als mich ein sonderbares unangenehmes Gefühl überfiel, ich suchte es gewaltsam zu unterdrücken, aber es wuchs bald zu einer solchen Stärke, daß ich auf dem Punkte war, niederzusinken und halb todt das Schauspielhaus verlassen mußte. Ich erinnere mich mein ganzes Leben hindurch kein so widerliches Gefühl gehabt zu haben.« So deutlich Franz Grillparzers Unbehagen auch formuliert ist: Seine Kritik galt keineswegs Mayrs Oper, sondern ist als Kritik an einer Gesangspraxis zu verstehen, die zu diesem Zeitpunkt endgültig überholt war.
.
Modernität durch große Szenenkomplexe: Durchaus fortschrittlich zeigte sich Mayr indes in seinem Bestreben, größere Szenenkomplexe zu schaffen – oft unter Einbeziehung des Chores bzw. durch die Erweiterung des gängigen Orchesterapparats. So wird nach der einleitenden, rein instrumentalen Sinfonia die Introduzione (»Deh! Proteggi, o ciel demente«) wesentlich vom Chor bestimmt. In Form einer sogenannten preghiera (Gebet) erklingt die eindringliche Bitte der Schotten um den Sieg über den Feind; in ihrem sakralen Duktus verweist diese Passage unverkennbar auf den Musikstil Christoph Willibald Glucks wie auf die französische Oper der Zeit und führt den Zuhörer unmittelbar in die Handlung ein. Nach der Freudenbotschaft Lurcanios, dass Ariodante auf dem Schlachtfeld eingetroffen sei und die Feinde rasch in die Flucht schlagen werde, ertönt allgemeiner Jubel. Insgesamt ist diese introduzione in der Art eines Spannung erzeugenden Szenenkomplexes gestaltet und steht beispielhaft für eine Musikdramaturgie, die von der Nummernoper auf das durchkomponierte Musikdrama vorausweist. Auch im Folgenden setzt sich dieses Konzept fort, etwa mit Ginevras cavatina »Quest’anima consola«. Es ist die Auftrittsarie einer Titelheldin, der die Opferrolle innerhalb der Handlung zukommt. Leise (»mezza voce«) und innig hebt die Kavatine in ruhigem Moderato mit der Hoffnung auf eine freudige Nachricht an. In der cabaletta, dem zweiten, lebhafteren Ariensatz, wird dann Ginevras ungebändigte Vorfreude auf das Wiedersehen mit ihrem Geliebten Ariodante formuliert. Und genau dieser Wechsel im Gefühlsausdruck verleiht dem Bühnengeschehen Dynamik. Eine gesteigerte musikdramatische Wirkung wurde damals freilich ganz generell auch durch die gesteigerten klanglichen Mittel erreicht. An den führenden Bühnen der Zeit wuchs die Bedeutung der Opernorchester (nicht nur in zahlenmäßiger Hinsicht); ebenso wuchs auch die Bedeutung des Chores und speziell des Männerchores. Mayrs Ginevra di Scozia stellt auf diesem Weg hin zur neuen italienischen Oper romantischer Prägung ein wesentliches Bindeglied dar.

Zu Mayrs „Ginevra“- Adelaide Malanotte sang Ariodante 1808 in Bologna und war Rossinis erster Tancredi in Venedig 1813/Opera Rara
Triumphmarsch, Intrige und Vergebung: Bemerkenswerte Ausblicke auf die Zukunft gibt Ginevra di Scozia immer wieder. So erklingt im Verlauf des ersten Akts ein bewusst eingängig gehaltener Triumphmarsch: ein operndramaturgisches Regieelement, das Mayr in dieser Art immer wieder aufgreift und das bis hin zu Giuseppe Verdi Bestandteil der national geprägten italienischen Oper sein sollte. Die Szenenanweisung dazu beschreibt prunkvolle Terrassen mit Blick auf die königlichen Gärten, reich geschmückt für den Siegeszug Ariodantes. Im marschartigen maestoso folgt auf die fanfarenhafte Einleitung von Bläsern und Pauken, wiederholt vom Männerchor, der Auftritt des siegreichen Helden Ariodante. Gar nicht heroisch, vielmehr liedhaft wirkt dann aber die Präsentation seiner selbst in einem vom Heldenlob-Chor umrahmten larghetto cantabile(»Mai piu del trionfo«), das allen Lorbeeren zum Trotz vor allem von seiner Liebessehnsucht spricht. Die Krone ist ihm Ginevra. Eine Intrige Polinessos verhindert allerdings zunächst diese glückliche Verbindung. Ariodante verzweifelt am Leben und wird erst von den Eremiten im Wald davon überzeugt, als Retter Ginevras ausersehen zu sein, die auf dem Scheiterhaufen sterben soll. Mayr gestaltet hier einen pastoralen, klanglich durch die Bläser bestimmten Satz, der wirkungsvoll mit dem Männerchor der Eremiten kontrastiert: ein Musterbeispiel für Mayrs Fähigkeit, musikalische Charakterstücke zu entwickeln und den Szenen ein typisches Lokalkolorit zu verleihen.

Zu Mayrs „Ginevra“ – Francesca Festa-Maffei war Ginevra 1808 in Bologna und war die erste Fiorilla in Rossinis „Turco in Italia“ /Opera Rara
Das romantische Märchen endet mit Vergebung: Der König zeigt gegenüber Polinesso Milde und erlässt ihm die eigentlich angemessene Strafe durch den Tod. Nach alter Opera-seria-Tradition kommt hier also das Moment der »clemenza« (Güte) zu seinem Recht. Mayr schließt mit einem Ensemblesatz, in welchen der Außenseiter Polinesso integriert ist. Ganz auf diese Schlusswendung ins Gute und in Güte hatte Gaetano Rossi bereits sein Libretto konzipiert, das den Antihelden in das Happy End einzubinden weiß. Mayrs Ginevra di Scozia weist somit janusköpfig in zwei Richtungen: auf das alte Erbe und auf das neu Werdende, auf die alte italienische Oper und auf die neue romantische Oper. Mayr ist der Vermittler. Iris Winkler
(Iris Winkler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Simon-Mayr-Forschungsstelle an der Katholischen Universität Eichstätt- Ingolstadt und Editionsleiterin der Internationalen Simon -Mayr-Gesellschaft.)
Ginevra di Scozia im Rahmen der neuen Giovanni-Simone- Mayr-Werkausgabe: Obwohl die Bedeutung einiger Werke Mayrs in der Fachwelt unbestritten ist, liegt das wahre Wesen seiner Musik über weite Strecken noch im Dunkeln, weil der größte Teil von Mayrs Werken nicht ohne Weiteres zugänglich ist. In den letzten Jahrzehnten gab es zwar einige Wiederentdeckungen in Form von Aufführungen und Einspielungen. Diese beruhten aber in der Regel auf für den jeweiligen Zweck erstellten Notenausgaben. Bislang gab es kein einheitliches Editionsprojekt, das einen fundierten Einblick in Mayrs umfangreiches Schaffen ermöglicht hätte: ein Oeuvre, das an die 70 Opern, über 600 geistliche Kompositionen sowie zahlreiche rein instrumentale und pädagogische Werke umfasst.
Es ist das Ziel der Giovanni-Simone-Mayr- Werkausgabe des Verlags Ricordi in München, diese Lücke zu schließen und unter Berücksichtigung strenger editorischer Normen erstmals eine systematische Veröffentlichung von Mayrs Werken zu ermöglichen. Trotz bereits vorhandener Forschungsergebnisse harrt immer noch viel Quellenmaterial der Untersuchung. So ist das von John Stewart Allitt 1989 vorgelegte Mayr-Werkverzeichnis durchaus umfangreich, aber keinesfalls komplett. Und die Beschreibungen der Quellen sind kaum mehr als überblicksartige Darstellungen von Art und Zustand des Materials. Selbst dort, wo vermeintlich »vollständige« autographe Quellen (also Handschriften von Mayr selbst) vorliegen, treten bei näherer Untersuchung zuweilen gravierende Lücken zutage.
In anderen Fällen wiederum ist autographes Material verloren gegangen. Der Herausgeber muss dann aufgrund einer Analyse von anderem Quellenmaterial (z. B. Partiturabschriften, Instrumentalstimmen) entscheiden, ob und wie das vorhandene Material zur Erstellung einer Neuedition verwendet werden kann. Genau dies trifft auf Ginevra di Scozia zu. Nach der Uraufführung am 21. April 1801 am Teatro Nuovo in Triest (das damals zu Österreich gehörte) folgte bereits im Oktober desselben Jahres die Premiere in Wien. Eine weitere Aufführung ebendort fand 1810 statt. Insgesamt war Ginevra di Scozia eine der erfolgreichsten Opern des frühen 19. Jahrhunderts. Nach der Uraufführung blieb sie dreißig Jahre lang im Repertoire und wurde in ganz Europa gespielt. Die Aufführungsgeschichte belegt also ihre große Bedeutung innerhalb von Mayrs Schaffen. Gleichzeitig birgt das Werk große editorische Herausforderungen.
Da die autographe Partitur als verloren gelten muss, fehlt ein Zeugnis von der ursprünglichen Absicht des Komponisten oder einer Aufführung, in die Mayr persönlich eingebunden war. Die erhaltenen handschriftlichen Kopien und weiteren Quellen wie Instrumentalstimmen und Klavierauszüge belegen die weite Verbreitung des Werks und die Bedingungen des zeitgenössischen Opernbetriebs. Eine Oper war damals keineswegs sakrosankt; Mayr wie auch Rossini und andere Komponisten der Zeit konzipierten ihre Werke »um die Sänger herum«, statt eine Idealversion zu schreiben, für die man dann passende Interpreten hätte finden müssen. Es war absolut üblich, nach der Premiere einzelne Nummern einer Oper durch Einlagestücke zu ersetzen. Diese wurden entweder für bestimmte Sänger neu geschrieben, oder die Sänger brachten eigene Einlagearien mit: sogenannte »arie di baule« (Koffer). Die große Anzahl von Abschriften der Ginevra di Scozia belegt diese Praxis. Bei jeder Produktion wurden Änderungen eingearbeitet, Stücke ersetzt oder ausgelassen und anderes mehr. Schon für die Wiener Erstaufführung am Kärntnertortheater 1801, also im Jahr der Uraufführung, ersetzte man einige Nummern durch neu komponierte Stücke von Joseph Weigl. Wie der Musikwissenschaftler Marco Beghelli gezeigt hat, sind etwa dreißig Abschriften der Oper erhalten. Mehr oder weniger vollständig, weisen sie zugleich einen unterschiedlichen Grad der Bearbeitung auf. Zum Teil ersetzte man komplette Nummern, zum Teil stimmen die Stücke nur bis zu einem Auszug aus dem Libretto zur Uraufführung von Ginevra di Scozia 1801 in Triest gewissen Punkt mit dem Original überein. Und je nach Quelle stehen die Stücke manchmal in unterschiedlichen Tonarten.
Für die Wiederaufnahme des Werks 2001 am Teatro Verdi in Triest zur 200-Jahr-Feier der Uraufführung erstellte Beghelli in akribischer Kleinarbeit und unter Verwendung verschiedener Quellen eine neue Ausgabe von Ginevra di Scozia: eine Art Pasticcio, das der Gestalt des Werks bei seiner Uraufführung möglichst nahe kommen sollte. Vieles musste dabei eine Mutmaßung bleiben. Das Ergebnis dieser Arbeit hatte ohne Zweifel musikalisch und dramaturgisch ebenso seine Gültigkeit wie viele andere Versionen des Werks. Die Aufführung wurde mitgeschnitten und bei dem Label Opera Rara veröffentlicht. Doch noch vor Abschluss der CD-Produktion machte der Theaterwissenschaftler Daniel Brandenburg eine wichtige Entdeckung: In der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien fand er eine vollständige handschriftliche Kopie des Werks, bestehend aus Partitur und Instrumentalstimmen, die ganz klar vom originalen Aufführungsmaterial der Uraufführung abstammt. Das neu entdeckte Material entwertet in keiner Weise die Aufführung von 2001 oder die CD-Aufnahme, doch es machte eine erneute Durchsicht und Ausgabe des Werks erforderlich.
Brandenburg erläuterte seinen Fund in dem Aufsatz Mayrs »Ginevra di Scozia« und Wien (Mayr-Studien 5): In der Österreichischen Nationalbibliothek existieren zwei Manuskript-Gruppen zu Ginevra di Scozia. Da die Oper zweimal, nämlich 1801 und 1810, in Wien gespielt wurde, ist man geneigt, diese zwei Konvolute den beiden Produktionen zuzuordnen. Und in der Tat gehört eine der beiden Manuskriptgruppen zur Aufführung von 1810. Das andere, oben bereits erwähnte Konvolut (Partiturabschrift und ein Satz Instrumentalstimmen), muss anders eingeordnet werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach gehörte es zur Musikaliensammlung von Kaiserin Maria Theresia. Die Partitur wurde mit ziemlicher Sicherheit in Wien hergestellt. Sorgsam geschrieben und möglicherweise als Kopie für Schauzwecke bzw. als Bibliotheksexemplar gedacht, wurde diese Handschrift keinerlei Änderungen unterzogen.
Vergleicht man jedoch diese Partitur mit dem Wiener Libretto von 1801, so stellt sich heraus, dass sie nicht diese Produktion mit den Zusätzen von Joseph Weigl wiedergibt. Vielmehr spiegelt sie eine Version des Werks, die mit dem originalen Libretto der Uraufführung 1801 in Triest übereinstimmt. Glücklicherweise ist das Manuskript vollständig – bis auf das Duett Ariodante/Ginevra »Per pietà! Deh! Non lasciarmi« aus dem zweiten Akt, das offensichtlich zu Aufführungszwecken entfernt wurde. Dieses ist jedoch durch ein anderes Manuskript in der Österreichischen Nationalbibliothek überliefert. In Ermangelung einer autographen Partitur von Ginevra di Scozia und angesichts der Fülle von Abschriften, die jeweils deutlich voneinander abweichen, stellt der Fund dieses Manuskriptkonvoluts einen äußerst glücklichen Umstand dar: Es beinhaltet wohl eine Version des Werks, die sehr nah an der ursprünglich von Mayr konzipierten Werkgestalt liegen dürfte. Und es kann gut sein, dass diese Fassung der Ginevra, wie sie nun von Hans Schellevis in der Mayr-Werkausgabe dargeboten wird und wie sie auch der nun eingespielten konzertanten Aufführung zugrunde liegt, seit dem frühen 19. Jahrhundert nicht mehr gespielt wurde. Jürgen Selk (Jürgen Selk ist Generalherausgeber der Giovanni- Simone-Mayr-Werkausgabe des G. Ricordi -Bühnen- und Musikverlags.)
.
.
Ginevra di Scozia und Mayr in Italien: Als Simon Mayr den Auftrag zur Komposition von Ginevra di Scozia erhielt, währte seine Laufbahn als Komponist noch nicht einmal zehn Jahre, und er lebte auch noch nicht viel länger in Italien. Zuvor hatte es ihn, wie er 1811 in einem autobiografischen Abriss festhielt, »aufgrund verschiedener Umstände 1786 [oder 1787] nach Graubünden verschlagen«, wo er zwei Jahre lang blieb, bis er dann nach Bergamo in Norditalien kam. Die »verschiedenen Umstände«, die ihn in die Orte Poschiavo und Tirano in Graubünden geführt hatten, waren die politischen Widrigkeiten, mit denen sich Mayrs Förderer, Freiherr Thomas de Bassus, konfrontiert sah. Mayr oblagen im Hause de Bassus‘ vor allem musikalische Aufgaben: bei privaten Andachten und zur häuslichen Unterhaltung sowie bei der Erziehung der Kinder. Thomas de Bassus war Mitglied der Illuminaten gewesen, eines aufklärerisch gesinnten Geheimordens in Bayern, der 1787 von Kurfürst Karl Theodor verboten wurde. In der Folge waren die bayerischen Lehnsgüter von de Bassus beschlagnahmt worden, und er hatte sich auf seine Besitztümer in Graubünden zurückziehen müssen. Mayr war ihm gefolgt und verbrachte dort die Jahre 1786 bis 1788 (oder 1787 bis 1789). In einem überwiegend italienisch geprägten Umfeld lernte Mayr nicht nur die Sprache, sondern hatte auch erste Kontakte mit Persönlichkeiten aus dem Raum Bergamo: vor allem mit Giuseppe Ambrosioni, dem Schwager von de Bassus. Im Auftrag von de Bassus hatte Ambrosioni eine Druckerei gegründet, die von 1780 bis 1787 in Betrieb war und auch Bücher verbreitete, die als »verdächtig« galten (1782 erschien z. B. die erste italienische Übersetzung von Goethes Werther).
1787 lernte Mayr dann in Brusio, ebenfalls in Graubünden, den bekannten Orgelbauer Giuseppe Serassi kennen, dem das bis heute existierende Instrument in der dortigen Evangelischen Kirche zu verdanken ist. Wie Mayr in einer weiteren autobiografischen Schrift von 1827 mitteilt, machte er schließlich bei einer Reise nach Bergamo (vielleicht bei Ambrosioni) die Bekanntschaft von Carlo Lenzi, dem Kapellmeister der Kirche Santa Maria Maggiore. Mayr beschloss, nicht mehr autodidaktisch, sondern bei Lenzi Musik zu studieren, und siedelte – finanziell unterstützt von de Bassus – nach Bergamo über. Der Unterricht war jedoch eine Enttäuschung. Als das Geld, das er von seinem Wohltäter bekam, zur Neige ging, fand Mayr, wiederum in Bergamo, einen neuen Mäzen, den Grafen und Kanoniker Vincenzo Pesenti (ca. 1720- 1794), der ihn in seine Dienste nahm und ihm gleichzeitig die Studien in Venedig bei Ferdi- nando Bertoni (1725-1813), dem Kapellmeister von San Marco, bezahlte. Wichtiger als der Austausch mit Bertoni waren für Mayrs Ausbildung jedoch das intensive persönliche Studium und alles, was ihm Venedigs reiches Musikleben bieten konnte: eine Vielzahl von kirchenmusikalischen Aktivitäten, die Aufführungen an den Theatern, die Konzerte der Konservatorien. Mayr begann nun, eigene Werke vorzustellen: Kirchenmusik (1791) sowie vier Oratorien am Conservatorio dei Mendicanti (1791-1795). Während des Karnevals 1794 gab er am Teatro La Fenice sein Debüt mit einer opera seria, Saffo, die jedoch nur wenig Erfolg hatte. Ermutigt von dem berühmten Komponisten Niccolö Piccinni (1728-1800), der wegen Theater-Verpflichtungen in Venedig war, beschloss Mayr nach dem Tod seines Mäzens Pesenti im Dezember 1794, die Karriere als Opernkomponist entschiedener anzugehen. Mayr stand nun nicht mehr im Dienste irgendeines adligen Gönners, sondern war freischaffender Komponist auf dem italienischen Opernmarkt. Immer öfter stand sein Name auf den Programmen der venezianischen Theater – mit ernsten und komischen Opern bzw. Farcen; seine ersten Erfolge feierte er am Teatro La Fenice mit dem dramma Lodoiska (1796) und am Teatro San Benedetto mit der Farce Che originali! (1798). Im November 1796 hatte er Angela Venturali, eine Venezianerin aus wohlhabender Familie, geheiratet, der er seit 1790 Privatunterricht gab.
Mittlerweile hatte sich Mayrs Karriere gut entwickelt. Im neuen napoleonischen Italien (im Norden der Halbinsel, mit Mailand als Hauptstadt) schrieb er für das Teatro alla Scala, und er erhielt Aufträge für die Theatereröffnungen im österreichischen Triest (Ginevra di Scozia, 1801) und in Piacenza (Zamori, 1804). Die Stücke, mit denen er sich großen Ruhm erwarb, entstanden vornehmlich in dieser Region: Mailand (Alonso e Cora, 1804; Adelasia e Aleramo, 1807), Venedig (Elisa, 1804) und Genua (La rosa bianca e la rosa rossa, 1813).
Bei Ginevra di Scozia zum Beispiel wissen wir von rund sechzig Produktionen zwischen 1801 und 1831, ein Dutzend davon außerhalb Italiens: in Wien (zweimal), Berlin, München (dreimal), Stuttgart, Lissabon, Warschau, Weimar, Hannover, Korfu. Das ritterlich-höfische Ambiente und die musikalische Struktur von bestimmten Passagen daraus sollten zum Vorbild für Rossini und seine Oper Tancredi (1813) werden, deren Große Szene und Rondo des Titelhelden man wie »eine Imitation der Szene und Arie aus Mayrs Ginevra di Scozia« empfand (Giornale dipartimentale; Venedig, 13. Februar 1813). Für das Teatro San Carlo in Neapel komponierte Mayr Opern im Stil der französischen tragédie lyrique (Medea in Corinto, 1813; Cora, 1815), wie es seit ein paar Jahren an diesem Haus üblich war, und er erwarb sich damit definitiv den Ruf als gelehrter Dramatiker und Komponist. Paolo Fabbri (Paolo Fabbri ist Wissenschaftlicher Direktor der Fondazione Donizetti in Bergamo.)
.
.
Giovanni Simone Mayr: Ginevra di Scozia (Dramma eroico per Musica in Due Atti/ Libretto von Gaetano Rossi) mit Myrto Papatanasiu, Magdalena Hinterdobler, Anna Bonitatibus, Stefanie Irányi, Mario Zeffiri, Marko Cillic, Peter Schöne, Virgil Mischok; Markus Wolf – Solovioline; Männerchor der Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach (Martin Stedler); Münchner Rundfunkorchester, Leitung/Hammerflügel – George Petrou; 3 CD Oehms Classics OC 960
.
.
Bisherige Beiträge in unserer Serie Die vergessene Oper finden Sie hier