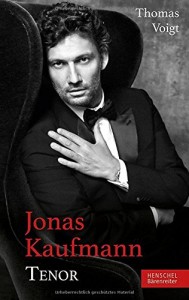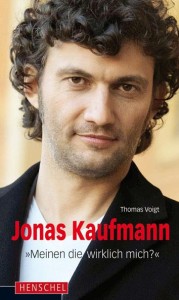Jonas Kaufmann kann nicht nur gut singen, er hat auch etwas zu sagen – wenn ihm denn die richtigen Fragen gestellt werden. Thomas Voigt, Stimmenexperte, Musikjournalist und Reisender in Sachen Oper, stellt solche Fragen. Er kennt Kaufmann gut – und immer besser, seit er „peu a peu“ dessen Presse- und Medienarbeit übernahm. Da fällt schon mal ein „neues“ Buch ab, das sich bei näherem Hinsehen als aktualisierte Neuauflage des Titels „Jonas Kaufmann – „Meinen die wirklich mich?“ von 2010 erweist. Seither hat sich einiges getan, die Neuerscheinung reagiert drauf mit einem inhaltlichen Update und etwa fünfzig zusätzlichen Seiten. Schon das Titelbild ist das glatte Gegenteil von einst. Es ist nicht mehr so fröhlich bunt, sondern gibt sich ganz als hohe Kunst in Schwarz-Weiß wie ein Hollywood-Film aus den 1930er Jahren. Aus dem netten Jungen von nebenan im T-Shirt ist ein tiefsinnig blickender Hochglanzstar im Smoking geworden. Auch das unrasierte kleine Tenor-Doppelkinn ist nun weg. Noch wirkt er wie verkleidet, als sei er hineingeborgt in das nicht ganz perfekte sitzende nagelneue weiße Hemd, unter dessen Manschette nicht ganz so zufällig wie es scheinen will, eine garantiert sündhaft teure Uhr hervorblitzt. Warum nicht. Der Mann verdient ja genug Geld. Er bastelt an seinem Image. Und er sieht nach wie vor blendend aus, was seinem Marktwert nicht abträglich ist. Bei Frauen wie bei Männern.
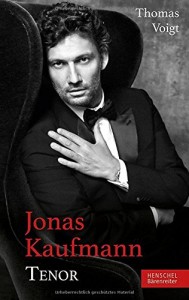 Reizwörter werden mal eben so fallen gelassen. „Wer hat den Größten, wer hat den Längsten?“ Kaufmann hat kein Problem mit derlei erotischem Geplänkel und kriegt geschickt die Kurve zum Eigentlichen, das sich seriös gibt: „Das Schöne an Oper und Opernstimmen ist ja, dass beide Ebenen angesprochen werden: das Sinnlich-Animalische und das Seelische.“ Er redet über Stimmen, berühmte Kollegen, seine Lehrer, technische Details, über eigene Ängste, Phobien und Niederlagen, über die Callas, die er gern komplette als Isolde gehört hätte (und nicht nur mit dem Liebestod), über Belcanto bei Wagner, Dirigenten, Deutschtümelndes im Lohengrin. Er weiß, wer Georges Thill war, hat sich bei seinem Werther-Studium mit dessen Aufnahmen beschäftigt, wollte mal französischer klingen als die Franzosen, kommt auf die Unterschiede des Faust bei Goethe und Gounod zu sprechen, reflektiert über Aspekte von Eigentherapie bei Don José. Er kommt auf Zeiten zu sprechen, da er „gern wie Wunderlich oder Corelli geklungen hätte“. Schließlich gelangt er aber zu dem Schluss, dass man sich als Sänger nichts Besseres antun könne, als „die eigenen Stimme zu finden“.
Reizwörter werden mal eben so fallen gelassen. „Wer hat den Größten, wer hat den Längsten?“ Kaufmann hat kein Problem mit derlei erotischem Geplänkel und kriegt geschickt die Kurve zum Eigentlichen, das sich seriös gibt: „Das Schöne an Oper und Opernstimmen ist ja, dass beide Ebenen angesprochen werden: das Sinnlich-Animalische und das Seelische.“ Er redet über Stimmen, berühmte Kollegen, seine Lehrer, technische Details, über eigene Ängste, Phobien und Niederlagen, über die Callas, die er gern komplette als Isolde gehört hätte (und nicht nur mit dem Liebestod), über Belcanto bei Wagner, Dirigenten, Deutschtümelndes im Lohengrin. Er weiß, wer Georges Thill war, hat sich bei seinem Werther-Studium mit dessen Aufnahmen beschäftigt, wollte mal französischer klingen als die Franzosen, kommt auf die Unterschiede des Faust bei Goethe und Gounod zu sprechen, reflektiert über Aspekte von Eigentherapie bei Don José. Er kommt auf Zeiten zu sprechen, da er „gern wie Wunderlich oder Corelli geklungen hätte“. Schließlich gelangt er aber zu dem Schluss, dass man sich als Sänger nichts Besseres antun könne, als „die eigenen Stimme zu finden“.
So schön, so gut. Bei allem Bemühen des Buches, hipp und jung sein zu wollen, wozu auch das inzwischen unerlässliche „geil“ gehört (ach ja…), gibt es reichlich konservative Anklänge. „Beseelt“ sei ein Wort, dass sich heute kaum noch einer auszusprechen traue, wirft Voigt mehr als Bemerkung denn als Frage ein. ein. Darauf Kaufmann: „Vielleicht, weil es den meisten Menschen zu kitschig klingt.“ Aber wenn man übers Singen rede, sei eben dieses Wort unersetzlich, weil „es einen Zustand“ bezeichne, den man nicht durch Wollen erreiche, sondern durch Geschehenlassen, nicht durch Leistung, sondern durch Sein“. Kaufmann als Philosoph. Auch das. Im Liedgesang sieht er die „Königsklasse des Singens“. Dieses Repertoire erfordere „wesentlich mehr Feinarbeit als jede andere sängerische Disziplin, mehr Farben, mehr Nuancen, mehr Differenzierungen in der Dynamik, subtileren Umgang mit der Musik und mit dem Text“. Und so liest es sich fort. Anspruchsvoll und unterhaltsam zugleich.
Bevor das Buch aber inhaltlich in Fahrt kommt, fallen gleich auf den ersten Seiten alle Stichworte, mit denen heutzutage sehr bunte Zeitungen und manche Talk-Shows auszukommen pflegen: Fußball, Kochkunst, Social Networks, Angela Merkel, Skifahrer, Foto-Shooting, Plácido Domingo, Christmas-Show, schöne Russin, roter Teppich, Krafttraining, Anna Netrebko, Thronfolger, Sexsymbol, Model-Image, Fitnessstudio, WM, Magen verkleinern, Latin-Lover-Look, Drei Tenöre – und Brad. Brad? Brad Pitt natürlich, wer sonst? Erst später, und im Personenverzeichnis eingeklemmt zwischen Edith Piaf und Michel Plasson, taucht er mit seinem vollen Namen auf. Wer nicht weiß, wer Brad ist, kann dieses Buch gleich zur Seite legen. Vorerst muss Brad reichen. Man ist ja unter sich, man kennt sich. So erklärt es sich, dass meistens auch nur von Jonas die Rede ist. Jonas dort, Jonas da, Jonas hier, Jonas oben, Jonas unten, Jonas hüben, Jonas drüben. „Jedem zu Diensten zu allen Stunden, umringt von Kunden bald hier, bald dort. So wie ich lebe, so wie ich webe, gibt es kein schön‘res Glück auf der Welt“, sagt wer anders in Rossinis Oper. Es jonast sich so durch die 240 Seiten. Jedem seinen Jonas.
Willkommen bei Facebook. Kaufmann ist ohne das Netz überhaupt nicht mehr vorstellbar. Nun tritt Marion Tung auf den Plan Sie betreibt die inoffizielle Kaufmann-Website. Die ist sehr gut gemacht. Mit Mühe und Sorgfalt ausgestattet. Immer auf dem Laufenden. Wer wissen, will, wann Kaufmann was und wo gesungen hat, wird genau so fündig wie der Operntourist, der schon mal die Flüge für den nächsten Auftritt in Übersee buchen will. Im Buch wird die Adresse der Website gleich mitgeliefert. Es bleibt auch – auf etwas uncharmante Weise – nicht unerwähnt, dass es sich bei Marion Tung um eine 62-jährige ehemalige Finanzbeamtin handelt, die verwitwet und also „völlig frei“ sei. Frei, um dem Tenor in alle Welt nachzureisen. Live-Sammler kennen sie – virtuell als Adina/Albous auf den Hosentaschenportalen (so behaupten Eingeweihte). Einst hatte sie sich José Carreras verschrieben und diverse Foren im Netz mit seinen Dokumenten überschüttet. Nun ist es Kaufmann. Nach den zitierten Angaben der Witwe Tung kursieren an die 500 Mitschnitte von Aufführungen und Konzerten Kaufmanns. Einen großen Teil davon dürfte sie selbst mitgeschnitten und in diversen Foren verbreitet haben, gehen die Gerüchte. Frage einen Kenner der Szene nach ihr, und er wird dir eine Geschichte erzählen. Da war doch damals was…. Aber nun ist sie sogar offiziell gelitten. Und in den engen Kreis vorgelassen. So wird man als Pirat Hofpersonal.
Sänger gehen heute offenbar viel lockerer mit derlei Fans um. Die mehren ihren Ruhm, weil sie ihn dokumentieren. In Opernhäusern und Konzertsälen ist er schneller verflogen. In den heimlichen Mitschnitten, die durch das Netz rasen, Festplatten und selbstgebrannte CDs füllen, bleibt er bewahrt. Anfrage aus Detroit: Hat jemand den soundsovielten Werther vom soundsovielten Tag in Paris? Habe ich, kommt nach wenigen Minuten die Antwort aus Brüssel! Wieder fünf Minuten später landet genau dieser Werther sechsmal auf dem Rechner der Person, die die Suche auslöste – weil auch andere mitgelesen hatten, die von sich behaupten, einen technisch noch viel besseren Mitschnitt zu besitzen. So ähnlich läuft das. Am Ende ist es völlig egal, wie die Tagesform der Sänger gewesen ist, ob ein Ton saß oder nicht. Manchmal spielt es sogar überhaupt keine Rolle, welches Werk gespielt wurde. Der Mitschnitt als solcher ist es. Kaufmann kann singen, was er will. Und wenn es der Vogelhändler wäre.
Musikkritiker sind nicht die Zielgruppe des Buches. Aber sie können es lesen. So bleibt einem das entzückend bebilderte Kapitel über „Eine ganz normale Kindheit“ aus der Feder einer gewissen Irene Leipprand nicht erspart, die dafür schon im Vorwort mit Dank versehen wird. Sie gibt vor, dass der kleine Jonas Kaufmann eines Tages am östlichen Rand von München während eines Fußballspiels mit improvisiertem Tor, bei dem er sich als „Schreihals“ hervortat, plötzlich „heimbefohlen“ wurde. Ein Fenster im fünften Stock habe sich aufgetan, daraus die Stimme der Mutter ertönte: „Jooooonas! Abendessen!“ (Wer hat nur die vielen O’s gezählt?) Jedenfalls habe der Junge dem Ruf „ohne Murren“ Folge geleistet. Im Treppenhaus sei ihm der Duft von „Rouladen und Kartoffelpürree“ in die Nase gestiegen. Oben angekommen, habe ihn die Mutter an der Wohnungstür „routiniert“ abgefangen. (Was immer darunter zu verstehen ist.) Frau Leipprand will sich genau daran erinnern, dass sich der spätere Weltstar an diesem ganz gewöhnlichen Münchner Abend zuerst die „vermatschten Schuhe“ auszog, dann (in dieser Reihenfolge) Socken und Hemd. Es bleibt nicht unerwähnt, dass beide Kleidungsstücke „in der Wäsche“ landeten. Die Lederhose musste nur trocknen und wurde „später ausgebürstet“. Ob vor dieser pflegerischen Verrichtung oder danach – jedenfalls rief der „Pimpf“ (Pimpf???) mit „lautem Organ“: „Is‘ Papa schon da?“ Aus für die Leser unerfindlichen Gründen drückte die Mutter daraufhin „schnell die Wohnungstür zu“. Stand sie die ganze Zeit offen? Endlich war die Familie um den Tisch versammelt. Dann sei „Fressstille“ (das steht da wirklich!) eingekehrt, und der Vater habe von seinem Arbeitsalltag erzählt. Eines Tages „nickte die Mutti im Sessel schon mal weg“, als sich Jonas beim täglichen „Tastenspiel“ erging (immerhin ein musikalischer Haushalt!). Ach, und dann diese Kälte beim Chorsingen auf den Rathausbalkon, als der Knabe und seine Schwester „gerötete Nasen“ hatten. So geht das wortreich fort in einer Sprache von 1930. Als würde aus Kindertagen von Rudi Schock erzählt. Manche Wörter habe ich seit Jahrzehnten nirgends mehr gelesen. Dazu gehört auch der „Knirps“, der sich beim ersten Opernbesuch wunderte, dass die tote Madame Butterfly am Schluss quicklebendig vor dem Vorhang erschien. Jonas wuchs prächtig heran. Seine Chronistin aus frühen Tagen lässt (fast) nichts unerwähnt, erspäht im Zimmer des Teenagers schon mal einen kleinen Kassettenrecorder und die Fan-Ecke für den FC Bayern München. So bleibt nicht aus, dass der „fröhliche Frechdachs“, mit dem schon mal „die Pferde“ durchgehen“, alsbald auch den „Liebreiz des weiblichen Geschlechts“ entdeckt. Und der staunenden Öffentlichkeit wird mitgeteilt, dass Jonas über ein „südländisches Aussehen“ verfügt. Unser Jonas: Ein Heimatroman im Klein-Heftformat ist nichts dagegen. Ach ja.
Rüdiger Winter
Thomas Voigt: Jonas Kaufmann – Tenor. Henschel/Bärenreiter, 240 Seiten, zahlreiche Fotos, ISBN 978-3-89487-938-9 (Henschel), 978-3-7618-2369-9 (Bärenreiter)