Zwar nicht vor den Türen der Komischen Oper Berlin ein „Felsenstein“, wohl aber in deren Foyer steht eine Büste des ersten und langjährigen Intendanten Walter Felsenstein und scheint von einer unanfechtbaren und unangefochtenen fruchtbaren künstlerischen Arbeit zu künden, einen Mythos zu bewahren und Anlass für manchen älteren Besucher zu sein, der guten alten Opern-Zeit dankbar zu gedenken.

Boris Kehrmann: Walter Felsenstein/ Tectum Verlag
Gründlich auf räumt die in zwei Bänden und auf 1365 Seiten als dritte der Dresdner Schriften zur Musik erschienene Dissertation von Boris Kehrmann mit dem Titel Vom Expressionismus zum verordneten “Realistischen Musiktheater“ – Walter Felsenstein- Eine dokumentarische Biographie 1901 bis 1951 mit jeder verklärenden Sicht auf Leben und Werk des österreichischen Theatermanns und zeichnet anhand von Dokumenten, vor allem auch von Briefen an und von der Hand Felsensteins ein beinahe bemitleidenswertes Bild eines von seiner Mission Besessenen, der unter zwei Diktaturen alles daran setzt, erduldet und in Kauf nimmt, um seine Vorstellungen von der Oper, oder besser gesagt vom „Musiktheater“ zu realisieren. Dabei verlagert sich das Interesse wohl manchen Lesers von der Person Felsensteins (laut Wikipedia * 30. Mai 1901 in Wien; † 8. Oktober 1975 in Berlin; Intendanz 1947 – 1975) auf die Umstände, unter denen er leben und arbeiten musste, angefangen von Kindheit und Jugend in einer konservativen österreichischen Familie bis schließlich zur in Ost wie West gleichermaßen betriebenen Demontage des künstlerischen Vermächtnisses des Regisseurs.
Bereits der Titel lässt aufhorchen, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass die noch immer weit verbreitete Meinung über Felsensteins künstlerischen Standpunkt mit der Vokabel „verordnet“ in ein trübes Zwielicht getaucht wird. Das Werk ist chronologisch gegliedert, übersichtlich trotz der Vielzahl der Themen durch eine Untergliederung in bis zu vier Ziffern. In einem „Epilog“ wird über die angegebene Zeit (1951) bis zum Tod von Felsenstein hinausgegangen. Innerhalb der einzelnen Themenkomplexe gibt es Exkurse, Überblicke über den jeweiligen Stand der Forschung. Der kritische Apparat ist immens umfangreich, der Anhang mit Rollenverzeichnis, Bibliographie, Personenregister, Bühnenwerken und Filmtiteln akribisch und jedem wissenschaftlichen Anspruch gerecht werdend. Fotos gibt es, dem Charakter des Werks entsprechend, nur als Cover: ein Kinderbild vor einem Auto und ein Blick auf Die Fledermaus von 1947.

Felsenstein und Anny Schlemm bei den Dreharbeiten zu „Ritter Blaubart“ an der Komischen Oper/arthaus
Im Vorwort des Herausgebers Matthias Herrmann wird auf die Bedeutung des Briefwechsels zwischen Felsenstein und seiner ersten, jüdischen Frau Ellen hingewiesen und die Behauptung aufgestellt, dass des Regisseurs „Gemeinschafts-Begriff weder im Nationalsozialismus noch in der Theorie des Sozialistischen Realismus wurzelt, sondern eine Auseinandersetzung mit dem „System der K. u. K.-Monarchie“ darstellt. Das Buch selbst geht allerdings über diese Sichtweise hinaus.
Mehr noch anzuzweifeln ist der Teil des Nachrufs von Elia Kazan, in dem es heißt: „Er herrschte wie ein König bis zu dem Tag, an dem er starb…“ Eher als einen von einer künstlerischen Idee Getriebenen, der er alles unterordnet, sei es Familie oder auch Selbstachtung, unerbittlich gegenüber sich selbst und gegenüber seinen Mitarbeitern dokumentieren ihn die vielen Quellen, die zitiert werden.
Als typisch und durchgehend festzustellen ist das Fehlen jeder Auseinandersetzung mit der Musik der Opern, die der Regisseur inszeniert, stets geht es um das Libretto, den Stoff, die Übersetzung, von denen er viele selbst wegen des Ungenügens der vorhandenen anfertigt.

Felsenstein bei den Proben zu „Othello“/ arthaus (oben daraus ein Ausschnitt)
Wichtig für den Leser ist die wiederholte Gegenüberstellung von dem, was man in der DDR als Sozialistischen Realismus als politischem Machtinstrument und Realistischem Musiktheater verstand und welche Vorstellungen Felsenstein davon hegte und umzusetzen versuchte, vom Autor „realisiertes Musiktheater“ genannt. Vergleiche mit Wieland Wagners Bestrebungen , die Beschränkung des Begriffs auf den Inhalt, nicht die Ausweitung auf die Form, der Hinweis auf den „expressionistischen Überdruck“ bei den ersten schauspielerischen Versuchen sind aufschlussreich und werfen ein neues Licht auf den Künstler. Die Frage nach Kontinuität oder Bruch in der künstlerischen Entwicklung wird erörtert, der Einfluss der Künstler der jungen Sowjetunion, die Nöte der Weimarer Republik, die Akzeptanz der Rahmenbedingungen, unter denen sein Wirken im Nationalsozialismus möglich ist, der zusätzliche Druck durch die Angst um Frau und Söhne.
Der Leser erhält einen umfangreichen und detaillierten Einblick in das Wiener wie das Berliner Theaterleben. Ein besonderes Kapitel gilt der Zusammenarbeit mit Heinrich George, und auch ein bitterer Brief von Bertha Drews wegen der Verweigerung eines „Persilscheins“ für den Gatten wird dem Leser nicht vorenthalten. Besonderes Interesse verdienen die Kapitel mit Zutatencharakter wie „Meine rigorosen und sehr selbständigen Regieforderungen“ oder „Dass die Realität nicht zum Realismus veräußerlichte“, die bereits dem von der DDR verbreiteten Bild widersprechen, als es diese nach gar nicht gab. Mit „nicht sagen – meinen“ und mit „Zustand“ anstelle von „Darstellung“ wird er seine Sänger traktieren, von denen er einigen „Flügel verleiht“, sie anderen eher gebrochen hätte, wie dem jungen Fischer-Dieskau. Auch die Auseinandersetzungen um die Inszenierung von Schillers „Braut von Messina“ sind interessant. Sieht man von der Sorge und den Kampf um die Familie ab, verläuft die künstlerische Arbeit Felsensteins im Dritten Reich eher reibungsloser als in der DDR, wo er als Intendant natürlich auch mehr im Fokus der Bestrebungen der Machthaber stand.
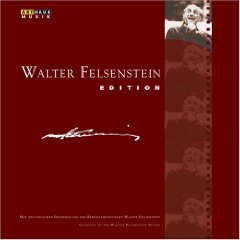
Bei arthaus ist eine dicke Box mit Filmaufnahmen einiger seiner im DDR-TV-gezeigten Opern erschienen, gleichzeitig enthält die Box auch Proben- und Aufführungs-Dokumente der vorausgehenden Bühnenproduktionen von Walter Felstein an der Komischen Oper Berlin
Um Personalpolitik im geteilten Berlin vor und nach dem Mauerbau, um den Aufbau des ehemaligen Metropol-Theaters, von dem nur der Zuschauerraum samt Kronleuchter von den Bomben verschont blieb, um die geschickte Umleitung vom von der Besatzungsmacht geplanten Operettentheater zur Komischen Oper geht es im zweiten Band, und zunehmend um die schikanöse DDR-Kulturpolitik, wie nicht nur das Beispiel Carl Orff zeigt. Abgründe klaffen zwischen dem Kampf um Pajok-Pakete und künstlerischen Idealen. Kein Wunder, dass in den vielen privaten Briefen fast ausschließlich von Krankheiten, Arbeitsüberlastung, Enttäuschungen, Verzögerungen oder dem Ausfall von Premieren die Rede ist. Diese sind dann immer Riesenerfolge und haben zahlreiche Einladungen auch ins westliche Ausland zur Folge, die nicht immer angenommen werden können. Nicht nur der Autor ist erstaunt darüber, wie kritiklos Felsenstein nach Reisen in die SU und nach China das dortige Kulturleben und nicht nur dieses verklärt.
Der Kalte Krieg zwingt Felsenstein zwischen seine Fronten. Ihm wird von beiden Seiten übel mitgespielt, was der Autor trotz aller wissenschaftlichen Ernsthaftigkeit spannend wie einen Krimi darzustellen weiß.

Trauerfeier für Walter Felsenstein 1975 in der Komischen Oper Berlin/ Foto Reiche/ Bundesarchiv/ Wikipedia
Dass Götz Friedrich sich bereits damals zu leicht ironischen Bemerkungen hinreißen lässt, kann man verstehen, wenn man die Interpretation der Zauberflöte durch Felsenstein als den Kampf zwischen dem guten Politbüro (Sarastro und die Seinen) und dem westlichen Imperialismus nachvollziehen soll. Die meisten Zuschauer dürften das ebenso wenig bemerkt haben wie den Willy-Brandt-Scarpia in einer Tosca-Inszenierung durch Friedrich. Auch allein die Vorstellung einer Zusammenarbeit zwischen Felsenstein und Carlos Kleiber (Freischütz in Stuttgart) bewegt die Lachmuskeln oder das Ringen um einen antiamerikanischen Schluss für Der Fiedler auf dem Dach das widerspenstige Werktätigenpublikum, das die Freikarten lieber weiter verkauft, statt sich dem Kunstgenuss hinzugeben.

Walter Felsenstein hinter der Kamera für „Othello“/ Foto arthaus
Geradezu tragisch aber mutet die allmähliche Entmachtung des einst Verhätschelten an, die besonders deutlich nach dessen Umsiedlung in die DDR wird, doch nicht ganz nachvollziehen kann man die Meinung des Verfassers, der einst gegen das Elternhaus Revoltierende sei gegen Ende seines Lebens zu den Idealen der fromm-konservativen Mutter zurück gekehrt. Auf jeden Fall wird ein nachdenklich-mitleidiger Blick beim nächsten Besuch der Komischen Oper die Büste des Walter Felsenstein streifen, der viel, vielleicht zu viel den künstlerischen Bestrebungen opferte, die er für die allein richtigen, ja seligmachenden hielt, Ulbricht nicht widersprach, als der in seinem Beisein meinte, die Mauer sei eine Grenze wie jede andere Staatsgrenze auch, die man mit den richtigen Papieren überqueren könne.

Der Autor Boris Kehrmann/ Foto Scholz/ dieterdavidscholz.de (ebendort auch eine weitere ausgiebige Rezension des Buches).
Der Verfasser des so dickleibigen wie informationsreichen Buches hat die Felsenstein-Büste von Wieland Förster im Foyer der Komischen Oper Berlin nicht zertrümmert, ihren Sockel aber etwas tiefer gestellt (Dresdner Schriften zur Musik, Tectum Verlag Marburg 2015, 1365 Seiten, ISBN 978 3 8288 3266 4). Ingrid Wanja

