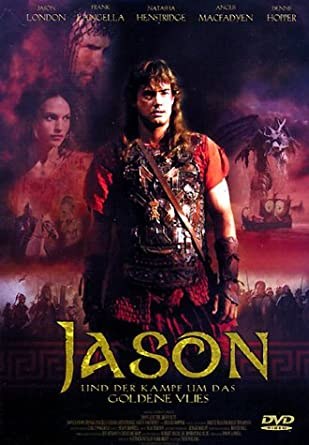.
Keinesfalls handelt es sich bei der neuen, hier vorgestellten Barockoper Jason oder die Eroberung des goldenen Vließes von Georg Caspar Schürmann bei cpo um eine verschollene Aufnahme mit Maria Callas, wie das obige Foto aus ihrem Film von 1969 suggerieren würde. Aber die Versuchung, den Medea-Topos mit der Seeligen zu verknüpfen ist zu verführerisch um dem zu widerstehen. Deshalb mag der geneigte Leser den kleinen Ausflug in die Phantasie verzeihen, die Diva mit einem Werk des frühen 18. Jahrhundert zu assoziieren. Vielleicht hätte sie die Schürmannsche Medea lieber gesungen als den Pasolini-Film abgedreht, der nicht zu ihren überzeugendsten Dokumenten gehört. Er hat ihre Karriere nicht verlängert-
Wie auch immer – wir Barock-Opernfans sind wieder einmal bei der Firma cpo in der Schuld, eine weitere spannende Barockoper nach Carl Heinrich Grauns Polydorus (bei operalounge.de besprochen) und nach der Getreuen Alceste (dto.) nun Schürmanns Jason herausgebracht zu haben. Die Dirigentin Ira Hochman, die mit ihrem Orchester barock werk hamburg hat dazu einen hochinformartiven Artikel geschrieben, den wir mit Dank hier wiedergeben. Eine Rezension folgt. G. H.
.
 Mit der Aufnahme von Jason oder die Eroberung des goldenen Vließes (cpo 555339-2) widmet sich das barock werk hamburg erneut einer Oper aus der Feder Georg Caspar Schürmanns. Die Erst-Wiederaufführung und spätere Einspielung von Die getreue Alceste im Jahr 2016 (cpo 555 207-2) hinterließ beim Ensemble den starken Wunsch, weitere Musik dieses zu Unrecht wenig beachteten Komponisten zu entdecken. Bei der Durchsicht seiner handschriftlich erhaltenen Werke fiel insbesondere die Oper Jason oder die Eroberung des Goldenen Vließes auf. Fälschlicherweise einem anderen Komponisten zugeordnet und dazu noch als Pasticcio (also ein Flickwerk aus Arien diverser Autoren) abgestempelt, stand sie bisher nicht im Fokus der Forschung. Jedoch war das Werk in den Jahren 1720-1722 an der Gänsemarkt- Oper in Hamburg durchaus sehr erfolgreich und wurde nicht weniger als 31 Mal aufgeführt. Die Handschrift der Hamburger Fassung (Staatsbibliothek zu Berlin, Museums. 20362) geht auf das Jahr 1720 zurück und ist die einzige vollständige Musikquelle der Oper. Zuvor wurde Schürmanns Jason in den Jahren 1707, 1708 und 1713 bereits an der Hagenmarkt-Oper in Braunschweig gespielt, zuletzt kurioserweise zum Besuch des russischen Zaren Piotr des Großen bei Herzog Anton Ulrich. Die Tatsache, dass Schürmann sich über 13 Jahre mit seinem Jason beschäftigte, deutet ebenfalls darauf hin, dass es sich dabei um ein vielversprechendes Werk handelt.
Mit der Aufnahme von Jason oder die Eroberung des goldenen Vließes (cpo 555339-2) widmet sich das barock werk hamburg erneut einer Oper aus der Feder Georg Caspar Schürmanns. Die Erst-Wiederaufführung und spätere Einspielung von Die getreue Alceste im Jahr 2016 (cpo 555 207-2) hinterließ beim Ensemble den starken Wunsch, weitere Musik dieses zu Unrecht wenig beachteten Komponisten zu entdecken. Bei der Durchsicht seiner handschriftlich erhaltenen Werke fiel insbesondere die Oper Jason oder die Eroberung des Goldenen Vließes auf. Fälschlicherweise einem anderen Komponisten zugeordnet und dazu noch als Pasticcio (also ein Flickwerk aus Arien diverser Autoren) abgestempelt, stand sie bisher nicht im Fokus der Forschung. Jedoch war das Werk in den Jahren 1720-1722 an der Gänsemarkt- Oper in Hamburg durchaus sehr erfolgreich und wurde nicht weniger als 31 Mal aufgeführt. Die Handschrift der Hamburger Fassung (Staatsbibliothek zu Berlin, Museums. 20362) geht auf das Jahr 1720 zurück und ist die einzige vollständige Musikquelle der Oper. Zuvor wurde Schürmanns Jason in den Jahren 1707, 1708 und 1713 bereits an der Hagenmarkt-Oper in Braunschweig gespielt, zuletzt kurioserweise zum Besuch des russischen Zaren Piotr des Großen bei Herzog Anton Ulrich. Die Tatsache, dass Schürmann sich über 13 Jahre mit seinem Jason beschäftigte, deutet ebenfalls darauf hin, dass es sich dabei um ein vielversprechendes Werk handelt.
Problematik der Autorschaft: Wie lassen sich nun die Frage der unsicheren Autorschaft und der Vorwurf, dass das Werk ein Flickwerk sei, einordnen? Bei der Recherche ließ sich schnell klären, dass sich die Zuschreibung des Jason an den Komponisten Johann Sigismund Kusser zwar teilweise bis heute gehalten hat, das Libretto der gleichnamigen Oper von Kusser jedoch mit Schürmanns Jason nichts gemeinsam hat. Den Vorwurf zu widerlegen, die Musik stamme zum großen Teil nicht von Schürmann, war wesentlich schwieriger. Johann Mattheson, berüchtigter Kritiker seiner Zeit, schrieb über den Jason in Hamburg: „Erneuert, und von unterschiedenen Componisten, vermuthlich wieder ihr Wissen und Willen, wie viele andere Opern, zusammen gesetzet.“ Bei der großen Zahl von italienischsprachigen Arien in der handschriftlichen Partitur des Jason stellte sich allerdings zunächst die Frage, ob Schürmanns kompositorischer Anteil an der Oper groß genug war, um ihm das Werk zuschreiben zu können.

Jason und Medea, 1759 von Carle van Loo (1705-65)/ Musée des Beaux-Arts Paris/ Wikipedia
Die Tradition, mehrere Sprachen in einem Bühnenwerk zu mischen, die an der Gänsemarkt-Oper in Hamburg besonders verankert war, erweckte schon damals rege Polemik unter den Librettisten und Komponisten. Schürmann selbst äußerte sich dazu in einem Brief aus Braunschweig von 1726: „Die Opera anlangend, so machen wir die teutschen Opern pur teutsch, wann wir aber etliche mahl italienische Opern ins teutsche übersetzet, so haben wir wohl die Arien mehrentheils italienisch gelassen.“ Dieser schürmannsche Schlüsselsatz über die italienisch „gelassenen“ Arien sowie die Entstehungsgeschichte dieser Oper lassen den Schluss zu, dass im Fall des Jason der größte Teil der italienischen Arien von Schürmann stammt
In der Tat wurde in Braunschweig im Jahr 1707 die italienische Oper Giasone, overö II Conquisto deI Vello d’oro (Libretto von Flaminio Parisetti, Musik höchstwahrscheinlich von Hofkapellmeister Schürmann) zum ersten Mal gespielt. Dem gedruckten Libretto lag eine deutsche Übersetzung in Prosa bei. 1708 erklang die Oper erneut, nun in veränderter Form mit fünf deutschen Arien und deutschen Rezitativen. Im Libretto von 1713 erhöhte sich der Anteil der deutschen Arien auf 13. 4 Die Rezitative wurden von Schürmann selbst auf Deutsch gedichtet, er übernahm solche Aufgaben des Öfteren. Das Libretto von 1713 beinhaltet unter anderem die Texte von 20 italienischen Arien, Duetten und Chören, die wir in der Hamburger Fassung von 1720 unverändert wiederfinden. Bis zur letzten Fassung erhöhte sich der Anteil der deutschsprachigen Arien auf 19 gegenüber den 33 italienischen Arien. Da es sich bei der Partitur-Handschrift um eine Werkfassung für die Hamburger Gänsemarkt-Oper handelt, muss man bei der Bewertung der Autorschaft unbedingt auch die Begebenheiten dieses Opernhauses berücksichtigen. Das bürgerliche Publikum erwartete gute Unterhaltung, unter anderem durch italienische Einlagearien, lustige Charaktere und fantasiereiche Bühnentechnik.

Jason raubt das Goldene Vließ/ Deckengemälde um 1850 von August Theodor Kaselowsky im Neuen Museum von Berlin/ Foto Winter
Wurden diese Vorlieben nicht bedient, blieb das Publikum weg. Es gab zwar keine feste Tanztruppe und man ließ die typisch französischen Tanzeinlagen fort, dafür diente die Instrumentalmusik dem Szenenwechsel, der Bedienung der Maschinen, dem Ausmalen des Zauberspuks, der Beschwörungen der Geister, den Auftritten der Begleitpersonen der Götter oder des Königsgefolges usw. Unter der hohen Anzahl italienischer Arien verbargen sich in der Handschrift des Jason auch einige sogenannte „Arien aus dem Koffer“, jene Bravourstücke der auswärtigen reisenden Sänger, die man erfolgversprechend mit einbezog. Diese Arien lassen sich meist leicht identifizieren. Im Jason wurden sie von einem anderen Schreiber notiert und nachträglich in die Partitur eingeheftet. Die 11 Einlagearien im Jason stammen aus Opern von Caldara, Lotti, Gasparini und Vivaldi und wurden in der vorliegenden Aufnahme fortgelassen.
Beim Vergleich der drei zeitgenössischen Libretto- Drucke stellte sich heraus, dass Schürmann für die Gänsemarkt-Oper gegenüber den früheren Fassungen weitere Änderungen und Ergänzungen vorgenommen hat. So wurden der Eingangschor mit dem italienischen Text von Parisetti entweder neu komponiert oder parodiert, sowie der Schlusschor mit einem neuen deutschen Text versehen. Die Rezitative wurden zum Teil nicht nur musikalisch, sondern auch textlich neugestaltet. Außerdem komponierte Schürmann zwei deutsche Arien neu und fügte die großartige Bass-Arie „Kein Sturm erregt so sehr die wilden Wellen“ aus seiner Oper Telemachus und Calypso (Braunschweig 1717, Handschrift der Oper nicht erhalten) ein, die er ursprünglich für den berühmten Bassisten der Braunschweiger Oper, Solomon Bendler, geschrieben hatte.

Georg Caspar Schürmann: „Jason oder die Eroberung des Goldenen Vließes“/ Foto barock werk
Hilfreich war auch die vorangegangene intensive Beschäftigung mit Schürmanns Alceste. Das „Erkennen“ seiner Musik mag zwar rein empirisch sein, ist aber dadurch nicht wertlos. Gleich zu Beginn der Oper sticht die Arie des Stiro, „Gelosi pensieri“, mit konzertierendem Fagott heraus. Auch die Arie des Assirtus mit Traversflöte und Oboe, „Serenatevi, amanti pensieri“, Medeas Schlaflied für den Drachen, „Dolce sonno neghittoso“, sowie die Arie der Hissifila, „Götter, Sterne, habt Gedult“, weisen gut erkennbar die Tonsprache Schürmanns auf.
Der Komponist: Georg Caspar Schürmann (1672/73-1751) begann seine Karriere 1693 im Alter von 21 Jahren als Altist an der Gänsemarkt-Oper in Hamburg. Vier Jahre später wechselte er nicht ganz freiwillig in den Dienst von Herzog Anton Ulrich nach Braunschweig, da er 1697 auf einer Reise aus Notwehr einen streitsüchtigen Kollegen erstochen hatte. Trotz des Freispruchs war ihm die Rückkehr nach Hamburg erst einmal verwehrt. In Braunschweig erhielt er im selben Jahr eine Anstellung als Altist an der Wolfenbütteler Hofkapelle und übernahm dabei auch Aufgaben eines Kapellmeisters. Herzog Anton Ulrich entsandte Schürmann Ende 1701 für circa ein Jahr nach Venedig, wo er die Opern von Albinoni, Pollarolo und Gasparini studierte. Nach seiner Rückkehr war er zeitweise in Meiningen und in Braunschweig tätig. Im Jahr 1706 brachte er in Naumburg die Oper Telemaque zur Aufführung. Ab 1706 arbeitete er in Braunschweig als offizieller Hofkapellmeister. Zwischen 1717 und 1721 gastierte er als Kapellmeister an der Hamburger Gänsemarkt-Oper. In dieser Zeit wurden dort sowohl Die getreue Alceste als auch Jason oder die Eroberung des Goldenen Vließes aufgeführt. 1722 übernahm Telemann die Leitung des Theaters. Schürmann war eine äußerst vielseitige Künstlerpersönlichkeit. Er komponierte sowohl geistliche Werke als auch weltliche Tafelmusik und war in seinen etwa 30 Opern nicht nur als Komponist, sondern von Fall zu Fall auch als Regisseur, Sänger, Kapellmeister, Textdichter und Übersetzer tätig.
Die Musik des Jason: Die vorliegende Aufnahme präsentiert eine circa zweistündige, deutlich gekürzte Fassung des Jason, ein zweisprachiges Bühnenwerk mit Elementen der italienischen und deutschen Barockoper. Einige im Libretto erwähnte, aber in der Handschrift fehlende Instrumentalstücke wurden aus Schürmanns Opern Alceste und Ixion übernommen. Nach viel Reflektions- und Recherchearbeit, die in diese Fassung geflossen ist, wurden neben den bereits erwähnten Einlagearien auch acht Arien, die nachweislich von Schürmann sind, ausgelassen, sowie zwei Arien und die dazugehörenden Rezitative innerhalb der Oper versetzt.

Giovanni Battista Crosato „La rapina del vello d’oro„, 1685-6/ Wikipedia
Dass Schürmann die Oper mit einem prächtigen Jubelchor des Volkes der Colchier „Vittoria, vittoria!“ und nicht mit einer französischen Ouverture eröffnet, ist sicherlich kein Zufall. Der satte Klang des ganzen Orchesters, verstärkt durch drei Trompeten und Oboen, umschließt elegant eine längere Eingangsszene, die den ersten Auftritt der Hauptdarsteller und König Eetas Begrüßungsarie beinhaltet. Der für die Hamburger Fassung neu komponierte Schlusschor dagegen ist knappgehalten und beendet die Oper mit Schwung. Grundsätzlich findet man in der Oper des Öfteren kurz gehaltene Formen mit einfachem Textdurchgang. Größer angelegt sind die Dacapo-Arien mit konzertierenden Soloinstrumenten, wie beispielsweise die markante Arie der Medea „Die Hoffnung kann dich glücklich machen“ mit Solo-Violine. Medea, über alles in Jason verliebt und unaufhaltbar in ihrem Streben nach dieser Partnerschaft, berauscht sich selbst mit ihrer Hoffnung. Und so steigt auch der virtuose Violinpart weit über den gewöhnlichen Ambitus der Zeit bis zum a'“ hinauf. Auch in der spektakulären Arie des Stiro „Gelosi pensieri“ mit obligatem Fagott gleich zu Beginn der Oper, erweitert Schürmann den Klangumfang des Fagotts um ein Kontra-ß. Die Klangfarbe des Instruments gibt auf perfekte Weise die getrübte Stimmung des in der Liebe unglücklichen Stiro, seine Zweifel und die Vorahnung des Scheiterns wieder. Die oben schon erwähnte Arie des Königs Eeta „Kein Sturm erregt so sehr die wilden Wellen“ in ihrem allmählichen Aufbau der Dissonanzen und Tonwiederholungen ist eine beeindruckende Tonmalerei des Sturmes und gleichzeitig eine effektvolle Bass-Koloraturarie. Die wenigen und kurz gehaltenen Instrumentalsätze verdienen allesamt besondere Aufmerksamkeit. Die Erscheinung der Medea an einem verfallenen Ort mit Toten-Gräbern wird im Preludio (CD 1, Track 13) durch furchterregende Läufe des „Grand Violon con l’arco“ untermalt. Das Aussäen der Schlangenzähne im dritten Akt wird durch das „pieksige“ Verstreuen der Sechzehntel der Streicher I »gestellt, während die aus der Erde gestiegenen Krieger, die sich untereinander selber umbringen, mit Hilfe der Zweiunddreißigstel der Violinen wie Dominosteine umfallen. Aber das wahre musikalische Kleinod der Oper wird behutsam wie eine Perle in einer Muschel in einem Rezitativ versteckt (CD 2, Track 14). Es ist die Eroberung des Goldenen Vließes selbst. Die Musik zur Entführung des an einem Baum zur Schau gestellten Felles des goldenen Widders Chrysomeles findet sich zwischen dem bezaubernden Schlaflied Medeas für den Drachen „Dolce sonno neghittoso“ und dem Duett von Jason und Medea auf ihrer Flucht.
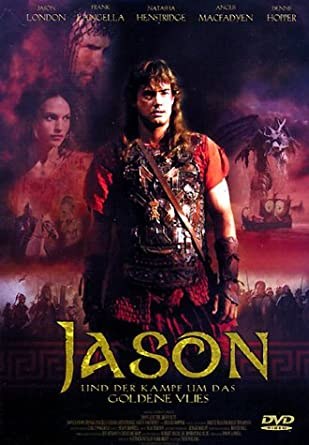
Moderne Mythen auf DVD
Im dritten Akt, dem längsten der Oper, kommen Medeas versierte Zauberkünste musikalisch voll zur Geltung. Auf ihren Wunsch hin verändert sich der wüste Ort in einen verzauberten Garten, und Jason erwacht „bey einer angenehmen Music von allerhand Instrumenten und unter dem Singen der verstellten Einwohner dieses Lust-Orts“. Schürmann komponierte für diese Szene drei duettartig konzipierte Chöre (CD 2, Track 4-6) mit allerlei harmonischen Verwicklungen und verwendete eine seltene Flötenart, das Flageolet. Mit den „allerhand Instrumenten“ könnte eine Bühnenmusik gemeint gewesen sein, ähnlich der Verführungsszene der Cleopatra in Giulio Cesare in Egitto von Georg Friedrich Händel. Nicht zuletzt sei die harmonische und melodische Sprache der Rezitative erwähnt, die sehr expressiv, gewagt und gleichzeitig subtil ist. Medeas Partie ist durchweg am facettenreichsten, und so ist auch in ihren Rezitativen ein breites Spektrum der Gefühle zu hören, vom Verliebtsein über Zweifel, Eifersucht, Rache und Verführung bis hin zu Herrschsucht und Siegeslust.
Das komische Paar: Diese Publikumslieblinge durften auf der Bühne der Gänsemarkt-Oper nicht fehlen. Im Jason von 1720 sind es Sarfax, Medeas buckliger Zauberknecht und ständiger Begleiter, und seine geliebte Filaura, Hofdame der Königin Hissifila von Lemnos. Im Libretto 1707 finden wir sogar eine Dreiecksbeziehung, in der noch Nifus, Jasons Vertrauter, um Filaura wirbt und nebenbei sehr treffende Kommentare über Jasons undurchsichtiges Verhalten abgibt.

Nicht zu vergessen: So sah er aus – der Komponist Georg Caspar Schürmann/Wikipedia
So sehr der Verlust von Nifus in der Hamburger Fassung auch zu bedauern ist, liefern Sarfax und Filaura als Paar eine köstliche Unterhaltung. Sarfax Buckel (eine alte Theater-Tradition), seine hektischen Gebärden, das Verfallen von einer überschwänglich munteren in eine verzweifelte Stimmung (CD 2, Track 1 3) geben ein herrliches Bild ab. Er versucht auf seine plumpe Art Medeas Zauberkünste anzuwenden, um in der Liebe zu seinem Ziel zu gelangen. Er plaudert schnell, mal mit dem Publikum, mal mit Filaura, das Beste aber a parte. Er preist sich als „praver Mann“ und ist sogar bereit von Filaura verprügelt zu werden, denn er glaubt: „Die Liebe will gezancket seyn“. In den dynamischen Rezitativszenen hört er von Filaura nichts Ermutigendes: „Was ist das für ein Gesicht?“, „Du Kamehl“, „Du Ungeheuer!“ Zwischenzeitlich gibt sie zwar ihr Jawort, doch am Ende der Oper, wenn die anderen beiden Paare zueinanderfinden, geht Sarfax leer aus. Es ist ihm bewusst, dass man sich über ihn lustig macht, aber sein Credo ist trotzdem: „Ich bleibe doch wohl, wer ich bin“.
Seine und Filauras Musik unterscheidet sich vom Rest der Oper durch die Kürze ihrer Continuo-Arien und dem volkstümlichen und tänzerischen Charakter. Sarfax und Filauras Beziehungskomödie bildet über drei Szenen eine Art durchgehendes lustiges Intermezzo, das es im Hamburger Theater typischerweise zwischen den Akten der ernsten Opern gegeben hat.
Schürmanns Name ist noch immer nur Wenigen ein Begriff. Mit der zweiten Opernausgrabung versuchen wir dies zu ändern und behaupten, dass er ein sehr wichtiger deutscher Komponist barocker Opern war. Sein Werk Jason oder die Eroberung des Goldenen Vließes verdient ein neues Bühnenleben. Die Musik des Jason ist wirkungsvoll, kontrastreich, bewegend, lustig und originell instrumentiert. Und sie ist uns inzwischen ans Herz gewachsen. Ira Hochman
.

Die Dirigentin und Prinzipalin Ira Hochman/ barockwerk hamburg
barock werk hamburg Im Jahr 2007 gründete Ira Hochman das Ensemble barock werk hamburg, welches sich zum Ziel gesetzt hat, sowohl vokale als auch instrumentale Kammer- und Bühnenmusik aus dem Barockzeitalter wiederzuentdecken und zu neuem Leben zu erwecken. Dabei schöpft das Ensemble insbesondere aus der reichen hamburgischen Tradition, die im 17. und 18. Jahrhundert nicht nur zahlreiche große Musiker, sondern auch Publikum und Mäzene aus ganz Nordeuropa anzog.Zu den Erstwiederaufführungen des barockwerib gehören einige ausschließlich als Handschriften erhaltene Kompositionen, darunter Johann Matthesons Hochzeits- Serenata Der verlorene und wiedergefundene Amor, das Oratorium Christi Wunder-Wercke bey den Schwachgläubigen, Georg Philipp Telemanns lateinische Ode auf den dänischen König für das Christianeum in Altona und die Altonaer Jubel Music“ von 1760 (beide cpo 555 018-2), seine Musiken zum Einweihungsfestakt für das Christianeum 1744 und zur Einweihung der Kirche des Hamburger St. Hiob-Hospitals 1745 (beide cpo 555 255-2) sowie seine Kantaten für die hannoverschen Könige von England (cpo 555 426-2), Carl Philipp Emanuel Bachs Hamburger Bürgerkapitänsmusik von 1780 (cpo 555 016-2), Johann Adam Hillers Singspiel Lisuart und Dariolette oder die Frage und die Antwort, Georg Caspar Schürmanns Oper Die getreue Alceste (cpo 555 207-2), Carl Heinrich Grauns Opern Polydorus (cpo 555 266-2) und Iphigenia in Aulis sowie auf der CD La Prima Diva (Tactus) enthaltene Arien und Opernsinfonien. (Den obenstehenden Artikel übernahmen wir aus der neuen Aufnahme von Schürmann mit freundlicher Genehmigung der Firma cpo und Ira Hochmann/ Foto oben Maria Callas in dem Medea-Film von Pier Paolo Pasolini, 1969/ DVD Studiocanal vergl. Amazon)
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

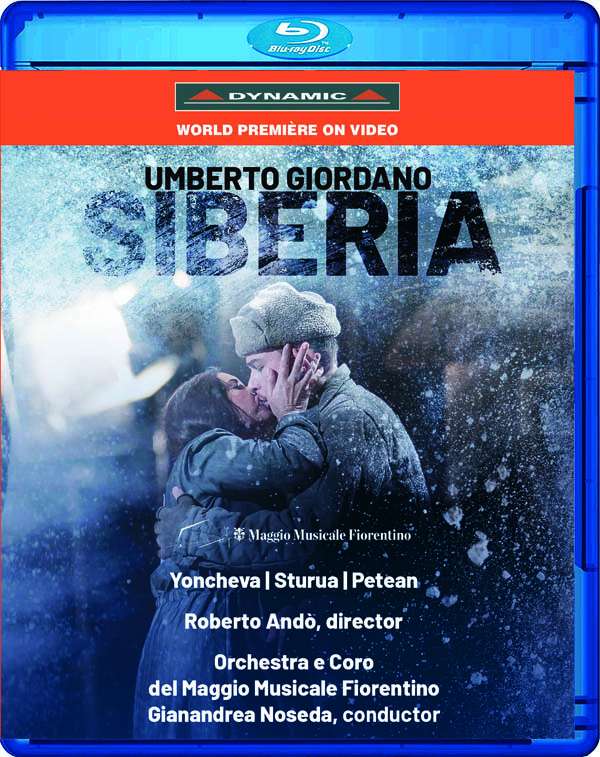


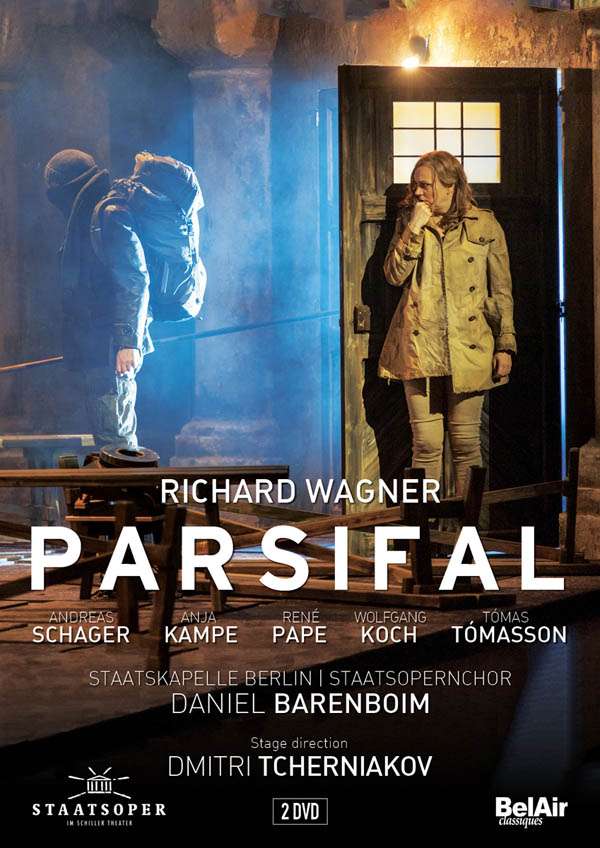
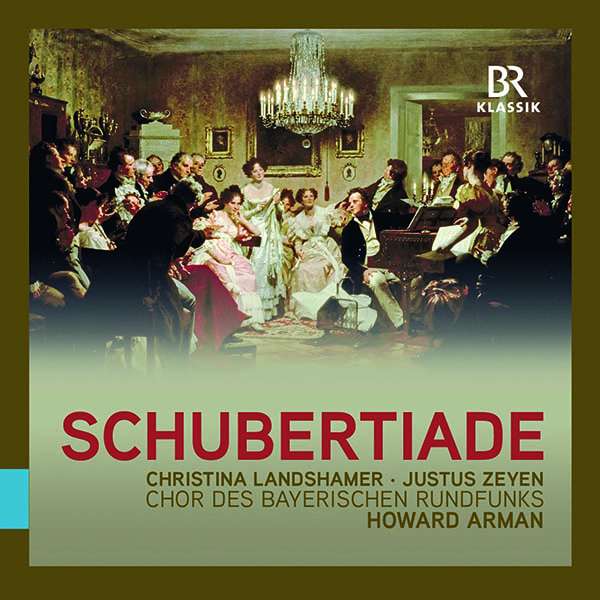


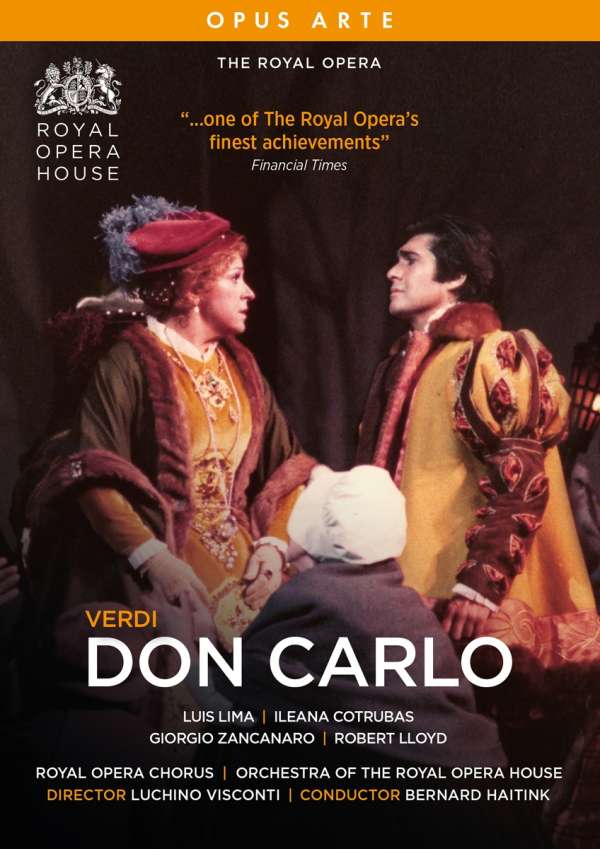





 Mit der Aufnahme von
Mit der Aufnahme von